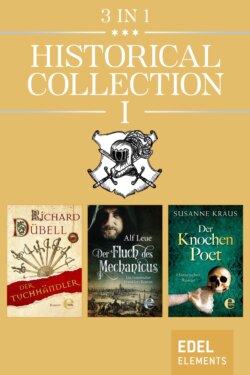Читать книгу Historical Collection I - Susanne Krauß - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеIch hatte mir genügend Feinde gemacht während meiner Tätigkeit für Bischof Peter, und es hatten der eine oder andere die Faust gegen mich geschüttelt. Niemals jedoch hatte mich jemand umbringen wollen. Der Zwischenfall am Sonntag hatte mich erschreckt; jetzt aber war mein Gleichgewicht nachhaltig gestört. Ich lag wach in meinem Bett; schlaflos, schaudernd und halb betrunken. Gleich nach Marias Tod hatte ich gedacht, nichts würde mich mehr wirklich erschüttern können; und an manchen Tagen war mir schon danach gewesen, als wollte ich den willkommen heißen, der mich von meinem Leben erlöste. Doch die Zeit hatte das ihre getan und jener Kreatur wieder Stärke gegeben, die sich mit beiden Händen an ihre Existenz klammerte und rief: Ich will leben. Ich hatte ihren Ruf schon lange nicht mehr so deutlich vernommen wie heute. Der große Schnitter hatte nicht genügend aufgepaßt, und Hanns Altdorfer und ich waren dem Schwung seiner Sichel entgangen.
Am Dienstag morgen erwachte ich erst, als die Sonne schon hoch am Himmel stand und meine Schlafkammer in helles Licht getaucht war. Ich konnte mich nicht entsinnen, wann ich eingeschlafen war. Meine Glieder schmerzten, als hätte ich am Vortag lange und hart körperlich gearbeitet. Ich taumelte, noch halb im Schlaf befangen, in die Stube, um den Verwalter dafür auszuscheren, daß er mich nicht geweckt hatte; er saß am Tisch, hatte Wasser, Milch, eine unangetastete Schale mit geröstetem Getreide und ein paar Scheiben weißes Brot um sich herum ausgebreitet und lächelte mich an.
»Setzt Euch zum Essen, Herr«, sagte er und wies auf die Speisen.
»Warum hast du mich nicht geweckt?« brummte ich.
»Ich hatte das Gefühl, Ihr wart sehr erschöpft.«
»Ich war auch sehr betrunken von dem Glühwein, den du mir gestern eingeflößt hast«, sagte ich.
Er war bestürzt gewesen, als mich ein Trupp von fünf Wappnern gestern abend nach Hause gebracht hatte; und noch bestürzter zu hören, daß der Stadtkämmerer und ich Opfer eines Überfalls geworden waren. Er nahm mich in Empfang, setzte mich, der ich noch immer ab und zu am ganzen Körper erschauerte und wortlos in düsteren Gedanken versunken war, in die Stube ans Feuer, ließ einen Topf mit Wein erhitzen und gesellte sich zu mir. Während ich den gewürzten Wein mit durstigen Schlucken trank, ereiferte er sich über die Verhältnisse in der Stadt, in der die Zahl der Strauchdiebe in den Straßen von der Zahl der frei herumlaufenden Schweine und Kühe kaum mehr übertroffen wurde; ich hörte ihm kaum zu, aber ich wußte, daß es seine Art war, mich zu trösten. Obwohl der Sinn des Gesprächs zumeist unverstanden an meinen Ohren vorbeitrieb, beruhigte mich der Fluß seiner Worte. Zuletzt taumelte ich angetrunken in meine Schlafkammer, vor dem Feuer beinahe im Sitzen eingeschlummert.
Ich hockte mich neben ihn an den Tisch und trank ein paar Schluck Wasser. Nachdem ich das getan hatte, erschien es mir möglich, etwas feste Nahrung zu mir zu nehmen, und ich schaufelte mit wachsendem Hunger den gerösteten Weizen in mich hinein. Die körperlichen Beschwerden vergingen mit dem Essen, und ich begann, mich wieder besser zu fühlen.
»Hast du schon etwas bezüglich des Verkaufs des Flößerholzes erreicht?« fragte ich ihn mit vollem Mund.
»Ich wollte mich heute darum kümmern.«
»Ich lasse dir freie Hand damit«, sagte ich. »Tu, was du für nötig hältst. Du brauchst dich nicht eigens mit mir abzustimmen.«
Wenn er erstaunt war, zeigte er es nicht.
»Vielen Dank«, sagte er.
Ich nickte. Es war keine großartige Aufgabe, und er wußte es ebensogut wie ich. Was zählte, war die Geste dahinter.
»Euer Gesicht sieht schlimm aus«, befand er. »Was werdet Ihr unternehmen wegen der Kerle, die Euch angegriffen haben?«
»Ich muß mit dem Stadtkämmerer darüber sprechen«, erwiderte ich vorsichtig. »Ich denke, daß man sie mittlerweile verhört hat.«
»Reitet Ihr in die Stadt?«
»Sobald ich mit dem Essen fertig bin.«
Er stand auf.
»Ich lasse Euer Pferd richten«, sagte er und verschwand.
Hanns Altdorfer saß mit finsterem Gesicht in seiner Arbeitsstube im Rathaus; er begrüßte mich mit einem Kopfnicken. Im Kamin brannte ein Feuer, und es war im Vergleich zu den vergangenen Tagen relativ warm im Raum. Er trug nur ein leichtes Wams aus Leinen am Oberkörper. Um sich vor der Zugluft zu schützen, hatte er seinen Sessel mit Schaffellen verkleidet.
»Du lieber Gott, wie sieht dein Gesicht aus!« fuhr er auf.
»Wie geht es dir?« fragte ich.
Er zog mühsam mit der rechten Hand sein Wams auseinander und zeigte mir einen gut handspannenlangen Schnitt, der sich von seinem Schlüsselbein nach unten zur Brust zog. Die Wundränder waren gerötet und geschwollen, der Schnitt selbst kaum verkrustet. Die Wunde glänzte von einer Heilsalbe.
»Er hat mich doch schlimmer erwischt, als ich zuerst dachte«, sagte er. »Ich habe heute morgen einen Apotheker aufgesucht. In der Wunde war Schmutz, und die Klinge hat ein paar Stoffetzen abgerissen und tief in den Schnitt hineingedrückt. Ich mußte sie mir säubern lassen.«
»Und jetzt...«
»... tut mir die ganze linke Seite weh«, vollendete er mißmutig. »Wenn ich schwere Stoffe trage, scheuern sie, und die Wunde brennt wie die Hölle. Deshalb kann ich nur dies lächerliche Wams anziehen. Ich friere wie ein nasser Hund.«
»Trink etwas Glühwein«, sagte ich. »Mein Verwalter hat mich gestern damit ertränkt.«
Er schnaubte und wies auf einen hölzernen Becher.
»Da«, sagte er. »Leider kann ich nicht viel genug trinken, um warm zu werden. Ich muß einen klaren Kopf behalten.«
Ich hob mit einer bedauernden Geste die Arme. Er lächelte plötzlich und sagte: »Ich jammere und klage; dabei kann ich wohl froh sein, daß ich nicht tot bin.«
Ich ließ mich schwer auf eine Bank fallen und nickte. Er starrte ins Feuer und rieb sich geistesabwesend mit der rechten Hand über die schmerzende Stelle.
»Hanns«, sagte ich nach längerem Schweigen, »die Kerle hatten es auf mich abgesehen. Du warst nur ein zufälliges Opfer.«
»Wenn das eine Entschuldigung werden soll«, sagte er und hob den Kopf, »dann denk daran, daß ich dich gebeten habe, mich zu begleiten. Und daß dies alles nicht passiert wäre, wenn ich dich nicht in diese Geschichte hineingezogen hätte.«
Ich nickte langsam.
»Ich bin froh, daß dir nichts geschehen ist«, sagte ich. Er gab meinen Blick zurück und zog die Augenbrauen hoch, ohne mir zu antworten.
»Das Glück an der ganzen Sache ist, daß wir jetzt Gefangene haben«, sagte ich. »Wir müssen die Kerle schnellstens verhören lassen.«
»Richter Girigel kümmert sich bereits darum.«
»Tatsächlich?« sagte ich verblüfft. »Ich dachte, er sei in Burghausen?«
»Ich habe ihn gestern abend noch benachrichtigen lassen; mit einer seiner Brieftauben. Vor ein paar Minuten fand sich seine Antwort an einer anderen Taube in seinem Taubenschlag.«
»Was hat er geschrieben?«
»Er sei sehr betroffen und bedauere den Vorfall. Er habe bereits Anweisungen gegeben, einen seiner Vertrauten nach Landshut zu schicken und mit der Befragung zu beginnen.«
»Ich hoffe, er hält uns auf dem laufenden.«
»Bestimmt. Ich habe ihm ein schlechtes Gewissen eingeredet.«
»Ein schlechtes Gewissen? Was hätte er schon tun können, wenn er in Landshut gewesen wäre?«
»Das meine ich nicht«, sagte er und lächelte. »Ich habe ihm im Scherz geschrieben, er solle sich für seine Landsleute schämen. Wir konnten wenigstens erfahren, daß die Leute, die uns überfallen haben, aus Ingolstadt stammen. Der Richter auch.«
Ich mußte plötzlich ebenfalls lächeln und schüttelte den Kopf. »Als die Kerle mich am Sonntag abend ansprachen«, sagte ich, »bemerkte ich ihren Dialekt. Er kam mir bekannt vor; ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, weshalb. Natürlich; sie sprachen wie der Richter.«
»Mir ist noch etwas anderes aufgefallen.« Altdorf er wurde wieder ernst. »Kommst du nicht darauf?«
»Bezüglich Ingolstadt?«
Er nickte. »Du weißt, welche unguten Erinnerungen Landshut und Ingolstadt verbinden«, sagte er.
»Der Krieg zwischen Herzog Ludwig dem Bärtigen von Ingolstadt und seinem Sohn! Hat nicht Herzog Heinrich damals den Sohn unterstützt?« rief ich.
»So ist es«, knurrte Altdorfer. »Ludwigs des Bärtigen Sohn, den sie Ludwig den Höckrigen nannten; in Frankreich geboren, von seiner Mutter zu Fuß bis nach Ingolstadt getragen und durch den langen Transport in der Kraxe für sein Leben verkrüppelt.«
Ich konnte mich an den Konflikt erinnern, der ursprünglich durch die ungerechte Aufteilung des Herzogtums Straubing an die damaligen drei Witteisbacher Herzöge ausgelöst worden war; ich war zu jener Zeit ein Lehrling in den Diensten eines Augsburger Kaufherrn gewesen, und ich wußte noch gut, daß er nach dem Ende der Auseinandersetzungen, die nicht nur Ludwig den Bärtigen und seinen Sohn, sondern über Jahrzehnte hinweg alle drei Witteisbacher Linien Landshut, München und Ingolstadt beschäftigt hatte, zu mir sagte: Gott sei Dank hat Heinrich von Landshut jetzt die größte Macht in Bayern; seine Führung macht das Land, das ihm gehört, für einen Kaufmann zu einem Rosengarten.
»Wenn ich mich recht entsinne, hat sich Ludwig der Höckrige gegen die Verachtung, die ihm sein Vater entgegenbrachte, und gegen die geplante Enterbung aufgelehnt und ihn – ich weiß nicht mehr, wann – gefangengenommen«, sagte ich.
»Richtig«, erwiderte Altdorfer. »Danach hat er zwei Jahre regiert, bevor er ebenfalls verstarb. Sein Vater wurde an Herzog Heinrich ausgeliefert und starb vier Jahre nach seiner Gefangennahme im Kerker von Burghausen, von der Welt verachtet und von Gott und der Kirche verlassen. Die Länder der Ingolstädter aber fielen Herzog Heinrich zu, als sich ihm deren Landstände unterwarfen.«
»Gegen den Willen der Münchner Herzöge«, sagte ich grimmig, »und gegen den Willen der unehelichen Söhne von Ludwig dem Bärtigen. Du nimmst an, daß noch immer Ressentiments aus jener Zeit gegen Landshut vorherrschen und König Matthias von Ungarn sich einiger rachsüchtiger Querköpfe bedient, um seine Ziele zu erreichen.«
»Es ist nur eine Vermutung«, erklärte er. »Da Herzog Heinrich von Landshut schon bald nach Ludwig dem Bärtigen starb, konnte man an ihm keine Vergeltung mehr üben. Heinrichs Sohn Ludwig der Reiche war aber bis auf die Zeit, während der er mit Albrecht Achilles die Klingen kreuzte, niemals so verwundbar wie sein jähzorniger Vater. Vielleicht haben sie erst jetzt eine Möglichkeit gesehen, sich zu rächen.«
»Es hat nur einen Haken«, sagte ich. »Das Ganze ist vor dreißig Jahren passiert.«
»Warum? Haß ist eine Flamme, die lange brennt.«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Im Moment ist es noch nicht einmal von großem Belang«, sagte ich. »Wir müssen warten, bis der Beauftragte des Richters eintrifft.«
»Was wirst du in der Zwischenzeit unternehmen?«
»Ich statte dem Haus des Dietrich Reckel einen Besuch ab«, antwortete ich grimmig.
Er wäre beinahe aufgesprungen; im letzten Moment hielt ihn seine schmerzende Seite davon ab. Mit verzerrtem Gesicht sank er wieder in seinen Sessel zurück.
»Bist du verrückt geworden?« rief er. »Du begibst dich in die Höhle des Löwen. Ich bin nicht damit einverstanden. Es ist viel zu riskant. Du spazierst ihnen ja direkt ins Messer!«
»Man wollte mir zweimal ans Leder; ich habe das Gefühl, daß ich jetzt etwas unternehmen muß. Wenn unsere Vermutung falsch ist und die Überfälle nichts mit den geheimnisvollen Bewohnern des Hauses zu tun haben, droht mir vermutlich keine Gefahr«, sagte ich. »Und wenn doch: Einer der Spitzbuben ist tot, und die anderen beiden liegen in Ketten. Wie sollen sie mir noch gefährlich werden?«
Ich verschwieg, daß es mindestens drei weitere Kerle gab. Ich wollte nicht mit ihm diskutieren; ich hatte das Gefühl, daß mein Entschluß richtig war. Ich wollte es mir nicht womöglich noch ausreden lassen.
»Ich begleite dich«, rief er.
»Das kommt nicht in Frage«, sagte ich fest. Er betrachtete mich unglücklich.
»Nimm einen Wappner mit. Am besten zwei.«
»Dieses Angebot nehme ich an. Sie können das Tor aufbrechen, wenn mir niemand aufmacht.«
Er bückte sich mühsam und öffnete eine Truhe, die neben seinem Tisch stand. Ich hörte, wie er darin herumkramte. Das Klirren von Eisen war zu hören. Als er wieder auftauchte, hielt er einen massiven Schlüssel in der Hand.
»Dieser hier öffnet dir die Türen leichter«, sagte er und legte ihn auf den Tisch. »Das Schloß vor dem Tor hat die Stadt anbringen lassen.«
Ich nahm ihn und lächelte.
»Bald wissen wir mehr.«
Das Schloß, das das Tor in der Mauer abriegelte, ließ sich nur schwer bewegen; der Schlüssel kreischte und widersetzte sich anfangs allen Bemühungen, bevor er sich doch drehen ließ. Die beiden Büttel standen auf der gegenüberliegenden Seite der Gasse und behielten die Hausfassade im Auge. Ich hatte sie angewiesen, dort, gut sichtbar, auf mich zu warten. Ich hatte nicht vor, sie mit ins Haus hineinzunehmen; je weniger sie erfuhren, desto weniger konnten sie herumtratschen. Ganz abgesehen davon erwartete ich nicht, weiter als bis in den Hof zu kommen. Wenn die Bewohner des Hauses ihr Hoftor überwachten, mußte es ihnen ein leichtes sein, mich noch draußen abzufangen.
Als ich unbeschadet über den Hof bis zur Haustüre kam, die schief in den Angeln hing, wußte ich, daß das Haus leer war.
Ich spürte eine merkwürdige Mischung aus Erleichterung und Bedauern, als ich mir diesen Umstand klarmachte. Ausgeflogen, dachte ich, dir wird nichts passieren. Zugleich fragte ich mich, wie es nun weitergehen mochte.
Ich legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben.
Hier, vom Inneren des abgeschlossenen Hofes aus, machte das Haus einen noch verwahrlosteren Eindruck. Die Fenster waren hier größer, der Stuck um sie herum prunkvoller; aber die hölzernen Rahmen waren zerborsten und hingen schief in den Fensterlöchern, und das weit über die Außenmauer hinaus gezogene Dach wies so viele fehlende Schindeln auf, daß es wirkte wie der Kiefer eines Totenschädels, der aus zu vielen Zahnlücken grinst. Der Hof war größtenteils gepflastert, wie auch der sichtbare Teil des Hausganges, ein erblindetes, grobflächiges Mosaik aus Steinfliesen, die kalt und grau den Himmel widerzuspiegeln schienen. Eine Ecke war von der Pflasterung ausgespart geblieben, aber die Kräuter, die dort früher einmal gezogen worden waren, hatten sich längst in gelblichtrockenes, zerzaustes Gras verwandelt. Ich dachte: Hanns Altdorfer, du hast dieses Haus noch niemals aus dieser Position gesehen; sonst würdest du nicht mit dem Gedanken spielen, notfalls hier einige Hochzeitsgäste einzuquartieren.
Ich drückte die Tür auf. Sie schleifte über den Fliesenboden und zirkelte einen Halbkreis durch die Grassamen und verwelkenden Blätter, die der Wind hereingeweht hatte. Als ich das Laub mit dem Fuß beiseiteschob, konnte ich erkennen, daß der Halbkreis auch in den Boden geritzt war, ein heller, unregelmäßiger Strich in der altbackenen Schmutzschicht und auf den Fliesen. Die Tür war kürzlich benützt worden.
Während meiner Zeit als Assistent des Bischofs hatte ich viele leerstehende Häuser gesehen: Bauernhäuser, aus denen der Krieg die Bewohner vertrieben hatte, und Pächterhütten, bei denen eine drückende Schuldenlast das gleiche getan hatte. Einige waren planmäßig verlassen worden und nur mehr aufrecht stehende Hüllen, aus denen verbitterte Hände alles losgerissen hatten, was sich wegtragen und auf irgendeine Weise verwerten ließ. Andere standen noch voll kargem Mobiliar, mit in die Ecke geschobenen Tischen, umgefallenen Stühlen und aufgebrochenen Truhen, in denen verblassende Kleider Modergeruch in die Luft sandten. Bei manchen hatte ich ein schlechtes Gewissen verspürt, während ich für meinen Herrn eine Bestandsaufnahme machte; bei vielen war ich voll Mitleid gewesen für die einstigen Bewohner, die jetzt heimatlos waren.
Bei keinem jedoch hatte ich ein ähnliches Gefühl der Beklemmung gefühlt wie hier, während ich die breite, gerade nach oben führende Treppe hinaufstieg, die direkt hinter der Tür ins Dunkle führte. Obwohl ich sicher war, daß sich außer mir niemand im Haus befand, spürte ich, daß ich in einen Bereich eindrang, in dem ich nicht willkommen war. Ich hatte eine deutliche Erinnerung an die Gestalt, die als ein dunkler Schatten vor einer kleinen Kerze im Fenster gestanden und schweigend auf mich herabgeblickt hatte, und merkwürdigerweise erfüllte mich diese Erinnerung mit größerer Beklommenheit als diejenige an die beiden Überfälle. Ich legte die letzten Treppenstufen in völliger Finsternis zurück, mit einem Schauder, der mir mit jedem Schritt über den Rücken lief. Ich mußte den Drang bekämpfen, schnell zu laufen wie ein kleiner Junge, der aus einem finsteren Keller flüchtet, weil er den Todesschrei einer Maus gehört hat, der die Katze das Rückgrat zerbricht. Die Treppe endete an einem Absatz; zwei weitere Schritte brachten mich zu einer Wand. Ich fuhr mit den Fingerspitzen daran entlang, und noch während meine Augen sich langsam an das schlechte Licht gewöhnten und ich begann, vage Umrisse zu sehen, stießen meine Finger auf einen Türstock. Die Tür war geschlossen, aber ich fand die Klinke, ein dünnes Winkeleisen mit einem rauhen Griff, und öffnete die Tür.
Es war nicht viel heller dahinter. Ein großer Raum, vollkommen leergeräumt und mit einem Holzboden versehen, dessen Planken sich in der Feuchtigkeit an beiden Seiten aufbogen und in der Stille überlaut knarrten, sobald man sich bewegte. An einer Seite konnte ich deutlich die lichten Umrisse sehen, wo die Fenster mit Decken verhängt waren. Ich durchquerte den Raum, stolperte über die rissigen Kanten der Holzplanken und packte die Decke vor dem nächstliegenden Fenster. Sie war ohne Befestigung über eine altersschwache Vorhangstange gehängt worden: Als ich zu heftig daran zog, flatterte sie mit einem Schwall aus Modergeruch und Staub auf mich herab. Das Nachmittagslicht drang herein und blendete mich. Ich mußte für einen Moment die Augen schließen. Als ich sie wieder öffnete, sah ich durch die schmutzblinden Scheiben in die Gasse hinab. Die beiden Wappner standen gelangweilt an der Mauer des gegenüberliegenden Gebäudes, ohne mich zu bemerken. Ich wußte, daß ich in demselben Fenster stand wie der düstere Schatten, der mich von hier aus beobachtet hatte.
Ich drehte mich um und betrachtete den Raum. Im Grunde hatte ich nichts Besonderes erwartet, und er bot auch keinen besonderen Anblick. Das dürre Laub vieler Herbstfälle, das der Wind und die kriechende Zugluft bis hier herauf transportiert hatten, war in einer Ecke zusammengeschoben worden. Bestimmt ein halbes Dutzend herabgebrannter Kerzenstummel war zu sehen, kalt in den erstarrten Pfützen aus Unschlitt stehend. Ich bückte mich und löste einen davon von den Brettern: Der Docht war noch intakt, aber mehr als ein paar Minuten Licht würde sie nicht mehr geben. Man hatte sie lange brennen lassen. Was einmal als Tapete die Wände eines reichen Bürgerhauses bedeckt hatte, war verblaßt, verschimmelt und in Ecken und Kanten aufgeplatzt wie die rissige Borke eines sterbenden Baumes; von der Decke und vom Boden krochen an den Außenwänden runde, schwarze Flecken aufeinander zu wie Geschwüre. Es roch nach dem Laubhaufen in der Ecke, nach der Erinnerung an brennende Kerzen und nach nassen Backsteinwänden, und es war beinahe noch kälter in dem großen Raum als draußen im Freien.
Ich klopfte an die Fensterscheibe, bis die beiden Stadtknechte auf mich aufmerksam wurden. Ich krümmte einen Finger, und sie nickten. Der größere der beiden lehnte sich wieder an die Mauer, während der Kleinere über die Gasse schritt und durch das Hoftor verschwand. Gleich darauf hörte ich seine Schritte die Treppe heraufkommen.
»Ich bin hier«, rief ich laut, und er trat über die Schwelle und sah sich mit zusammengekniffenen Augen um.
»Könnt Ihr mir die Kerze hier anzünden?« fragte ich.
Er nickte und nahm mir den Stummel ab. In seinem Lederbeutel fanden sich Feuersteine und eine Lunte, und er schlug fachmännisch ein paar Funken in sie hinein, bis sie genügend glomm, um den Kerzendocht damit zu entzünden. Er hielt die Kerze hoch und betrachtete sie prüfend.
»Die macht es nicht mehr lange«, sagte er.
»Wir brauchen sie nur kurze Zeit«, erwiderte ich.
Ich hob die Decke vom Boden auf und warf sie wieder über die Vorhangstange. Ich glaubte nicht, daß die Leute, die hier gehaust hatten, noch einmal zurückkehren würden, aber ich hatte das Gefühl, ich sollte wieder in Ordnung bringen, was ich gestört hatte. Zusammen verließen wir den Raum und öffneten nacheinander alle anderen Türen im Obergeschoß. Der Anblick unterschied sich in nichts von dem im großen Zimmer; nur die Kerzenstummel fehlten. In einem der Zimmer schnüffelte der Stadtknecht plötzlich und zog die Nase hoch; dann sagte er: »Hier riecht es nach Parfüm.«
Ich konnte keinen besonderen Geruch wahrnehmen und wollte seine Feststellung mit einer Handbewegung abtun, dann erinnerte ich mich an die letzte Begegnung mit Jana Dlugosz. Der Duft nach frischen Äpfeln, der mich an Sommer und lange zurückliegende, fröhliche Zeiten erinnert hatte und der ihr Parfüm gewesen war. Ich schnupperte angestrengt, aber ich hatte keine Nase dafür.
»Wonach riecht es denn?« fragte ich ihn.
Er zuckte mit den Schultern.
»Nach irgendwas. Frisches Obst«, sagte er. Ich biß die Zähne zusammen. Es gibt eine Menge frisches Obst, sagte ich mir und fragte mich im selben Moment, warum ich mir so sehr wünschte, daß er nicht den Duft von Jana Dlugosz’ Parfüm wahrgenommen hatte. Er sagte nichts mehr dazu, und ich ließ die Sache auf sich beruhen.
Das Obergeschoß hatte die Wohnräume des Hausherren beherbergt; das Erdgeschoß, zu dem wir danach hinunterstiegen, diente vermutlich der Unterkunft seines Gesindes, der Küche und der Stube. Die Fenster waren hier nicht verhängt; der Steinboden knirschte von den Splittern der eingeworfenen Fensterscheiben, und das Laub war dichter und überall verstreut. Wir fanden keine Anzeichen, daß sich jemand im Erdgeschoß aufgehalten hatte. Ich seufzte und sah auf den Unschlittstumpen nieder, den ich in der Hand hatte. Mit der Durchsuchung des Hauses hatte ich nur das Eingeständnis verzögert, daß ich für den Augenblick nicht mehr weiterwußte.
»Gehen wir«, sagte ich.
»Wollt Ihr den Keller nicht untersuchen?« fragte der Wappner. Ich sah ihn überrascht an.
»Den Keller?«
»In der hinteren Ecke des Hofes habe ich eine niedrige Tür gesehen. Ich schätze, daß sie in einen Vorratskeller hinabführt.«
»Zeigt sie mir.«
Er trat vor mir ins Freie hinaus, und ich zog mit dem gleichen Gefühl, das mich oben genötigt hatte, die Decke wieder an ihren Platz zu hängen, die Tür hinter uns zu. Ich folgte ihm zu der bezeichneten Stelle: Wie ein niedriger Buckel erhob sich ein moosbewachsener Ziegelhaufen in der Hofecke, an einer Seite mit einer Tür versehen, die massiv wirkte und so klein war, daß man sich tief bücken mußte, um hindurch zu gelangen. Der Riegel steckte in der Öse, und in der Öse hing ein verrostetes Schloß. Der Bügel stand offen. Es war zu schwer, sonst wäre es im leichten Wind hin und her gebaumelt.
Ich streckte die Hand aus und zog das Schloß herunter. Der Wappner packte den Riegel und öffnete die Tür.
Was hatte ich erwartet? Eine weitere zerschundene Leiche? Weil ich bereits eine Leiche in einer ähnlichen Gruft erblickt hatte? Oder den dunklen Schatten im Fenster, jetzt zusammengekauert hinter der Tür, die eher ein Verschlag war, mit funkelnden Augen ins Licht starrend? Ich spürte eine plötzliche, unselige Erregung, als der Stadtknecht die Klappe öffnete, und ich zuckte beinahe zurück, als mir der dumpfe Erdgeruch eines unbelüfteten Kellers ins Gesicht schlug.
Der Stadtknecht streckte den Kopf in die Öffnung. Ich hielt den Atem an. Nach einem Moment sagte er: »Könnt Ihr mit der Kerze einmal hereinleuchten?«
Ich gab ihm den kleinen Stummel, und er kroch halb in die Kelleröffnung hinein und spähte herum.
»Nichts zu sehen«, sagte er. Seine Stimme klang hohl ins Freie. »Wollt Ihr selbst einmal nachsehen?«
Er rappelte sich umständlich hoch und machte mir Platz. Ich nahm ihm die Kerze ab. Ihr Licht bewirkte nicht viel: Ich sah ein paar Stufen aus Backsteinen, die nach unten führten, und einen kleinen Raum, dessen Decke kaum hoch genug war, um darin aufrecht stehen zu können. Der Boden bestand aus unebener, schlecht gestampfter Erde, aus der die hellen Punkte der Flußkiesel leuchteten. Am liebsten hätte ich über das Gefühl gelacht, das mich beim Öffnen des Kellers befallen hatte.
Ich kam wieder ins Freie und sagte: »Nichts Neues. Machen wir die Tür wieder zu und verschwinden wir.«
Er schob den Riegel in die Öse und hängte das Schloß ein, dann sah er mich nachdenklich an. Ich konnte beinahe erkennen, wie er die Frage zurückdrängte, wonach ich eigentlich gesucht hatte.
»Ob dies hier einmal als Familiengruft geplant gewesen war?« fragte er schließlich.
»Ich kenne das Haus nicht besser als Ihr«, sagte ich erstaunt. »Weshalb fragt Ihr?«
»Wo ich lebe, bin ich Maurergeselle«, erwiderte er. »Wir haben schon mehrmals Grüften ausgebaut oder ausgebessert. Der Anblick dieses Lochs hier hat mich daran erinnert.«
»Inwiefern?«
»Wißt Ihr, manchmal muß der Totengräber die früher vergrabenen Särge wieder ausgraben, um sie anders zu legen und Platz zu schaffen für die Neuankömmlinge. In der Regel gräbt er dazu den Boden einmal um, damit die verstreuten Überreste eines früher Begrabenen aufgesammelt und neu bestattet werden können. Der Boden – sieht danach genauso aus wie der dort unten.«
Ich starrte ihn an.
»Mich wundert nur«, fuhr er fort, »wie man dort eine Gruft anlegen konnte. Draußen fließt doch gleich der Fluß vorbei. Der Teufel soll mich holen, wenn man tief genug graben kann, um Platz für einen Sarg zu haben, ohne daß man auf das Grundwasser stößt.«
Es gab ein weiteres flußseitig gelegenes Wohngebäude in diesem Teil der Gasse; ein Lagerhaus und ein alter, offensichtlich aufgegebener Schuppen befanden sich zwischen ihm und dem Haus des Dietrich Reckel. Ich hatte es niemals beachtet und auch keinen Gedanken daran verschwendet, ob es bewohnt war oder leerstand. Jetzt allerdings, als wir daran vorbeimarschierten, sah ich eine kleine Gruppe vor der offenen Tür stehen und neugierig zu uns herüberspähen. Es waren drei Menschen, ein sehr alter Mann und zwei Frauen, und als wir auf gleicher Höhe mit ihnen waren, sprach mich der alte Mann an.
»Ist etwas nicht in Ordnung?« fragte er. Er hatte eine helle, rauhe Greisenstimme, die nicht recht zu seinem schweren Körperbau passen mochte und die man dennoch recht oft an massigen Menschen hört. Er sprach die hiesige Ausfärbung der bayrischen Sprache, aber es klang bemüht, als wäre er lange weg gewesen und könne sich nur noch mit Mühe wieder darein finden.
»Wie kommt Ihr darauf?« fragte ich vorsichtig zurück. Ich warf einen raschen Blick auf meine zwei behelmten Begleiter, aber ihre Gesichter waren ausdruckslos. Sie würden nur reden, wenn sie etwas gefragt wurden.
»Ihr wart doch drüben in dem leerstehenden Haus, nicht wahr?«
»Und wenn?«
Er lachte plötzlich.
»Entschuldigt«, sagte er. »Ich vergesse die einfachsten Formen der Höflichkeit. Mein Name ist Leutgeb; ich wohne hier mit meiner Familie.«
Die beiden Frauen nickten mir zu, und ich reichte ihm die Hand.
»Peter Bernward von Säldental«, sagte ich.
»Ich freue mich«, sagte er. »Bitte verzeiht meine Aufdringlichkeit, aber das Haus dort drüben steht schon seit Jahrzehnten leer, und wenn jemand sich plötzlich dafür interessiert, wird man neugierig.« Ich sah ihn einen Moment lang schweigend an, während ich mir meine Antwort überlegte. Er wirkte alt genug, um den Schatten des Sensenmannes schon an seinen Fersen zu spüren, aber seine Augen waren wach und musterten mich mit einem unangenehm stechenden Blick. Es konnte an der wasserblauen Farbe seiner Iris liegen, oder daran, daß er kurzsichtig war und die Augen zusammenkneifen mußte, um mich sehen zu können. Er war sehr groß, fast eine Handspanne größer als ich; womöglich machte es mich auch nur nervös, zu ihm aufschauen zu müssen, ich, der ich es gewohnt war, fast alle anderen wenn schon nicht an Größe, dann wenigstens an Bulligkeit zu überragen.
Oder lag es an der überlegten Art, in der er seine Worte setzte, und an seinem Lächeln, das seine Augen nicht zu erreichen schien? Er seufzte und sah die Gasse hinauf und hinab.
»Wißt Ihr«, sagte er, und es klang leichthin, »es ist mir immer wieder ein Greuel, wenn ich daran denke, wie es dasteht und verfällt. Was könnte man daraus machen! Es ist ein schönes Haus, und es ist eine Schande, daß es der Witterung so preisgegeben wird. Ich war längere Zeit auf Reisen und bin erst vor wenigen Tagen wieder zurückgekommen, um die Hochzeit des jungen Prinzen zu erleben. Die ganze Zeit über habe ich nicht daran gedacht, wie es sozusagen in meiner Nachbarschaft verfault; als ich heimkam, habe ich jedoch wieder angefangen, mich darüber zu ärgern.«
»Warum kauft Ihr es nicht?« fragte ich spontan. Er hob eine Hand und winkte abwehrend.
»Nein, nein, ein Haus reicht völlig aus für mich und meine Familie.« Einer der Wappner gähnte unterdrückt und stieg von einem Fuß auf den anderen. Ich nahm den willkommenen Anlaß und sagte: »Ich glaube, wir müssen weiter. Wir haben noch einiges vor.«
»Soll es abgerissen werden?« fragte er und deutete auf das alte Haus. Er war hartnäckig wie eine Filzlaus.
»Nein«, sagte ich widerwillig. »Wir haben es uns nur angesehen.«
»Wollt Ihr es kaufen?«
»Ebensowenig wie Ihr.«
»So. Ich dachte schon, Ihr seid vielleicht ein Kaufmann, der für einen Kunden auf der Suche nach einem Wohnhaus ist.«
»Wie kommt Ihr denn darauf?«
»Warum solltet Ihr wohl sonst ein leerstehendes Haus ansehen?« fragte er, und ich hatte für einen erschreckenden Moment das Gefühl, daß das Lächeln sein Gesicht verlassen hatte und mühsam beherrschte Wut in seinen Zügen zu lesen war. Er hob die Augenbrauen, und in einer komischen Pantomime hoben sich seine Schultern mit, und das Lächeln legte seine Züge wieder in viele Falten.
»Wenn Ihr es unbedingt wissen müßt«, sagte ich angespannt, »ich arbeite für den Stadtkämmerer, der nach freistehenden Unterkünften für die Unterbringung der Hochzeitsgäste sucht.« Ich vermied es angestrengt, mich nach den beiden Stadtknechten umzublicken. Was würden ihre Gesichter zeigen? Aber sie machten keine Bewegung, die etwa verraten hätte, daß diese Aussage sie überraschte. Ich übersah jedoch nicht, daß der alte Mann einen schnellen Blick zu meinen Begleitern hinüberwarf, wie um gerade eine solche Reaktion abzuschätzen.
»Jetzt habe ich Euch verärgert«, sagte er und schob die Lippen vor wie ein gescholtenes Kind. »Verzeiht mir.«
»Schon gut«, erwiderte ich. »Wir müssen nun los. Gott behüte Euch.«
Er verzog einen Mundwinkel, bis ein saugendes Geräusch zu hören war, und legte die Stirn in Falten. Er machte den Eindruck, als versuchte er mir etwas mitzuteilen, was nicht recht heraus wollte.
»Ich habe Euch vorhin angelogen«, murmelte er schließlich. »Tatsächlich würde mich das Haus schon interessieren. Aber man munkelt, daß es darin umgeht.«
»Wie bitte?«
»Geister«, sagte er dumpf. »Verlorene Seelen, die nach dem Leben dürsten. Es schaudert mich, wenn ich nur daran denke. Das ist der Grund, warum ich es nicht längst schon gekauft habe: Ich fürchte mich. Es wäre wahrscheinlich ein großes Unglück, ein verfluchtes Haus zu kaufen.«
»Ich habe noch nichts davon gehört«, sagte ich knapp.
»Und ich dachte, Ihr hättet es vielleicht deswegen untersucht. Weil man Euch erzählt hat, man hätte Stimmen gehört und Lichter gesehen.«
»Wer sollte so etwas erzählen?«
Er wies die Gasse hinab, wo ein ganzes Stück weiter unten das Haus des Sebastian Löw den Anfang der Wohngebäude machte.
»Die Nachbarn; der Apotheker, die Flößer, was weiß ich. Ich bin schon oft angesprochen worden, ob ich nicht Angst um mich und meine Familie hätte – so nahe an diesem Geisterhaus zu wohnen.«
»Ihr habt ja welche, wie Ihr selbst sagtet.«
Er lächelte wieder und drohte beinahe scherzhaft mit dem Finger.
»Hier nicht«, sagte er. »Hier nicht. Dieses Haus hier hat mein Vater erbaut, und ich habe als kleiner Junge in allen Räumen gespielt. Warum sollte ich hier Angst haben. Nein. Dort drüben – das ist etwas anderes. Dort würde ich mich ängstigen.«
»Es hat uns niemand angesprochen«, sagte ich, um die Begegnung zu beenden. »Und meinetwegen können sich die Geister dort gegenseitig auf die Zehen treten,solange sie nur genug Platz machen für die Gäste, die wir dort unterbringen möchten.«
Er lehnte sich zurück. Sein Lächeln wurde breiter
– und seine Augen noch ein wenig kälter?
und er sagte: »Nun, nichts für ungut, Herr Meinhard.«
»Bernward«, sagte ich unwillkürlich.
»Ach, entschuldigt«, sagte er und blickte mir intensiv in die Augen. »Wie konnte ich Euren Namen vergessen?«
»Macht nichts«, brummte ich. »Lebt wohl, Herr Leutgeb.«
»Lebt wohl«, antwortete er. Er blieb mit den beiden Frauen vor seiner Tür stehen, als wir weitergingen. Ich sah mich nicht mehr um, bis wir in die untere Gasse einbogen und aus seinem Sichtfeld verschwanden, aber ich spürte die ganze Zeit über seinen brennenden Blick in meinem Rücken, und ich wußte ganz genau: Wenn ich mich umgedreht hätte, bevor wir die Ländgasse verließen, wäre er noch immer vor der Tür seines Hauses gestanden, die Hände vor seinem Bauch gefaltet und die breiten Schultern vom Alter nach vorne gekrümmt, und seine hellen Augen hätten unter dem vorspringenden Felsmassiv seiner gefurchten Stirn hervor Blitze nach mir geschleudert.
Plötzlich wünschte ich, ich hätte besser auf seine Worte geachtet, anstatt seine Gesichtszüge zu studieren und auf das allzu perfekt wirkende Bayrisch, das er sprach. Mir schien, als hätte nicht alles, was er gesagt hatte, dem Bild entsprochen, das er hatte darstellen wollen. Ich versuchte, alle Gedanken aus meinem Kopf zu verbannen, um den Wortlaut seiner Rede wieder zu erinnern, aber es war vergeblich. Sie war an mein Ohr, aber nicht an mein Gehirn gedrungen. Ich gab es auf.
Vielleicht hatte es mich nur befremdet, daß er scheinbar keine Notiz von meinem in allen Farben prangenden Gesicht genommen hatte.
Ich suchte zur vereinbarten Stunde meinen Spitzel, den Flößer, auf. Wenn die Bewohner das Haus irgendwann seit gestern nachmittag aufgegeben hatten, mußte er es bemerkt haben. Aber er hatte niemanden gesehen, der es verließ, und niemanden, der hineingegangen war. Wohin waren die Leute verschwunden?
»Da Ihr mich fragt, nehme ich an, daß Eure Tochter nicht zu Hause ist«, sagte er, und ich starrte ihn einen Augenblick völlig verwirrt an und hatte keine Ahnung, wovon er sprach.
»Entschuldigt«, sagte er, als er meine Verwirrung bemerkte. »Ich habe mir sagen lassen, daß sich in dem alten Gebäude wohl manchmal Liebespaare treffen, und da Ihr nicht sagen wolltet, weswegen Ihr einen Wächter vor dem Haus braucht, habe ich mir selbst Gedanken gemacht. Ich nehme also an, es handelt sich um Eure Tochter.«
»Nein«, stieß ich heftig hervor, noch immer zu überrascht, um klar zu denken.
»Das tut mir leid«, sagte er und zögerte dann einen winzigen Augenblick. »Etwa Eure Frau?«
Ich glotzte ihn entgeistert an; ich machte den Mund auf, ohne ein Wort hervorzubringen. Plötzlich wurde er rot und schlug die Augen nieder.
»Ich bin ein alter Mann«, erklärte er. »Ich bin es gewohnt, ehrlich zu sein. Ich wollte Euch jedoch nicht verletzen.« Er wischte sich mit dem Ärmel über die Nase und sah mir dann wieder in die Augen. »Wie auch immer, ich muß wissen, woran ich bin. Wißt Ihr, ich glaube nicht, daß ich zu Eurer Zufriedenheit arbeiten kann, wenn ich keine Ahnung davon habe, was eigentlich vorgeht.«
Ich mußte dem alten Flößer etwas antworten.
»Es ist mein Mündel«, sagte ich widerwillig und wußte nicht, wie ich darauf gekommen war. Vielleicht wollte ich nicht, daß meine Töchter oder meine verstorbene Frau in diese Angelegenheit gezogen wurden; obwohl keine davon noch in meiner Nähe weilte.
»Wie sieht sie aus?« fragte er.
Ich griff mir an die Stirn und brachte eine Beschreibung zusammen, von der ich hoffte, daß sie auf niemanden zutraf.
Er nickte.
»Ich werde aufpassen. Verlaßt Euch auf mich. Und ich hoffe, daß Euer Gesicht bald verheilt. Seid Ihr gestürzt?«
Ich verließ ihn, noch immer verwirrt. Es machte mir beinahe Mühe, die Gedanken an den alten Mann beiseite zu schieben, aber ich hatte an Wichtigeres zu denken. Er würde auf das Haus aufpassen, das war alles, was zählte. Trotzdem war ich wütend, auf ihn und auch auf mich selbst, und aus keinem anderen Grund als dem, daß sowohl seine Neugier als auch seine Offenheit mich vollkommen überrascht hatten.
Und ich war wütend darauf, wie sich die Dinge entwickelt hatten. Ich war mir sicher, daß das alte Haus und seine geheimnisvollen Insassen den Schlüssel zu dem Mord besaßen; aber wie es schien, waren sie mir davongeflogen wie eine Fliege, die man erwischt zu haben, deren Summen in der Faust man zu hören glaubt, und wenn man die Faust öffnet, stellt man fest, daß sie die ganze Zeit über leer war.
Als ich an Sebastian Löws Haus vorüberkam, blieb ich aus einem Einfall heraus stehen und öffnete die Tür. Ich klopfte an sein Apothekerzimmer. Er öffnete selbst die Tür.
»Herr Bernward«, sagte er. »Ich freue mich über Euren Besuch.«
Dann musterte er mich eingehend. Seine Miene verdüsterte sich.
»Was ist Euch denn zugestoßen?« fragte er und wies auf meine zerschundene Wange.
Ich dachte an die Frage des Flößers. »Ich bin vom Pferd gefallen«, log ich.
Er grinste plötzlich fröhlich.
»Habt Ihr einen Geschäftsabschluß zu sehr gefeiert?«
»So etwas Ähnliches«, sagte ich. »Wollt Ihr vielleicht versuchen, mir eine Salbe dafür zu verkaufen?«
»Ich werde Euch im Gegenteil etwas zu trinken anbieten«, sagte er und zog mich am Ärmel in sein duftendes Reich. »Was haltet Ihr von einem gut abgelagerten Birnenschnaps?«
»Ich will Euch keine Umstände machen«, wehrte ich ab.
»Ach was. Das ist eine Medizin. Danach werdet Ihr Euch drei Tage lang an mich erinnern, zumindest jedesmal, wenn Ihr auf den Abtritt rennen müßt.«
Ich sah ihn bestürzt an, und sein Gesicht verzog sich zu einer komischen Grimasse aus Heiterkeit und Bedauern.
»Ein Scherz«, sagte er hastig. »Wirklich nur ein Scherz. Entschuldigt.«
»Ich muß mich entschuldigen. Ich bin ein wenig schwerfällig. Ich denke über etwas nach.«
»Etwas, wobei ich Euch helfen kann?« fragte er gespannt. Er reckte sich, bis er in ein höher gelegenes Fach in einem seiner Regale fassen konnte; seine Hand kam mit einer dunklen Flasche wieder zum Vorschein.
Ich nickte.
»Was sagt Euch der Name Leutgeb?« fragte ich. Er mußte nicht lange überlegen.
»Das Haus weiter oben zwischen den Stadeln gehört der Familie von Wolf gang Leutgeb. Sie bewohnt es schon seit drei Generationen.«
In einem anderen Fach fand er zwei Gläser, die er mit dem Jackenärmel putzte. Er hielt sie gegen das spärliche Licht, das durch das Fenster fiel, und war mit ihrem Aussehen zufrieden. Aus der Flasche schenkte er eine hell goldfarbene Flüssigkeit in die Gläser und reichte mir eines.
»Auf Euer Wohl«, sagte er.
Wir tranken. Er hatte wirklich nur einen Scherz gemacht, als er mir die Folgen des Genusses eines von ihm gebrauten Schnapses beschrieben hatte. Der Alkohol lief samten und ölig meine Kehle hinunter und hinterließ einen angenehmen scharfen Geschmack nach gärenden Birnen, als wäre ein Sonnentag darin eingefangen.
»Ich bin dem alten Leutgeb begegnet«, erzählte ich. »Er machte einen merkwürdigen Eindruck auf mich.«
»Das würde mich nicht wundern«, erwiderte er, und ich konnte erkennen, daß er ein Grinsen unterdrückte. »Wenn er nicht schläft oder den Stadtrat mit seinen Nörgeleien belästigt, hängt er am Schnapsfaß. Prosit.«
Er trank den Rest seines Glases leer und schenkte sich und mir nach, bevor ich es verhindern konnte. Dann verkorkte er die Flasche und stellte sie wieder beiseite, als wollte er eine weitere Versuchung verhindern.
»Ich hatte nicht das Gefühl, einen Säufer vor mir zu haben.«
»Tatsächlich? Ich dachte immer, man sähe es ihm im Dunkeln an. Aber vielleicht habe ich als Apotheker einen Blick für solche Dinge.«
»Weswegen trinkt er? Wißt Ihr es?«
Er hob die Schultern und sah einen Augenblick ins Leere.
»Es gibt viele Gründe, die einen Mann dem Schnaps zutreiben«, sagte er. »Und was für den einen ausreichend erscheint, wäre für den anderen lächerlich. Ich nehme an, daß das Unglück seiner Sippe auf ihm lastet.«
»Welches Unglück denn?«
Er blickte mich an und lächelte schwach.
»Christian Leutgeb war einer der Rädelsführer des Bürgeraufstands vor sechzig Jahren. Er war der Bruder von Wolf gang Leutgebs Großvater. Der Herzog ließ damals sein ganzes Hab und Gut pfänden, seine Familie vertreiben; er selbst wurde verstümmelt und hingerichtet. Etliche Jahre danach hat man sein Haus der Familie seines Bruders zurückgegeben. Dieser hat den Namen Leutgeb wieder zu einem geachteten Begriff in der Stadt Landshut gemacht; aber er hat niemals auch nur versucht, die vertriebenen Überreste von seines Bruders Familie zu finden und zu unterstützen. Er hat sie gnadenlos verkommen lassen, wo immer sie sich auch hingeflüchtet haben mögen. Dieser Makel hat schon an Wolf gangs Vater gezehrt, der ein stiller, nachdenklicher Mensch gewesen ist, und seinen Sohn scheint er vollends aufzufressen. Es ist schon erstaunlich, daß sich immer diejenigen ein schlechtes Gewissen machen, die gar nichts dafür können.«
»Ihr habt mir geholfen«, sagte ich und stürzte den zweiten Schnaps hinunter. Ich drückte ihm das leere Glas in die Hand. »Ich danke Euch. Auch für Eure Gastfreundschaft. «
»Jederzeit wieder«, sagte er mit einem Achselzucken.
Ich verließ sein Haus; aber anstatt in die Altstadt zurückzukehren, begab ich mich wieder in die Ländgasse. Mein Herz begann lauter zu schlagen, als ich den Weg zu Reckeis altem Haus einschlug. Wie immer befanden sich kaum Menschen in der Gasse; der aufgeweichte Boden vertrieb die meisten Passanten in die gepflasterte Altstadt. Ich ging langsam an den beiden Häusern vorbei: zuerst an der intakten Fassade des Wolf gang Leutgeb, dann an den blinden Fensterscheiben im Haus des Dietrich Reckel. Mein Gefühl sagte mir, daß es noch immer genauso leer war wie vorhin, aber ich konnte mich nicht dazu bringen, davor anzuhalten. Es stand leer, doch ich hatte den dumpfen Verdacht, daß sich irgendwo jemand verbarg und mich scharf beobachtete. Sie mochten untergetaucht sein; verschwunden waren sie nicht.
Ich erstattete Hanns Altdorfer Bericht. Während ich ihm von dem leeren Haus und meiner beunruhigenden Begegnung mit dem alten Leutgeb erzählte, kam mir der Gedanke, daß es geraten sein mochte, auch Albert Moniwid von den bisherigen Ereignissen zu berichten. Aber dann dachte ich daran, wie er voller Spott darüber herziehen würde, daß man uns überfallen hatte. Ich konnte dieses Erlebnis aus meinem Bericht herauslassen; aber dann wäre es ein kläglicher Rest gewesen, den ich zu erzählen gehabt hätte, und Moniwid hätte vermutlich einmal mehr den Verdacht gehegt, daß wir in der Angelegenheit gar nichts tun wollten. Es gab keine greifbaren Ergebnisse, und all die halben Ahnungen und Vermutungen würden ihn weder beruhigen noch von unserer Kompetenz überzeugen. Die Gefahr, daß es ihm zu dumm würde und er einfach mit erhobenem Finger zu seinem König liefe, ohne sich um unsere Abmachung zu kümmern, war zu hoch. Ich beschloß abzuwarten, was Richter Girigel aus den beiden Festgenommenen herausholen würde.
Der Beauftragte des Richters tauchte an diesem Tag nicht mehr auf. Als es bereits kurz vor der Dämmerung war und ich zum Aufbruch drängte, schickte Hanns Altdorfer einen seiner Schreiber zum Gericht; aber dieser kam mit der lapidaren Botschaft zurück, es sei niemand aus Burghausen dort eingetroffen. Ich verabschiedete mich von dem Stadtkämmerer, dem ich den halben Tag Gesellschaft geleistet und der dafür sein karges Mahl aus Brot und Milch mit mir geteilt hatte, und ritt nach Hause.
Der Verwalter wartete zu Hause auf mich.
»Die Seidenstoffe sind eingetroffen!« rief er mir entgegen, als ich die Stube betrat und das Geschnatter des Gesindes leiser wurde.
»Wann?« fragte ich überrascht.
»Heute im Laufe des Tages. Ich habe sie einlagern und sofort mit den Näharbeiten beginnen lassen.«
»Sehr gut«, sagte ich. »Was ist mit der Bezahlung?«
»Herr Walther vom Feld hat Euren Anteil persönlich hierher begleitet. Er wartete eine Weile auf Euch, weil er noch mit Euch sprechen wollte. Ich habe ihm gesagt, daß Ihr Euch in den nächsten Tagen mit ihm in Verbindung setzen würdet.«
»Hat er dir Schwierigkeiten gemacht?«
»Nein, es gab keine Probleme. Ich habe die Lieferung entgegengenommen, zwei der Näherinnen holen lassen, während ich ihm einen Schluck Wein anbot, und dann die Ballen vor seinen Augen mit den beiden Frauen geprüft. Zuletzt habe ich ihm einen Schuldschein über den Wert der Lieferung mit Eurem Siegel abgestempelt.«
»Ich hätte es nicht besser machen können«, entfuhr es mir beinahe gegen meinen Willen. Er lächelte geschmeichelt.
»Ich bemerkte, daß wir durch die späte Anlieferung erhöhte Kosten hätten, an denen er sich sicherlich durch einen Nachlaß beteiligen wolle«, fuhr er betont beiläufig fort. »Er antwortete, daß er dafür den Jörg Tannberger zu sich genommen hätte, und ich sagte, Tannberger habe uns schon mitgeteilt, welch wertvolle Dienste er für den Herrn vom Feld geleistet habe. Daraufhin wurde er zuerst ärgerlich.«
»Und dann?«
»Dann lachte er und sagte: ’Wie der Herr, so das G’scherr.’«
Ich schwieg einen Moment lang, verblüfft, wie elegant er sich mit dem holländischen Kaufmann geschlagen hatte.
Er legte das Schweigen falsch aus, denn er fügte hastig an: »Ich dachte, es wäre in Eurem Sinn. Dadurch könnt Ihr mit ihm über ein paar Prozente verhandeln.«
Ich zwang mir ein Lächeln auf die Lippen. Ich war nicht ärgerlich auf ihn, nur zu sehr erstaunt. Ich hatte ihm diese Beweglichkeit nicht zugetraut. Schließlich streckte ich eine Hand aus, und er schlug zögernd ein.
»Die Bemerkung des Holländers betrachte ich als Kompliment«, sagte ich. »Für mich.«
Er errötete. Ich hatte ihn noch nie erröten sehen. Ich hatte ihn auch noch niemals derartig gelobt. Als ich mich umsah, bemerkte ich, daß das ganze Gesinde mit großen Augen auf unsere verschränkten Hände blickte, und ich drückte noch einmal demonstrativ zu und klopfte ihm mit der anderen Hand auf die Schulter.
»Wie wäre es, wenn du die Verhandlungen mit dem Holländer zu Ende führtest?«
Er zögerte nicht zuzugreifen. In den ganzen Jahren hatte ich ihn kaum jemals wirklich Verantwortung übernehmen lassen.
»Natürlich; ich werde Euch nicht enttäuschen, Herr«, versicherte er rasch.
Er stand auf und gab dem Gesinde ein Zeichen, und sie wünschten mir eine gute Nacht und verließen die Stube. Zwei ältere Frauen blieben zurück und räumten das Geschirr ab. Der Verwalter griff mit zu und folgte ihnen hinaus, während ich allein in der Stube zurückblieb und überlegte, ob ich mich nicht doch selbst mit den Verhandlungen hätte beschäftigen sollen und mich gleichzeitig fragte, warum es mir immer so schwerfiel, Vertrauen zu meinen Angestellten zu haben. Oder zu sonst jemandem.
Am folgenden Morgen hatte ich die Einkaufsverhandlungen mit dem holländischen Kaufmann wieder verdrängt. Ich fand langsam in meine alte Gewohnheit zurück, mit dem Essen am Morgen zu warten, bis das Gesinde die Stube verlassen hatte; so betrat ich den Raum, als sie gerade nach draußen drängten. Als ich im Bett gelegen hatte, war ihre Unterhaltung bis in meine Schlafstube herüber gedrungen: Sie klang deutlich ungezwungener als während der letzten Tage, in denen ich mich zu ihnen gesellt hatte. Vermutlich waren sie dankbar, daß ich sie wieder in Frieden ließ. Sie grüßten mich höflich, und ich trat beiseite; sie schoben sich aus der Tür und verschwanden in den verschiedenen Stuben und Kammern im Haus, um nach ihren Schuhen und ihren Werkzeugen zu suchen. Ich setzte mich und grübelte darüber nach, wie ich weiter vorgehen sollte. Seit dem zweiten Überfall schleppte ich den Gedanken mit mir herum, dem Kanzler einen Boten zu senden und ihn davon zu überzeugen, die Hochzeit nochmals zu verschieben, um nicht das Leben des Kaisers zu gefährden. Ich war mir sicher, daß auch Hanns Altdorfer daran dachte und nur wartete, bis ich diesen Vorschlag aussprach. Aber es war ein gewaltiger Schritt, und noch schien es mir zu früh, ihn zu tun. Offensichtlich teilte Richter Girigel meine Meinung, sonst hätte er in seinem Antwortschreiben auf Altdorfers eilige Botschaft selbst einen derartigen Vorschlag gemacht. Es sah so aus, als läge die Angelegenheit weiterhin in meiner Hand. Ich wußte nicht, ob ich darüber froh sein sollte.
Ich hörte das Gesinde draußen mit ihren Holzschuhen poltern und ihre gedämpften Stimmen. Plötzlich wurde das Gemurmel lauter. Sie riefen durcheinander, als wäre jemand eingetroffen, mit dessen Erscheinen sie keinesfalls gerechnet hatten. Ich dachte: Tannberger ist wieder zurück; aber es war nicht möglich, daß die Flöße schon in Landshut angekommen waren. Dann dachte ich: Er ist ohne die Flöße zurückgekommen; er hat seine Aufgabe nicht bewältigt. Ich zuckte zusammen, als jemand ungestüm die Tür aufriß, doch der Ankömmling war nicht Jörg Tannberger, sondern Daniel, mein Sohn. Er stand mit verlegenem Lächeln auf der Schwelle.
Ich fuhr voller Verblüffung auf und stieß an den Tisch; mein halbvoller Becher mit Milch geriet ins Schwanken und vergoß einen großen Schluck auf die Tischplatte.
»Daniel«, rief ich überrascht.
Er deutete auf den Tisch, auf dem die Milch schwamm, und sagte fröhlich: »Ist das Schreck oder die Freude, mich wiederzusehen, Vater?«
»Die Freude, du Dummkopf«, entgegnete ich heftig. Ich stand noch immer in einer lächerlichen Pose hinter dem Tisch eingeklemmt; ich ließ mich auf die Bank zurücksinken. »Daniel«, sagte ich dann zärtlich. »Wie schön, dich zu sehen.«
Er trat an den Tisch und ließ die Tür hinter sich zufallen. Als er mir die Hand reichte, kniff er die Augen zusammen.
»Ich freue mich auch, Vater. Aber was ist mit Eurem Gesicht geschehen? Hattet Ihr einen Unfall?«
»Nichts Schlimmes«, sagte ich. »Setz dich doch.«
Er setzte sich neben mich und sah sich in der Stube um, als wäre er vor Jahren zuletzt hier gewesen. Ich betrachtete ihn und spürte plötzliche Verlegenheit. Wie in den meisten Fällen wußte ich nicht, welche Worte ich wählen sollte; bei jedem seiner Besuche fühlte ich eine anfängliche Entfremdung, die immer stärker zu werden schien und mich beklommen machte.
»Bist du hungrig?« brachte ich schließlich hervor.
Er fuhr mit einem Finger durch die Milchlache und sah mich von der Seite her an.
»Bevor Ihr alles verschüttet...«, sagte er gedehnt.
»Mehr als das gibt es nicht«, brummte ich und wies auf die weiße Pfütze. Er lachte, und ich faßte zu ihm hinüber und umarmte ihn. Er klopfte mir auf die Schulter und umarmte mich ebenso heftig.
Jedesmal, wenn wir uns sahen, schien er mir breiter und kräftiger geworden zu sein. Die Arbeit am Dom forderte seine Kräfte, und ich konnte sehen, wie zerschunden seine Hände und seine Unterarme waren. Sein Körper war mit dicken Muskelsträngen bepackt. Er war noch nie von zarter oder schlanker Statur gewesen; er ging nach mir, mit breiten Schultern, breiten Hüften und stämmigen Beinen. Anders als bei mir war an ihm noch kein überflüssiger Speck zu finden, und die Muskeln bewegten sich dicht unter seiner Haut, als er sich aus meinem Griff befreite. Er lächelte mir fröhlich ins Gesicht. Seine Züge hatte er von Maria geerbt: fein geschwungene Augenbrauen, dunkle Augen und eine gerade Nase unter einem ungebärdigen Haarschopf. Wahrscheinlich liefen ihm die Mörtelweiber und die Brotverkäuferinnen auf der Baustelle in Scharen hinterher. Er würde es nicht einmal zu schätzen wissen; er hatte diverse Liebchen gehabt, solange er noch hier im Haus gewohnt hatte, aber er war jeder einzelnen treu gewesen, und jede Trennung hatte ihn mindestens ebensosehr mitgenommen wie das jeweilige Mädchen. Ich wußte nicht einmal, ob er zur Zeit wieder ein Mädchen hatte. Ich verspürte einen Stich: Ich sah ihn viel zu selten.
»Solltet Ihr in Eurer Kammer doch noch etwas mehr finden als einen Schluck verschüttete Milch«, sagte er, »könnt Ihr Euch darauf verlassen, daß ich es vertilgen werde.«
Ich rief eine Küchenmagd herein. Sie wischte den Tisch sauber und streichelte Daniels Wange.
»Der junge Herr«, sagte sie strahlend, und Daniel lächelte ihr so schmelzend zu, daß ihre alten Bäckchen rot erglühten. Ich schüttelte den Kopf, und er schnitt mir eine Grimasse, die bedeutete: Ich kann auch nichts dafür.
Ich sah schweigend zu, wie er aß. So überraschend, wie er eben aufgetaucht war, kam er immer; er meldete sich niemals an. Ich wußte, daß er nur kam, wenn er nichts auf der Baustelle zu tun hatte oder wenn ihn das Heimweh zu arg drückte, und es tat mir doppelt weh, wenn wir bei einer dieser seltenen Gelegenheiten nach kurzer Zeit miteinander stritten. Aber es geschah beinahe zwangsläufig, daß wir auf ein Thema kamen, zu dem wir unterschiedliche Ansichten hegten, und sooft ich mir auch vorsagte, diesmal nachsichtig zu reagieren, wenn er mir eine seiner unausgegorenen Ideen präsentierte, so selten gelang es mir. Die Freude über sein Erscheinen verdunkelte sich, als ich daran dachte.
»Hast du heute am Dom nichts zu tun?« fragte ich ihn.
»Die Arbeiten wurden für einen oder zwei Tage eingestellt«, erwiderte er mit vollem Mund. »Stethaimer hat alle seine Gesellen heute nach Sonnenaufgang zusammengerufen, um es uns mitzuteilen, und bis ich es wieder meinen eigenen Gehilfen weitergesagt hatte, verging einige Zeit. Danach beschloß ich, die Gelegenheit zu nutzen und Euch zu besuchen.«
Ich nickte; vorsichtig und mit einem unguten Gefühl fragte ich: »Weshalb wird nicht gearbeitet?« Hatten sie noch etwas in der Kirche gefunden, das nicht ans Tageslicht hätte kommen sollen?
»Der Bischof von Salzburg besichtigt heute die Baustelle«, sagte Daniel mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Er ist wohl gestern oder vorgestern in der Stadt angekommen und will die Kirche sehen, in der er den jungen Herzog trauen soll.«
Ich lehnte mich erleichtert zurück.
»Und dabei kann man euch nicht gebrauchen.« Er zuckte mit den Schultern.
»Wahrscheinlich haben sie Angst, jemand könnte ihm einen Stein auf den Kopf fallen lassen; ihm und den anderen Pfaffen.«
»Wer ist denn noch außer ihm angekommen?«
»Wen Ihr Euch vorstellen könnt: der Bischof von Chiemsee, von Passau, von Freising«, er begann, sie an den Fingern aufzuzählen, »von Bamberg, von Eichstätt – habe ich einen vergessen? Richtig, den Bischof von Augsburg.«
Er blinzelte mich schelmisch an, als ich unwillkürlich zusammenzuckte. Aber Bischof Peter war schon seit Jahren tot, und sein Nachfolger wußte sowenig von mir wie ich von ihm.
»Du weißt gut Bescheid«, sagte ich.
»Was Wunder! Jeder einzelne von ihnen ist in den letzten Tagen auf der Baustelle erschienen und hat geistreiche Bemerkungen losgelassen. Stethaimer ist vor jedem von ihnen auf dem Boden gekrochen.«
Ich schnaubte; aber ich konnte der Versuchung widerstehen, ihn darauf hinzuweisen, daß das Gehabe des Baumeisters von größeren politischen Erwägungen diktiert wurde. Er schob den Teller von sich und wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. Dann klopfte er sich auf den Bauch.
»Ich platze gleich«, stöhnte er. Er wandte mir das Gesicht zu, den Kopf bequem an die Wand gelehnt, und studierte mich einen Augenblick.
»Wie geht es Euch, Vater? Ihr seht müde aus.«
»Ich hatte ein paar Schwierigkeiten in letzter Zeit.«
»Geschäftlich?«
»Unter anderem.«
Er schüttelte den Kopf.
»Warum laßt Ihr den Hof nicht einmal für eine Weile allein?«
»Brauchst du einen Handlanger?«
»Nein«, lachte er. »An ungelernten Arbeitskräften gibt es genug, seit die Stadt vor lauter Hochzeitsgästen aus den Nähten platzt. Aber Ihr könntet einmal Sabina oder Maria besuchen ...«
»Was sollen sie mit ihrem alten Vater?« sagte ich und dachte daran, wie sehr vor allem Sabina ihrer Mutter ähnelte. Ich liebte meine beiden Töchter; aber als sie aus dem Haus waren, wurde es mir plötzlich leichter ums Herz – ich hatte zu oft in freudigem Schrecken den Atem angehalten, wenn ich in Gedanken versunken auf dem Hof herumwandelte und dabei auf meine älteste Tochter stieß, wie sie mit dem Gesinde sprach oder die Tiere fütterte und Maria von der Ferne aufs Haar glich. Es war auf die Dauer anstrengend, mit der Inkarnation meiner toten Frau unter einem Dach zu leben.
»Habt Ihr von ihnen in letzter Zeit gehört?« fragte Daniel.
»Sie schreiben regelmäßig«, antwortete ich. »Sabina hat vor ein paar Wochen eine Tochter auf die Welt gebracht.«
»Und Maria?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Sie ist wohl glücklich drüben in Augsburg. Ihr Mann arbeitet jetzt als Fernkaufmann für die Hochstetter, und sie ist viel allein; aber sie schreibt, es mangele ihr an nichts.«
»Ob sie mich noch zum Onkel machen wird?«
Ich hatte die Frage geahnt. Ich haßte die Antwort darauf.
»Ich weiß es nicht, Daniel. Ich glaube, sie hat Angst davor, Kinder auf die Welt zu bringen. Du weißt, wie verstört sie war, als Mutter ...«
Er nickte, als meine Stimme leiser wurde.
»Ich werde demnächst versuchen, ihnen auch einen Brief zu schreiben. Wenngleich ich geschickter darin wäre, den Text in einen Stein zu ritzen.«
Er lächelte schief in dem Versuch, ein anderes Thema anzuschneiden. Ich seufzte und zwang mich dazu, wieder eine fröhliche Miene aufzusetzen.
»Was gibt es Neues auf der Baustelle?«
Er holte Atem; ich wußte, er war jetzt in seinem Element. Hans Stethaimer hielt große Stücke auf ihn, und einer der Gründe dafür war Daniels ungebrochene Begeisterung für das Bauwerk. Man hatte es begonnen, als mein Vater, Daniels Großvater, den er nie kennengelernt hatte, gerade laufen konnte, und über drei Generationen hinweg daran gebaut. Daniel würde vermutlich in meinem Alter sein, wenn der Turm als letztes Teil des Doms vollendet wäre, und es faszinierte ihn, an einem Werk teilzunehmen, dessen Fertigstellung sich über mehrere Generationen hinweg vollzog. Schon als wir uns in Landshut ansiedelten, hatte er bettelnd und flehend so lange vor der Haustür gestanden, bis wir ihn auf den Wagen luden und zur Stadt hinein mitnahmen: ein kleiner, stämmiger Junge, der mit laufender Nase und offenem Mund die gewaltige Baustelle besichtigte, vollkommen verzaubert von dem ameisenhaften Gewühl, das sich darauf entfaltete. Man konnte ihn getrost in sicherer Entfernung zu den Bauarbeiten abstellen und alleine lassen, um Geschäfte zu erledigen: er bewegte sich nicht vom Fleck, bis man wieder zurückkam, und selbst auf dem Wagen drehte er den Kopf noch nach hinten, bis er nichts mehr von der Kirche erblicken konnte. Dann überfiel er einen mit Fragen und löcherte das Gesinde, wenn Maria oder ich oder auch Hanns Altdorfer nicht in der Lage waren, ihm die gewünschten Antworten zu geben. Es war mein Fehler gewesen, diese Leidenschaft nicht genügend zur Kenntnis genommen zu haben; der Tag, an dem er mir mitteilte, er habe eine Stelle als Steinmetzlehrling auf der Baustelle angenommen, wäre nicht so schmerzlich für uns beide verlaufen, hätte ich meine Augen und mein Herz weit genug für ihn geöffnet.
»Es geht drunter und drüber«, sagte er, und sein Grinsen ließ keinen Zweifel daran, daß ihm das Chaos von Herzen zusagte. »Der Hochaltar ist noch nicht soweit, daß die Trauungszeremonie davor stattfinden könnte, das Chorhaus ist ein wirrer Haufen aus Ziegeln und Brettern, und es gibt noch so viele nicht aufgefüllte Gruben im Kirchenschiff, daß erst letzte Woche ein altes Weiblein mit einer Fuhre Mörtel in eine hineingefallen ist und alles verschüttete. Stethaimer war so wütend, daß er sie am liebsten als Füllmaterial in der Grube gelassen hätte.«
Ich dachte mit Schaudern: Eine ähnliche Idee hat auch ein anderer gehabt; aber Daniel bemerkte nicht, wie ich zusammenzuckte, und erzählte unbekümmert weiter: »Hanns Altdorfer setzt den Baumeister noch zusätzlich unter Druck, weil es in der Kirche angeblich aussieht wie in einem Schweinestall. Jeden zweiten Tag taucht er auf der Baustelle auf und rechnet Stethaimer vor, wie viele Tage ihm noch bleiben bis zur Ankunft der Braut.«
Ich vergaß Daniels makabre Bemerkung und lächelte unwillkürlich. Daniel sagte: »Ich habe mich mit dem Stadtkämmerer schon eine Ewigkeit nicht mehr unterhalten.«
Als kleiner Junge hatte er ihn als seinen Oheim angesehen; als junger Mann schien es sich nicht mehr zu schicken, Hanns Altdorfer so zu bezeichnen. »Ich finde es schade; ich mochte ihn sehr gern. Trefft Ihr ihn noch zuweilen, Vater?«
»Wir sind nach wie vor Freunde geblieben«, erwiderte ich ruhig, und sein Gesicht nahm für einen winzigen Augenblick einen merkwürdigen Ausdruck an, als würde es ihn erleichtern, daß ich von Altdorfer als einem Freund sprach. Der Ausdruck verging, aber ich hatte ihn gesehen. Es war nicht wegen des Stadtkämmerers; es war die Tatsache, daß ich überhaupt jemanden meinen Freund nannte. Machte er sich Gedanken über meine Art zu leben? Mein eigener Sohn?
Er holte kurz Luft und schüttelte gleichzeitig belustigt den Kopf.
»Ich hätte gedacht, der Baumeister wäre zäher; aber wie es scheint, haben ihn die vielen Besuche des Stadtkämmerers mürbe gemacht. Er hat vermutlich Angst, man könnte ihn beschuldigen, den Bau zu verzögern. Er hat sich vor ein paar Wochen mit allen geschworenen Meistern zusammengesetzt und für die Dauer der Hochzeitsvorbereitungen die Landshuter Zunftordnung überarbeitet. Bislang war es so, daß kein Meister, Geselle oder Lehrling von Georgi bis Jakobi eine Arbeit auf dem Land annehmen durfte; er mußte der Stadt ständig zur Verfügung stehen. Nun hat er diese Zeitspanne noch nachträglich bis nach Martini ausgedehnt, damit keine Arbeitskraft der Kirche verlorengeht. Jeder Meister hat außerdem die Erlaubnis erhalten, bis zur Ankunft der Braut so viele Gesellen, Hilfskräfte und Träger anzuwerben, wie er für nötig hält, und es ist egal, ob sie Fremde oder Einheimische sind. Damit die Arbeiten schneller vorangehen, darf auch jeder Meister einen oder zwei Gesellen für selbständige Arbeiten empfehlen, damit diese ihre eigenen Gruppen von Hilfsarbeitern beschäftigen können.«
Er lächelte und strich sich über den Bauch.
»Ihr könnt mir gratulieren«, sagte er stolz. »Ich gehöre auch zu jenen Selbständigen.«
»Dann gratuliere ich«, sagte ich und lächelte.
»Ich beaufsichtige jetzt eine Gruppe von vier Steinhauern«, erklärte er. »Natürlich nur, bis die Hochzeit vorüber ist.«
»Gibt es denn in Landshut noch Männer, die etwas vom Bauhandwerk verstehen und nicht schon lange am Dom arbeiten?« fragte ich.
»Kaum«, lachte er. »Wir haben schon Leute aus dem halben Herzogtum angeworben, und es sind nicht gerade die Allerhellsten darunter. Stellt Euch vor, Vater: Unter den fremden Wappnern gibt es ein halbes Dutzend Maurer, die uns bereits angesprochen haben, sie würden lieber auf der Baustelle arbeiten, anstatt die Tore zu bewachen, aber der herzogliche Hauptmann läßt sie nicht gehen. Auf der anderen Seite laufen in der Kirche jede Menge Galgenvögel herum, die besser bei den Stadtknechten aufgehoben wären, und schleppen uns die Ziegel hinterher.«
»Das ist das Übliche«, bemerkte ich. Er hörte kaum hin.
»Ab und zu sind auch ein paar gute Leute darunter«, fuhr er fort. »Ein Freund hat in seiner Gruppe einen jungen Kerl, der schon als Steinmetz gearbeitet hat und der sich recht geschickt anstellt.«
»Aus deinem Mund ist das wohl ein Lob.«
Er nickte mit unbewußter Herablassung. Wenn ich ihn ansah, wußte ich, wie ich selbst in solchen Momenten aussah; wir besaßen auf unseren unterschiedlichen Wissensgebieten beide die Arroganz des Experten.
Dann machte er ein nachdenkliches Gesicht.
»Allerdings ist er ein merkwürdiger Kauz«, sagte er. »In den Arbeitspausen geht er herum und fragt nach alten Geschichten oder gibt selbst welche zum besten. Sein bevorzugtes Thema ist der Bürgeraufstand in Landshut. Ich wußte gar nicht, daß einmal einer stattgefunden hat.«
»Ich auch nicht«, sagte ich zerstreut. »Ich habe erst in den letzten Tagen etwas darüber gehört.«
»Ich hatte noch gar nichts davon gehört. Jedenfalls, der Kerl erzählt jedem, der es hören will, wie ungnädig der damalige Herzog mit den Aufständischen umgesprungen ist. Das Blut muß ja in Strömen geflossen sein.«
»Er spricht so über den Aufstand?« fragte ich nun doch interessiert. »Ich dachte, er sei nicht aus Landshut.«
»Ist er auch nicht. Aber er hetzt die Leute ständig damit auf, wie ungerecht und grausam damals alles abgelaufen sei.«
Ich beugte mich nach vorne. Plötzlich fühlte ich mich beunruhigt. »Er wiegelt die Leute auf?«
»Es läßt sich keiner aufhetzen«, besänftigte er mich. »Die meisten lachen über ihn; aber er hat eine Art, die Geschehnisse immer wieder anzusprechen, daß unter den Gesellen selbst schon bald kein anderer Gesprächsstoff mehr möglich ist.« Er seufzte; ihm selbst war das Thema sichtlich egal.
»Woher stammt der Kerl?« fragte ich hastig.
Er breitete die Hände aus.
»Woher soll ich das wissen?« sagte er. »Aus Bayern, jedenfalls. Ich selbst habe ein paar Helfer aus Italien und Polen ...«
»Daniel«, drängte ich. »Aus welcher Stadt?«
Seine Brauen krausten sich, und er schloß die Augen, als er nachdachte.
»Er hat es einmal erwähnt, weil ihn jemand seiner Sprache wegen aufzog. Aber ich weiß es nicht mehr, Vater.«
Ich holte Atem und fragte: »Kommt er aus Ingolstadt?«
»Richtig! « rief Daniel. »Hat es etwas zu bedeuten, daß Ihr so genau nachfragt?«
Ich antwortete ihm nicht.
»Vater?«
Ich sah zu Daniel und dachte: Ich darf ihn nicht hineinziehen. Es reicht, wenn sie es auf mich abgesehen haben.
»Es hat mit etwas zu tun, an dem ich arbeite«, sagte ich unwillig. »Ich würde es bevorzugen, wenn du mich nicht weiter fragtest.«
»Weshalb denn?«
Ich sah ihn starr an.
»Weil ich dich nicht belügen möchte.«
Seine Augen weiteten sich, und sein Unterkiefer sackte herab. Ich hob die Hand, um seine nächsten Worte abzuwehren.
»Laß uns das Thema nicht vertiefen, einverstanden?«
Er lehnte sich zurück und machte ein verdrossenes Gesicht. Seine Stirn legte sich in Falten. In einer unbewußten Geste kreuzte er die Arme vor der Brust, aber schließlich nickte er.
»Wenn Ihr meint...«, murmelte er unzufrieden.
»Nur eines noch, Daniel: Kannst du mich mit dem Mann zusammenbringen?«
»Was?« rief er erstaunt.
»Ich muß mit ihm sprechen.«
»Er wird nicht da sein«, sagte er verwirrt. »Heute haben alle Arbeiter frei, wie ich bereits sagte.«
»Morgen?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Sicherlich«, sagte er. »Ich muß Euch vorher nur bei Hans Stethaimer anmelden; er hat es nicht gerne, wenn er nicht in allen Einzelheiten weiß, was auf der Baustelle vorgeht.«
»Ich komme im Laufe des Vormittags vorbei«, versprach ich. Er zuckte nochmals mit den Achseln. Für einen Moment entstand Schweigen zwischen uns, ein Schweigen, wie es sich immer wieder einmal über uns legte; aber diesmal bemerkte ich es nicht. Ich war so aufgeregt, daß ich am liebsten aufgesprungen und hin und her gelaufen wäre. Ich durfte es nicht, wenn ich Daniel nicht mißtrauisch machen wollte. Und wenn ich ihn mißtrauisch machte, konnte es sein, daß er anfing, hinter mir herzuschnuppern. Es war das letzte, was ich riskieren wollte; ich hatte das abgründige Gefühl, daß der Tod seine Ernte noch nicht beendet hatte.
Schließlich ergriff Daniel wieder das Wort und erzählte weiter über die Schwierigkeiten auf der Baustelle, und ich hörte ihm mit halber Aufmerksamkeit zu. Als er sich zuletzt verabschiedete, war ich beinahe froh, nun in Ruhe nachdenken zu können. Er war zu Fuß herausgekommen, und ich sah zu, wie er durch mein Tor ins Freie ging und seine Gestalt über den kleinen Weg durch die Wiesen schmäler und schmäler wurde, bis sie mit dem Novembergrau verschmolz. Wir hatten uns dieses Mal nicht gestritten. Ich wußte, daß es nur daran lag, daß ich die meiste Zeit kaum auf das gehört hatte, was er sprach.