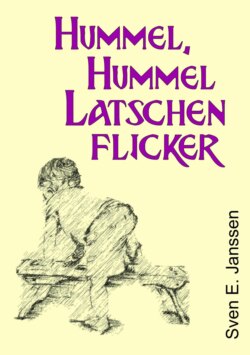Читать книгу Hummel, Hummel, Latschenflicker - Sven E. Janssen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE SPÄTE RACHE DES KARL HUBERTUS BLAU
ОглавлениеImmer dann, wenn in Ludwigshausen etwas schiefgelaufen war, wurde Jan Lübben zu seinen Großeltern väterlicherseits nach Hamburg verfrachtet, sozusagen ins heilsame Notexil. Natürlich konnte niemand etwas dafür, dass Nachbar Richard Otto beschlossen hatte, seiner physischen Existenz ein so unschönes Ende zu setzen. Dennoch löste die Nachricht bei der Verwandtschaft im hohen Norden fassungsloses Entsetzen und Kopfschütteln aus. Einmal mehr sahen sich Karl Hubertus Blau und dessen Frau Hildegard in ihrer Auffassung bestätigt, dass es sich bei Ludwigshausen um den Schmelztiegel des Abschaums der Menschheit handelte. Dass ihr Enkelsohn Jan in einer, nach ihren hanseatischen Maßstäben, solch grauenhaften Stadt aufwuchs, war für sie nicht nur ein Gräuel, sondern ein Quell ständigen Grams. Der Zufall wollte es, dass ohnehin die Herbstferien kurz vor der Tür standen, und so saß Jan Lübben schon zwei Tage später im Flugzeug Richtung Hamburg. Dorthin reiste er stets mit gemischten Gefühlen; einerseits liebte er seine Großeltern, zumal ihm seine Großmutter jeden Wunsch von den Lippen ablas. Hinzu kam das hotelgleiche Anwesen im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel, in dem die beiden lebten, das Ganze in einem riesigen Park mit eigenem kleinem Teich, ein regelrechtes Kinderparadies, wo es für ihn sogar eine Schaukel und eine Rutschbahn gab. Andererseits fürchtete er das im Hause Blau stets unterschwellig vorherrschende Ambiente protestantischer Strenge, das insbesondere durch seinen Stiefgroßvater, Karl Hubertus Blau, repräsentiert wurde. Sein leiblicher Großvater, Heinz Lübben, war bereits im Alter von 24 Jahren als Jagdflieger im Krieg gefallen. Schon während des Fluges nach Hamburg bekam Jan Lübben Magendrücken bei dem Gedanken an das Verhör, das ihm gleich nach seiner Ankunft durch seinen Großvater bevorstehen würde; nicht umsonst war Karl Hubertus Blau kurz nach Kriegsende Kriminalpolizist, bevor er sich entschloss, zunächst Schokoladenfabrikant und dann Schuhimporteur zu werden. Jan Lübben war natürlich völlig schleierhaft, warum der stets so nette und lustige Nachbar sich eine Kugel in den Kopf gejagt hatte. Mit all seinen neun Jahren war der Tod für ihn noch etwas völlig Abstraktes, zu Hause wurde über das Thema niemals gesprochen. Und so kam es, wie es kommen musste. Nachdem er, als ‚Alleinreisendes Kind´ am Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel von einer Stewardess seinen Großeltern übergeben worden war, diese ihn liebevoll begrüßt und ihn anschließend, nebst seinem Kinderkoffer, in Karl Hubertus Blauens silberfarbenen Mercedes verfrachtet hatten, begann noch auf der Fahrt in die Poppenbütteler Landstraße das gefürchtete großväterliche Verhör: „Mein Gott, mein Junge, was habt ihr denn da unten wieder ausgefressen?“ – „Ich wääß es nädd“ (Dialektal: „Ich weiß es nicht.“), antwortete Jan Lübben, in breitester Ludwigshausner Mundart. „Um Himmels Willen, Jan, sprich doch bitte Hochdeutsch, das ist ja furchtbar, wie Ihr da unten redet!“, fauchte Karl Hubertus Blau vom Fahrersitz zurück. Wohl liebte der nüchterne Hanseat und erzkonservative Kaufmann seinen Stiefenkel sehr, doch er hasste Ludwigshausen, und er hasste es, dass der Sohn seines Adoptivsohnes jetzt auch noch die widerwärtige Mundart dieser katholischen Barbaren annahm. „Aber Ihr müsst doch wissen, warum dieser Herr Otto sich das Leben genommen hat, so was gibt´s doch einfach nicht!“, ereiferte sich Karl Hubertus Blau weiter. Jan Lübben, der bereits mit den Tränen kämpfte, kauerte sich immer tiefer in das breite Rückpolster der Limousine und druckste nur sein bäurisches „ich wääß es nädd, ich wäaß es nädd.“ Doch jetzt intervenierte Hildegard Blau, die sich bereits ihre zweite Zigarette angezündet hatte, denn sie rauchte, trotz ihrer durchaus vorhandenen aristokratischen Eleganz, wie ein Schlot. „Hubertus, lass doch den Jung´ in Ruhe, siehst du nich´, dass er nichts von der Geschichte weiß!“ Und so schwieg Karl Hubertus Blau während der restlichen Fahrtzeit bis zum großelterlichen Domizil im Alstertal, bleich, immer wieder den Kopf schüttelnd, und, mit sorgenvollem Gesicht, von Zeit zu Zeit in den Rückspiegel blickend.
***
Hildegard Blau, geborene von Siehl, war schon in jungen Jahren aus Berlin nach Hamburg gekommen. Zuvor lebte sie allerdings in der Reichshauptstadt, zusammen mit ihrem ersten Ehemann, Heinz Lübben, einem hochdekorierten Fliegeroffizier, dem sie lediglich einen Sohn, Wolfrath, schenkte. Nach dem Einsatztod ihres Mannes Heinz, der, im Mai 1941, noch in den letzten Tagen der Luftschlacht um England, fiel, mangelte es ihr und ihrem erst dreijährigen Sohn zunächst an nichts; als Offizierswitwe genoss sie, noch bis kurz vor Kriegsende, zahlreiche Privilegien. So war ihr Sohn Wolfrath in einer Spezialklinik geboren worden, die die Partei am grünen Stadtrand von Berlin, im Rahmen ihres Lebensborn-Programms, unterhielt. Vor der Heirat musste das junge Paar den hieb- und stichfesten Beweis erbringen, dass beide mindestens acht Generationen rein deutscher Vorfahren hatten. Das Ganze wurde dann, in fein säuberlicher deutscher Schrift und mit den entsprechenden Amtsstempeln versehen, in einem grünen Büchlein dokumentiert. In den letzten Kriegswochen flüchtete sie vor den brutal marodierenden Sowjettruppen aus Berlin, ihren Sohn Wolfrath auf einem Leiterwagen hinter sich herziehend, Richtung Westen, um so, nach tagelangen Strapazen, zunächst auf einem Bauernhof vor den Toren von Hamburg zu landen. Während der ersten Monate verdingte sie sich dort als Magd, um sich dann im völlig ausgebombten Hamburg eine Stelle als Telefonistin zu suchen. Karl Hubertus Blau hatte als Soldat die Ostfront überlebt, wenn auch schwer verletzt. Noch in den letzten Kriegstagen schoss ihm ein Rotarmist zwei Kugeln in den Rücken, genau links und rechts von der Wirbelsäule, über dem Beckengürtel. Nur wie durch ein Wunder überlebte er das Ganze und nur wie durch ein Wunder landete er nicht im Rollstuhl. Doch Karl Hubertus Blau war ein Mann mit Glück. Nur so hatte er es, trotz seines jüdisch klingenden Namens und trotz seiner deutlich hebräisch anmutenden Nase, geschafft, keinen Verdacht zu erregen. Er hatte es geschafft, mitzuschwimmen, ohne aufzufallen, trotz der Tatsache, dass in seinen Adern – wenn auch weit entfernt und urgroßmütterlicherseits – zumindest etwas jüdisches Blut floss. Nachdem seine Wunden ausgeheilt waren, zurück blieben zwei fünfmarkstückgroße Einschusstrichter, fand er eine Anstellung bei der Hamburger Kriminalpolizei, denn es galt, die Trümmerlandschaft der Hansestadt von allerlei kriminellem Lumpengesindel zu säubern. Im Frühjahr 1946 lernten sich der Kriminalpolizist Karl Hubertus Blau und die Telefonistin Hildegard von Siehl beim sonntäglichen Tanztee in einem Café am Jungfernstieg kennen. Der Kriegsheimkehrer war sofort Feuer und Flamme für die junge Offizierswitwe mit dem dicken, halblangen braunen Lockenschopf, den braun-grünen Augen, die stets einen wie euphorischen, in die Ferne schweifen wollenden Glanz ausstrahlten und der kleinen, sehr schön gerade gezeichneten Nase, mit der sie ihn irgendwie an ein Kinderspielzeug erinnerte, obwohl sie gleichzeitig etwas unerklärlich Mondänes an sich hatte; doch war es genau diese seltsame Kombination, die Karl Hubertus Blau faszinierte. Auch Hildegard von Siehl gefiel der elegant wirkende, eher untersetzte Mann, der, mit seinem bereits ergrauenden Haar, der hohen Stirn, seinen kleinen, klug blitzenden, braunen Augen und seiner potenten Nase, fast schon ganz leicht an einen Südeuropäer erinnerte. Den Pragmatiker Karl Hubertus Blau störte es nicht, dass seine neue Eroberung bereits ein Kind hatte; schließlich waren alleinstehende Mütter in der Nachkriegszeit auch nichts wirklich Außergewöhnliches. Und Hildegard von Siehl störte sich nicht an den zwei überdimensionalen, tiefen Einschussnarben, die den Rücken Ihres Verehrers zeichneten, waren doch viele Männer wesentlich schlimmer entstellt aus dem Krieg zurückgekehrt. Genau zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, im Mai 1947, heirateten Karl Hubertus Blau und Hildegard von Siehl, um anschließend, gemeinsam mit dem kleinen Wolfrath, ein bescheidenes Ein-Familienhaus im Hamburger Stadtteil Norderstedt zu beziehen. Karl Hubertus Blau hatte es bald satt, Schieber, Schmuggler und Diebe in den Trümmern von Hamburg zu jagen. Die Polizeiarbeit war nicht nur frustrierend und ermüdend, sondern obendrein auch noch schlecht bezahlt. Im Herbst 1948 bot sich ihm die Gelegenheit, eine kleine Schokoladen-Produktionsanlage zu einem Spottpreis zu kaufen, die, wie durch ein Wunder, im Keller einer ausgebombten Fabrik den Krieg überlebt hatte. In einem angemieteten Schuppen begann er mit einigen Hilfsarbeitern die Produktion der ersten Lagen „Blaus Feine Chocoladen“, die er, mit üppigem Gewinn, an die ersten wieder funktionierenden Hamburger Warenhäuser verkaufte. Karl Hubertus Blau hatte eine Marktlücke entdeckt; der Heißhunger der vom Bombenkrieg ausgemergelten Hamburger auf Süßes erlaubte es ihm, sich bereits im Mai 1950 einen nagelneuen Mercedes 170 V zu ordern, in schwarz, mit weinroten Polstern. Seine Frau Hildegard gab ihren Posten als Telefonistin auf, um sich forthin mit Leib und Seele um ihre kleine Familie und den Bungalow nebst Garten in Norderstedt zu kümmern.
Im August 1950 reiste Familie Blau per Autofähre von Hamburg nach Schweden, wo man für einige Wochen ein Ferienhäuschen in der Nähe von Eskilstuna gemietet hatte. Doch Karl Hubertus Blau war nicht für den Müßiggang am Badesee geschaffen. Und so setzte er sich bereits am Morgen des dritten Urlaubstages ans Steuer seines Mercedes, um die Gegend zu erkunden. Ganz besonders interessierte es ihn, womit denn die Leute hier ihr Geld verdienten. So kam es, dass er durch Zufall auf eine kleine, von außen unscheinbare, an einer zweispurigen Landstraße am Waldrand gelegene Fabrik stieß. Das weißgetünchte, nahezu fensterlose Gebäude verfügte lediglich über zwei Etagen, davor mehrere Laderampen für den Abtransport der Waren. Die ganze Anlage machte einen gepflegten, schmucken Eindruck. Drinnen wurde Karl Hubertus Blau, der ein recht passables Englisch sprach, von einem zwar überraschten aber dennoch freundlichen Produktionsleiter in Empfang genommen, der ihm erklärte, dass man hier die berühmten schwedischen Holzschuhe herstelle, darüber hinaus produziere man auch noch Lederpantoffeln mit Korksohle, die insbesondere bei Ärzten und Krankenschwestern besonders beliebt seien. Der Produktionsleiter, der sich als Gustaff Kunnsonn vorstellte, bot sich an, Karl Hubertus Blau die Fabrik zu zeigen, der dieses Angebot mit einem breiten Grinsen und vor Glück erhöhtem Puls annahm. Während des Rundgangs, bei dem sich der erste gute Eindruck von der schmucken Schuhproduktion bestätigte, formte sich vor dem Geistigen Auge des Hamburger Vollblutkaufmanns bereits die Vision einer neuen Geschäftsidee: Vorausgesetzt, ihm würde es gelingen, die schwedischen Gesundheitsschuhe zu einem Spottpreis nach Deutschland zu importieren, so könnte er diese dort mit sattem Gewinn an die nun allerorten wieder entstehenden Arztpraxen, Krankenhäuser und Sanatorien verkaufen. Schon eine Woche später traf sich Karl Hubertus Blau im rund 100 Kilometer von Eskilstuna entfernten Stockholm mit den Besitzern der Fabrik, mit denen er sich, nach einem zermürbenden Verhandlungsmarathon und anschließendem wüsten Trinkgelage, handelseinig wurde. Karl Hubertus Blau war jetzt Deutschland-Exklusivimporteur für original schwedische Holzschuhe sowie echt schwedische Gesundheitspantoffel mit Korksohle und perforiertem Lederblatt. Noch im Suff kritzelten die neuen Geschäftspartner einen Handelsnamen für das in Deutschland neu einzuführende Produkt auf einen Bierdeckel: „Kahuflex“ – „Kahu“ für ‚Karl Hubertus´ und „flex“ als Hinweis auf die flexiblen Korksohlen jener Pantoffeln, mit denen man nun die Herzen der deutschen Ärzte und Krankenschwestern erobern wollte. Nach der Rückkehr ins bereits frühherbstliche Hamburg mietete Karl Hubertus Blau eine kleine Lagerhalle mit Kontor im Stadtteil Wandsbek an. Für die Lagerarbeit stellte er einen Gehilfen ein, die Büroarbeit übernahm er selbst. Die Kahuflex-Gesundheitsschuhe wurden schnell zu einem absoluten Renner, kostete doch das entsprechende deutsche Fabrikat im Laden glatt das Doppelte. Karl Hubertus Blau belieferte Arztpraxen, Krankenhäuser, Sanatorien und verkaufte seine Kahuflex-Schwedenclogs an alle großen deutschen Warenhäuser. Bald schon musste er einen weiteren Lagerarbeiter einstellen und eine zusätzliche Halle anmieten. Im Frühjahr 1953 hatte Karl Hubertus Blau bereits seine erste dreiviertel Million verdient, nach Verbindlichkeiten und Steuern.
Und so beschloss die Familie, sich mit einer Flugreise nach Teneriffa einen für damalige Verhältnisse unerhörten Luxus zu erlauben. Die Kanaren-Insel war zu dieser Zeit noch kein Ziel des Massentourismus, es gab nur eine Hand voll Hotels, in denen die ausländischen Touristen wie Fremdkörper wirkten. Familie Blau stieg im „Hotel La Gaita“, im auf der Nordseite der Insel gelegenen Puerto de la Cruz ab. Es war das eleganteste Haus am Platze, und Karl Hubertus Blau witterte Geschäfte. Schon seit Monaten hatte er in Hamburg Nacht für Nacht per Kassetten-Fernkurs Spanisch gepaukt, denn er war sicher, dass sich in diesem noch unentdeckten Ferienparadies gutes Geld verdienen ließe. Doch dieses Mal war es seine Frau Hildegard, die ihm die Türen zur verschlossenen insulanischen Gesellschaft öffnete. Eigentlich war es ihr zwischenzeitlich 15-jähriger Sohn Wolfrath, der beim Herumtollen am Pool einen etwa gleichaltrigen Spanier, Victor de Mancharo y Vittoria, kennengelernt hatte und sich mit diesem hervorragend in Zeichensprache verständigte. Dessen Mutter, Eleonora de Mancharo, lud Familie Blau zum Mittagessen im Hotelrestaurant ein. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Familie de Mancharo um die Condes de Mancharo y Vittoria handelte, eine alteingesessene Großgrundbesitzer-Dynastie, denen, unter anderem, auch das „Hotel La Gaita“ gehörte. Insbesondere durch das Band der gleichaltrigen Söhne entstand im Verlauf der Ferientage eine, wenn auch oberflächliche, Freundschaft zwischen den beiden Familien. José Francisco de Mancharo y Vittoria, das Familienoberhaupt, zeigte sich insbesondere von der Zähigkeit beeindruckt, mit der es Karl Hubertus Blau geschafft hatte, in nächtlichen Sitzungen, per Fernkurs, ein recht passables Spanisch zu erlernen. Nach einigen Tagen entschloss er sich, seinem neuen Bekannten aus Deutschland ein Geschäft vorzuschlagen. Auf einem nahe von Puerto de la Cruz gelegenen Hügel besaß er eine für ihn wertlose, seit Jahren brachliegende Finca (Spanisch, hier: Grundstück), auf der man gut und gerne vier oder fünf Villen mit Meerblick errichten könnte. Für 500.000 Pesetas, so der Conde, würde er sich von dem Grundstück trennen, die Baulizenz sei kein Problem, er habe hervorragende Kontakte ins Rathaus. Karl Hubertus Blaus schlug sofort zu. Im Dezember 1953 reisten die Blaus erneut nach Teneriffa, um das Immobiliengeschäft unter Dach und Fach zu bringen. Dieses Mal fand die Reise per Schiff statt, denn man hatte eine über zwei Meter hohe Nordmanntanne als Gastgeschenk dabei, schließlich war vereinbart worden, das Weihnachtsfest im Hause der Condes de Mancharo zu verbringen. Unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen wurde die Escritura de Compra Venta (Spanisch: Immobilien-Kaufvertrag) für Karl Hubertus Blauens neues Inselgrundstück nebst Baulizenz erstellt. Schon eine Woche später begannen die Bauarbeiten für vier großzügige Villen; drei davon wollte Karl Hubertus Blau anschließend vermieten oder weiterverkaufen, eine aber – „Las Palmeras“ – sollte zum großzügigen Ferienwohnsitz der Blaus werden.
Im Januar 1954 erstand Karl Hubertus Blau im Hamburger Alstertal ein rund 10.000 m2 großes Anwesen mit Teich, wo in den folgenden zwei Jahren der endgültige Hamburger Familiensitz entstehen sollte. Bei der Ausgestaltung der dreigeschossigen Villa ließ Karl Hubertus Blau seiner Frau Hildegard nahezu freie Hand, denn diese hatte ein unfehlbares Gespür für alles Schöne. So wurden etwa für den Verputz der Außenfassade mehrere Schiffsladungen Muschelsand aus Teneriffa herbeigeschafft. Das Leben der Familie Blau schien jetzt perfekt. Indes war Karl Hubertus Blaus Stiefsohn Wolfrath zu einem hochgeschossenen Teenager herangewachsen, der sich wesentlich mehr für den Fußball und fürs Segeln als für die Oberschule interessierte. Bald sollte Wolfrath Lübben auch noch seine überdurchschnittlich entwickelte Vorliebe für das weibliche Geschlecht entdecken. Karl Hubertus und Hildegard Blau zankten sich immer häufiger wegen der schlechten Zensuren ihres schulisch nicht gerade übereifrigen Sohnes, den weder Druck noch gute Worte zu fleißigerem Lernen animieren konnten. Wolfrath Lübbens größter Wunsch war es freilich, zur See zu fahren und so entschloss sich Karl Hubertus Blau, ihm eine Heuer auf einem Handelsschiff zu suchen, in der Hoffnung, dass zwei Jahre hartes Seemannsleben ihre heilsame Wirkung zeigen würden. Doch das Einzige, was Wolfrath nach zwei Jahren auf hoher See hinzugelernt hatte, war, sehr zum Gram seiner Mutter, das Rauchen und das Trinken; seine Abenteuerlust und sein Appetit auf Frauengeschichten waren nur noch gewachsen. Karl Hubertus Blaus stiefväterliche Geduld war jetzt an ihrem Ende angelangt. Wolfrath Lübben sollte eines nicht allzu fernen Tages die Firma übernehmen und musste nun, zur Not auch gegen seinen Willen, endlich erwachsen werden. Darüber hinaus erachtete er es als unerlässlich, dass Wolfrath das Schuhgeschäft von der Pike auf erlernte, am besten weit weg von seiner Mutter, die ihn, wie er glaubte, viel zu sehr verwöhnte. Auf einer Fachmesse hatte Karl Hubertus Blau von der ´Technische Fachschule für Leder und Textil Ludwigshausen´ in der tiefsten süddeutschen Provinz gehört, die einen guten, ja sogar internationalen Ruf genoss. Gegen den ausdrücklichen Willen seiner Frau beschloss er, seinen Adoptivsohn für den dreijährigen Studiengang in dem weit von Hamburg entfernt gelegenen Nest einzuschreiben. Und so kam es, dass Karl Hubertus und Hildegard Blau, ob dieser einseitigen Entscheidung, ihren ersten großen Ehestreit hatten.
Wolfrath Lübben hingegen reiste im Spätsommer 1963, mit leichtem Gepäck und noch leichterer Geldbörse versehen, per Bahn gen Süden, wo er, spät abends, auf dem gottverlassenen Sackbahnhof von Ludwigshausen ankam. Zuvor hatte ihn sein Stiefvater am Bahnhof Norderstedt noch mit dem typisch Hamburger Gruß „Hummel Hummel!“ verabschiedet, auf den Wolfrath durch das geöffnete Zugfenster artig „Mors Mors!“ zurückbrüllte; bei sich dachte er hingegen, dass es eigentlich „Hummel Hummel – Latschenflicker!“ heißen sollte, denn als „Latschenflicker“ wurden die Ludwigshausner im Hohen Norden von allen, die irgendetwas mit der Schuhindustrie zu tun hatten, abfällig tituliert, hielt man sie doch dort für überaus primitive katholische Hinterwäldler.
***