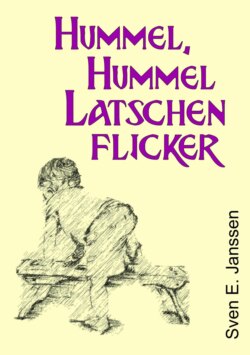Читать книгу Hummel, Hummel, Latschenflicker - Sven E. Janssen - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ABSTURZ
ОглавлениеNach dem Tod seines Vaters, im Juni 1974, wurde Jan Lübben für rund zehn Wochen in die Blausche Ferienresidenz Las Palmeras auf Teneriffa geschickt, während sich Juliane Lübben im gleichen Zeitraum in einem Sanatorium erholte. In Las Palmeras begleiteten ihn seine Hamburger Großeltern, sowie das treue spanische Kindermädchen Fabia, das ihn keine Minute aus den Augen ließ. Doch aus dem noch vor wenigen Wochen fröhlichen, fast stetig lachenden Jan war plötzlich ein melancholisches Wrack geworden, antriebslos, dumpf und stumm. Nur Fabia konnte ihm ab und an ein Lächeln entlocken oder ihn zu einem kurzen Ballspiel im weitläufigen Garten der Villa bewegen. Fabia, die gerade erst geheiratet hatte, aber noch ohne Kinder war, entsprach, zumindest äußerlich, dem vorgefertigten Bild eines spanischen mütterlichen Typs: Sie war von eher kleiner Statur, dafür aber, trotz ihrer jungen Jahre, bereits von recht stattlicher Leibesfülle, ohne dabei – auf hässliche Art – dick zu wirken. Sie hatte pechschwarzes, glänzendes Haar, das sie stets zu einem Knoten zurückgebunden trug. Ihre großen dunkelbraunen Augen, die das Puppenhafte ihres Gesichtes nur noch unterstrichen, wurden von langen, dicken Wimpern geziert, die sie immer etwas traurig wirken ließen. Zur Arbeit bei den Blaus trug sie stets eine perfekt gestärkte rosa-weiß gestreifte Uniform mit weißer Schürze. Als Jan Lübben noch ein Kleinkind war, nähte sie ihm, in stundenlanger, unbezahlter Heimarbeit, Kleider für seine Puppe ‚Buba’, ohne dass man ihr dies aufgetragen hätte, denn sie liebte den kleinen Enkel ihrer Herrschaft aufrichtig, und auch Jan hing sehr an seinem spanischen Kindermädchen. Den Kontakt zu anderen Kindern, wie überhaupt zur Außenwelt, lehnte Jan Lübben während der Zeit auf Teneriffa strikt ab. Nur einmal ließ er sich, zum Erstaunen seiner Großeltern, zu Fabia mit nach Hause nehmen, die in dem kleinen Küstendorf Punta Brava wohnte. Dort wurde er, in typisch kanarischer Manier, von Fabias Großfamilie einen ganzen Nachmittag lang verhätschelt und bekocht. Als er, nach knapp 70 Tagen, wieder nach Ludwigshausen zurückkam, sah er kerngesund aus: braungebrannt, das blonde Haar von der Sonne fast weiß gebleicht, und, durch Fabias sowie seiner Großmutters Hildegard Kochkünste bedingt, ein paar Kilo dicker geworden. Doch in seinem Inneren hatten bereits die ersten Auswirkungen einer manischen Depression ihr Vernichtungswerk begonnen; noch immer hatte ihm niemand erklärt, was genau mit seinem Vater geschehen war.
Mitte September 1974 wurde Jan Lübben in die Klasse 5a des Neusprachlichen Gymnasiums Ludwigshausen mit Erstfremdsprache Französisch eingeschult. Das Lehrerkollegium war bereits vorgewarnt, dass man es mit einer psychisch angeschlagenen Halbwaise zu tun bekäme und somit sanfte Nachsicht geboten sei. Natürlich war der ‚Neue´ von Beginn an Tratschthema Nummer eins im Lehrerzimmer des NGL, wo sich längst herumgesprochen hatte, dass sich der Vater des Jan Lübben im Suff zu Tode gefahren habe. Und natürlich wurde auch seitens des ehrenwerten Gymnasiallehrerkollegiums das Thema hübsch ausgeschmückt, aufgebauscht und aufs Garstigste kommentiert. Zunächst ließ sich der Schulwechsel Jans jedoch gut an: Er hatte nette, rücksichtsvolle Klassenkameraden, unter denen er schnell neue Freunde fand, insbesondere das Geschwisterpaar Klaus und Bettina Kenzelmann. Die Geschwister Kenzelmann stammten aus einfachen Verhältnissen, der Vater war Bürobote bei der Bank, die Mutter ging putzen. Doch Jan Lübben fühlte sich bei den Kenzelmanns zu Hause geborgen, stets behandelten sie ihn wie ein Familienmitglied. Darüber hinaus waren die Geschwister Kenzelmann treue Freunde und, im Laufe der Zeit, die ersten echten Gesprächspartner für Jan Lübben, Seelenverwandte, mit denen er sich auf einem geistigen Niveau wähnte. Auch mit den Lehrern hatte er zunächst Glück, zumindest teilweise. Da war beispielweise die kurz vor ihrer Pensionierung stehende Mathematiklehrerin Friedelknecht, ihres Zeichens Vizerektorin des NGL, die Jan Lübben persönlich unter ihre Fittiche nahm. Sie unternahm zumindest den Versuch, ihm seine in der Grundschule eingeprügelte Angst vor dem Rechnen und der Mengenlehre zu nehmen, wachte darüber hinaus akribisch darauf, dass im Lehrerzimmer nicht dumm über den ‚Fall Lübben’ dahergetratscht wurde. Dann war da der eigentlich von allen gefürchtete Deutschlehrer Böckel, gleichzeitig Klassenleiter der 5a. Böckel war ein schlanker Mann mittlerer Statur, der sein schwarzgraues Haar stets zu einem zackigen Bürstenschnitt geschoren trug. In seinem bleichen Gesicht prangte ein pechschwarzer Halbvollbart, der ihm ein gewisses dämonisches Aussehen verlieh, was durch die rechteckige, strenge Nickelbrille noch unterstrichen wurde. Böckel war ein Virtuose der deutschen Sprache, ein Meister des Wortes, ein regelrechter Gott der Grammatik, und er wusste all dies nur zu gut. Von seinen Schülern verlangte er absoluten Gehorsam. So mussten, beispielsweise, alle in ihren Federmäppchen exakt einen Pelikan- Füllfederhalter mit blauer Tinte, einen roten, einen schwarzen sowie einen grünen Filzstift, einen stets gespitzten Bleistift, einen Radiergummi, einen offenen Bleistiftspitzer und ein Lineal haben, nicht mehr und nicht weniger. Hefte und Bücher hatten stets blitzsauber zu sein, jegliche Zeichnungen oder Aufkleber waren strikt verboten, Zuwiderhandlungen hatten das zeremonielle Zerstören des Objektes der Schande vor den Augen aller zur Folge. Böckel war ein rechter Sadist und ein schlimmer Zyniker, er duldete weder faule noch dumme Schüler in seiner Klasse, denen er unverfroren einen „Wechsel auf die Hauptschule“ empfahl. Jan Lübben gefiel ihm von Beginn an; nicht nur, weil er sich strikt seiner Disziplin unterordnete. Nein, „das kleine blonde Monster“, so wie er ihn zu nennen pflegte, war, seiner Meinung nach, „sauintelligent“ und schrieb die besten Aufsätze, die er seit langem bei einem seiner Schüler gesehen hatte. Das Ganze ging sogar soweit, dass Jan Lübben von Böckel, im Falle von ´großen´ Klassenarbeiten, eine schriftliche Sondererlaubnis zum Längerschreiben bekam, die zwar von seinen Mitschülern, nicht aber vom übrigen Lehrerkollegium neidlos akzeptiert wurde. Auch mit seinem Geschichtslehrer, Dieter Schmeerig, verstand sich Jan überdurchschnittlich gut. Schmeerig war ein absoluter Sonderling: Von eher schlaksiger Statur, mit leicht verkrümmtem Rücken, Bierbäuchlein und ausgeprägten Plattfüßen, war er das glatte Gegenteil eines Athleten. Trotz seiner mindestens vierzig Jahre zierten die fettige Haut seines stets etwas gelblichen Gesichtes noch immer mindestens hundert Pickel, darüber fanden sich Reste eines ausgefledderten Haarschopfes undefinierbarer Farbe. Auf seiner Nase saß eine überdimensionale schwarze Hornbrille mit starken Gläsern, die seinem Gegenüber stets das Gefühl gaben, als wollten die Augen aus ihren Höhlen springen. Doch Schmeerig war eine Intelligenzbestie, ein absolutes Genie. Sein Geschichtsunterricht beschränkte sich nicht nur auf das Herunterleiern langweiliger Daten und Fakten. Nein, sein Unterricht war, bereits in der fünften Klasse, eine veritable Vorlesung. Am Ende des ersten Schuljahres auf dem NGL hatte Jan Lübben durchaus respektable Zensuren, sogar in seinem alten Problemfach, der Mathematik, und es sah fast so aus, als ob aus ihm ein recht passabler Gymnasiast werden könnte.
Doch bereits mit Beginn des zweiten Jahres auf der neuen Schule begann sich die Situation zu wandeln. Jan Lübbens Klasse bekam jetzt mit Rudi Fuchs einen neuen Mathematiklehrer, denn Vizerektorin Friedelknecht hatte sich in den Ruhestand verabschiedet. Rudi Fuchs war nur etwa einen Meter sechzig groß, dafür aber breitschultrig und sehnig, quälte er sich doch täglich mehrere Stunden lang mit Kraft- und Lauftraining. Sein nicht mehr vorhandenes Haupthaar suchte er durch einen dichten, orange-roten Vollbart auszugleichen, was sein zwergenhaftes Aussehen nur noch zusätzlich unterstrich. Doch vor allem litt Rudi Fuchs unter Komplexen; nicht nur, weil er ein Zwerg war; nein, Rudi Fuchs hatte Komplexe, weil er sich selbst hasste. Als Jüngling, und auch noch als Student, war Rudi Fuchs stets von eher schwächlicher Statur, was von seinem hellen Teint, den Sommersprossen und dem karottenroten Haar nur noch unterstrichen wurde. Schon als 14jähriger entdeckte er seine extrem stark vorhandene Vorliebe für das männliche Geschlecht, als er sich hoffnungslos in seinen grauäugigen, athletischen Mitschüler Matthias Deppler verliebte, der ihn, mit seinen kaukasischen Gesichtszügen, um fast zwei Köpfe überragte. Nur um dem unerreichbaren Matthias Deppler, dessen Äußeres fast schon der Karikatur eines Deutschen Hünen gleichkam, zu imponieren, begann Rudi Fuchs seinerseits, Sport zu treiben, mit der verbissenen Hartnäckigkeit eines zum Opfer prädestinierten rothaarigen Zwerges. Schon als Teenager versuchte er, seine homophilen Neigungen, für die er sich stets schämte, für die er sich stets schmutzig fühlte, durch ein exzessiv zur Schau getragenes Männlichkeitsgehabe zu überdecken. Immer wieder hatte er es mit Frauen versucht, doch stets waren diese Beziehungen gescheitert; es war ihm schlichtweg unmöglich, Sex mit einer Frau zu haben, er bekam dann einfach partout keinen hoch. Wegen all dem hasste Rudi Fuchs sich selbst, doch noch viel mehr hasste er die Menschheit und deren Brut, die er in seinen Schülern repräsentiert sah. Jan Lübben hasste er vom ersten Augenblick an ganz besonders, der ‚Neue´ war zu hochgewachsen, zu blond, zu blauäugig, und, darüber hinaus, auch noch der Lieblingsschüler seines Erzfeindes Böckel. Wie ein blutgeifernder Kettenhund roch Rudi Fuchs Jan Lübbens in der Grundschule angeprügelte Angst vor dem Rechnen, die von seiner Vorgängerin Friedelknecht nur oberflächlich geheilt werden konnten. Und so riss er, mit geiler, sadistischer, regelrecht orgiastischer Lust die alten Wunden wieder weit auf. Jan Lübben hatte jetzt wieder Angst vor dem Schulbesuch, gleichzeitig fraßen die nie bewältigten Ereignisse nach dem Tode seines Vaters Wolfrath, in Form einer schleichenden Depression, immer tiefere neuronale Schnellstraßen in sein Hirn. Mit elf Jahren war Jan Lübben nurmehr ein Schatten seiner selbst, er litt ständig an Magenschmerzen, chronischer Blasenentzündung und, vor allem, an Schlaflosigkeit, die nur von quälenden Alpträumen unterbrochen wurde.
Ein Traum, den er immer wieder hatte, war, dass der leblose, von Verletzungen entstellte, bleiche und völlig vernarbte Körper seines Vaters, mittels Lederschlaufen auf einen stählernen Stuhl gefesselt, in eine überdimensionale, bis ins Universum reichende, Maschine eingebracht wurde, aus der unzählige Schläuche, Drähte und Rohre liefen. Dann setzten vermummte, dem Tode ähnliche Gestalten die Apparatur in Gang, woraufhin der Leichnam, einem Golem gleich, wieder zum Leben erweckt wurde. Die vermummten Todesgestalten forderten Jan Lübben nun auf, seinen Vater wieder mit nach Hause zu nehmen. Doch der erkannte seinen Sohn nicht mehr, war nur noch eine dumpfe, seelenlose Hülle. Aus diesem Traum erwachte Jan jedes Mal, von seinen eigenen Schreien geweckt, dabei war sein Pyjama vom Angstschweiß durchnässt und blutbesudelt, denn im Angsttraum zerbiss sich er sich regelmäßig die Innenseiten seiner Wangen.
Auf den dringenden Rat von Johannes Schmal hin, fuhr Juliane Lübben im Herbst 1975 mit ihrem Sohn ins Universitätsklinikum der Nachbarstadt, um Jan dort dem Kinderpsychiater vorzuführen. Der Professor verschrieb, frisch, fromm, fröhlich frei, erlesene Opiate und Antidepressiva, die Jan in den folgenden zwei Jahren zu einem tumben, aufgedunsenen, apathischen Schwamm werden ließen. Mit zwölf Jahren war aus dem einst aktiven, schlanken, kerngesunden und stets fröhlichen Jan Lübben ein feister, fetter Frosch geworden, der, wenn er nachmittags aus der Schule kam, nur noch Schokolade schmatzend im Sessel kauerte, hierbei ein Buch nach dem anderen verschlingend. Die Medikamente hatten ihn träge und antriebslos werden lassen, er hatte sich zu einem Eigenbrötler entwickelt, dem jegliches Interesse an der Außenwelt abhandengekommen war. Seine schulischen Leistungen waren bald nur noch schwaches Mittelmaß, außer in den Fächern Deutsch und Geschichte, wo er nach wie vor zu den Besten zählte. ‚Fünfer’ in Mathematik, Physik und Chemie bedrohten ihn ständig mit dem Sitzenbleiben. Juliane Lübben beschloss jetzt, für ihren Sohn erstmals einen privaten Nachhilfelehrer zu bestallen. Die Medikamente, die Jan Lübben zu seiner Ruhigstellung nach fast zwei Jahren noch immer schlucken musste, hatten seine Körper nun völlig entstellt und dies wurde zunehmend zu einem neuen Problem. Nicht nur, dass er auf dem Schulhof jetzt ständig als ‚Fettsau´ gehänselt wurde; nein, es waren insbesondere die Erwachsenen, Freunde, Bekannte und Nachbarn seiner Mutter, die sich nun über ihn lustig machten, angeführt von seinem Angst-Lehrer Rudi Fuchs. Letzterer ließ keine Gelegenheit aus, ihn auf seinen Status als ´Dicker´ anzusprechen: So pflegte er, beispielsweise, vor versammelter Klasse, zu ihm zu sagen: „Du bist doch so dumm wie die fette Wurst, die du heut’ Morgen wieder in dich reingefressen hast!“ Doch selbst Bekannte und Nachbarn ließen keine Gelegenheit aus, Jan Lübben, ob seiner neuen Leibesfülle, zu piesacken.
Seit er das Neusprachliche Gymnasium Ludwigshausen besuchte, fuhr er des Morgens im roten Volvo-Kombi seines Nachbarn, Dr. Willibert Frank, mit zur Schule, dessen beiden sich etwa in seinem Alter befindlichen Töchter ebenfalls das NGL besuchten. Familie Frank bewohnte ein großzügiges Einfamilienhaus, das sich, schräg gegenüber dem Reihenhausblock der Lübbens, auf der anderen Straßenseite des Truffaud-Rings fand. Dr. Willibert Frank, ein im Grunde genommen sehr simpler, wenn auch durch die Borniertheit seiner Mitbürger reich gewordener, Winkeladvokat war ein im kleinstädtischen Ludwigshausen recht angesehener Spießbürger, der sich in der Ludwigshausner Innenstadt mit einer leicht modrigen Kanzlei der armseligsten aller Wissenschaften, der Jurisprudenz, widmete, während sein rühriges Eheweib den klassisch musizierenden Haushalt führte. Doch Willibert Frank war auch ein Patriarch alter Schule, der sowohl das Leben seiner Gattin, als auch jenes seiner Kinder streng kontrollierte. Am Morgen, bevor es zur Schule ging, klingelte Jan Lübben bei den Franks, die dann, in der Regel, noch im zur Straße hin gelegenen Esszimmer an der großen runden Familientafel beim Frühstück saßen, wobei Dr. Willibert Frank, im Scheine einer grell vom Plafond herunterbaumelnden Schirmlampe, regelrecht Hof hielt und für alle den akribisch ausgearbeiteten Tagesplan festlegte. Währenddessen musste Jan Lübben stets in der Eingangshalle, zwischen dem zur Lüftung in Reih und Glied gepaarten Schuhwerk der Familie ausharrend, ebenso brav wie stehender Weise warten, bis die Franks ihr alltägliches Strategiefrühstück beendet hatten. Die anschließende Fahrt zum Gymnasium, die, aufgrund der morgendlichen Staus etwa 20 Minuten dauerte, war für Jan Lübben stets ein Martyrium, denn Dr. Frank machte sich, vor seinen Töchtern, mit Vorliebe über ihn lustig. Die Tatsache, dass Jan Lübbens Vater sich im Alkoholrausch zu Tode gerast hatte, war für ihn eine Art Freibrief, sich den ungeliebten Fahrgast allmorgendlich zur Brust zu nehmen, er nahm den kleinen, seines Ermessens nach halbverblödeten, Fettsack ohnehin nur seiner Frau zuliebe im Auto mit. So fragte er ihn einmal, ob er denn nicht wisse, dass es „gefährlich für das Gehirn sei, so viel kalorienreiches Essen in sich hineinzustopfen.“ Bei einer anderen Gelegenheit prophezeite Willibert Frank Jan Lübben, dass dieser „niemals bei der Bundeswehr genommen“ würde, denn dort könne man keine „dicken Soldaten“ gebrauchen. Im Autoradio lief dabei eine Kassette mit Mozarts Zauberflöte, und Dr. Frank summte eifrig mit.