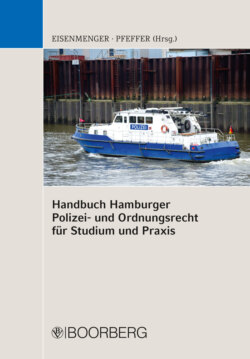Читать книгу Handbuch Hamburger Polizei- und Ordnungsrecht für Studium und Praxis - Sven Eisenmenger - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
i) Gesetzgebungskompetenzen und Entstehung eines europäischen Rechts der inneren Sicherheit
Оглавление37
Trotz der Feststellung einer „verfassungsfesten Integrationsschranke“ (s. dazu A.II.1.g.) durch das Bundesverfassungsgericht und trotz der Verankerung des Ordre-public-Vorbehalts (s. dazu A.II.1.f.) im Primärrecht der EU, unterliegt das Recht im Bereich des RFSR seit dem Vertrag von Lissabon einer zunehmenden Europäisierung.80 Während das Recht der EU/EG zunächst primär auf Polizeikooperation ausgerichtet war, hat sich in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel vollzogen hin zu einer Annäherung der mitgliedstaatlichen Sicherheitsrechtsordnungen.81 Dies geschah durch die Auflösung der mit dem Vertrag von Maastricht eingeführten Säulenstruktur und der damit einhergehenden Überführung der einschlägigen Artikel in den Titel V AEUV mit dem Vertrag von Lissabon (s. dazu A.II.1.a.) sowie die Einführung weiterer Kompetenzen der Union, etwa zur Ergreifung von Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung, Art. 75 AEUV, der polizeilichen Zusammenarbeit, Art. 87 AEUV, sowie der Verhängung von Wirtschaftssanktionen, Art. 215 AEUV.82
38
Der Vertrag von Lissabon sieht nun zu einigen ausgewählten Themen ausdrücklich eine Harmonisierung in Form von Mindeststandards vor, zum Beispiel bei der Zulassung von Beweismitteln, bei den Individualrechten im Strafverfahren und beim Opferschutz, Art. 82 Abs. 2 AEUV. Auch bei der Festlegung von Minimumstandards bei Straftaten „in Bereichen besonders schwerer Kriminalität“ ist eine Harmonisierung möglich. In Art. 83 Abs. 1 AEUV werden genannt: „Terrorismus, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern, illegaler Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Geldwäsche, Korruption, Fälschung von Zahlungsmitteln, Computerkriminalität und organisierte Kriminalität“.
39
Die EU kann zudem die nationale Kriminalprävention fördern, ohne jedoch harmonisieren zu dürfen, Art. 84 AEUV.
40
Eurojust hat den Auftrag, die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden zu unterstützen und zu verstärken, die für die Ermittlung und Verfolgung von schwerer Kriminalität zuständig sind, wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten betroffen sind oder eine Verfolgung auf gemeinsamer Grundlage erforderlich ist, Art. 85 Abs. 1 Satz 1 AEUV. Eurojust stützt sich dabei auf die von den Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol durchgeführten Operationen und gelieferten Informationen, Art. 85 Abs. 1 Satz 2 AEUV. Erstmals ist auch die Kompetenz vorgesehen, Ermittlungsmaßnahmen einzuleiten oder nationalen Stellen die Einleitung von Strafverfolgungsmaßnahmen vorzuschlagen, Art. 85 Abs. 1 lit. a AEUV.
41
Art. 86 AEUV sieht die Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) vor. Im Jahr 2017 wurde dieses Ziel von 20 Mitgliedstaaten in Form der sog. Verstärkten Zusammenarbeit nach Art. 86 Abs. 1 UAbs. 2 AEUV (s. A.II.1.g.) umgesetzt. Inzwischen beteiligen sich hieran 22 Mitgliedstaaten.83 Die EUStA mit Sitz in Luxemburg soll im November 2020 ihren Betrieb aufnehmen. Am 14. 10. 2019 hat der Europäische Rat Laura Codruţa Kövesi als erste Europäische Generalstaatsanwältin ernannt.84 Die EUStA wird als erste unabhängige und dezentrale Staatsanwaltschaft der EU befugt sein, Straftaten gegen den EU-Haushalt wie beispielsweise Betrug, Korruption und schweren grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug zu untersuchen, strafrechtlich zu verfolgen und vor Gericht zu bringen, Art. 86 Abs. 1, Abs. 2 AEUV.
42
Gesetzgebungskompetenzen im Bereich polizeiliche Zusammenarbeit bestehen für Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben für die mitgliedstaatlichen Behörden.85 Hier geht es um die Gewinnung und Verarbeitung von Informationen, Art. 87 Abs. 2 lit. a AEUV, die Unterstützung in der Aus- und Weiterbildung, die Zusammenarbeit beim Personalaustausch sowie im Hinblick auf Ausrüstungsgegenstände und die kriminaltechnische Forschung, Art. 87 Abs. 2 lit. b AEUV, und gemeinsame Ermittlungstechniken zur Aufdeckung schwerwiegender Formen organisierter Kriminalität, Art. 87 Abs. 2 lit. c AEUV.
43
Eine Intensivierung der operativen polizeilichen Zusammenarbeit ermöglicht Art. 87 Abs. 3 AEUV. Bislang erfolgt die operative Zusammenarbeit insbesondere im Wege der grenzüberschreitenden Observation, der grenzüberschreitenden Nacheile, des Austauschs von Verbindungsbeamten, der Bildung gemeinsamer Ermittlungsgruppen und kontrollierter Lieferungen.86 Nun stellt die RL (EU) 2014/41 über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen Regelungen zur Beweiserhebung in grenzüberschreitenden Fällen zur Verfügung. Danach kann der Anordnungsstaat eine Ermittlungsanordnung erlassen, aufgrund derer der Vollstreckungsstaat zur Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen verpflichtet wird.87 Dabei gilt der GrundSatz der gegenseitigen Anerkennung, Art. 82 AEUV (dazu näher A.II.1.e.).
44
Die primärrechtliche Grundlage für die Tätigkeit von Europol findet sich seit dem Vertrag von Lissabon in Art. 88 AEUV. Danach hat Europol den Auftrag, „die Tätigkeit der Polizeibehörden und der anderen Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten sowie deren gegenseitige Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung der zwei oder mehr Mitgliedstaaten betreffenden schweren Kriminalität, des Terrorismus und der Kriminalitätsformen, die ein gemeinsames Interesse verletzen, das Gegenstand einer Politik der Union ist, zu unterstützen und zu verstärken“.
45
Die in Art. 16 Abs. 2 AEUV geschaffene Kompetenz für den Datenschutz und den freien Datenverkehr hat sich als (nicht unumstrittenes) Einfallstor für eine teilweise Harmonisierung des mitgliedstaatlichen sicherheitsrechtlichen Datenschutzrechts erwiesen (dazu ausführlich A.II.1.b.).88 Unter Rückgriff auf Art. 16 Abs. 2 AEUV hat die EU im Rahmen des sog. Europäischen Datenschutzpakets 2016/1889 mitgliedstaatliches Datenschutzrecht, insbesondere das der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden durch die DSRL-JI, teilharmonisiert.90
46
Inzwischen ist im RFSR ein komplexes europäisches Recht der inneren Sicherheit entstanden, ein Nebeneinander von nationalstaatlichem Recht, supranationalem Recht und Völkerrecht.91 Dies hat spürbare Auswirkungen in mehreren Rechtsbereichen, so z. B. im Staatsorganisationsrecht, bei den Grundrechten, im Polizeirecht, Strafprozessrecht oder Datenschutzrecht. So dürften etwa nach der Teilharmonisierung des Datenschutzrechts für die mitgliedstaatlichen Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden durch die DSRL-JI (s. dazu A.II.2.) die so geschaffenen mitgliedstaatlichen Normen künftig wohl z. T. an den Unionsgrundrechten zu messen sein. Auf eine Vollharmonisierung im Bereich der DSGVO hat das BVerfG Ende 2019 mit einer geradezu spektakulären Rechtsprechungsänderung reagiert: Es überprüft die Anwendung vollharmonisierten Rechts durch die deutsche Gewalt nun am Maßstab der Unionsgrundrechte (dazu näher A.II.2.c.). Auf die Kompetenzverteilung im Deutschen Bundesstaat hat die Rechtsentwicklung im RSFR ebenfalls Einfluss: Hier ist ein Trend zur „Entförderalisierung“92 durch Kompetenzverlust der Bundesländer zu verzeichnen, indem der Spielraum der Bundesländer für die Regelung des Polizeirechts durch europäische Regelungen verkleinert wird.93 Auf die Frage, wer die Gesetze vollzieht (Bund oder Länder), wirkt sich die zunehmende „Transnationalisierung“ ebenfalls aus: Denn Anlaufstellen für europäische Kooperationen sind meist Bundesbehörden, als zentrale Knotenpunkte internationaler Vernetzung der Polizeibehörden.94