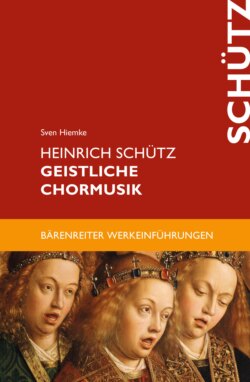Читать книгу Heinrich Schütz. Geistliche Chormusik - Sven Hiemke - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Überzeitlich Zwischen »alter« und »neuer Manier«
ОглавлениеModern waren sie nie. 1648 erschienen, zum Teil aber schon deutlich früher komponiert, galten die Motetten der Geistlichen Chormusik von Heinrich Schütz manchem Zeitgenossen schon bei ihrer Veröffentlichung als unzeitgemäß. Wie viel fortschrittlicher waren doch die vokalen Concerti mit Generalbass! Schütz selbst freilich beabsichtigte mit der Sammlung keineswegs, einen Beitrag zu einem antiquierten Genre vorzulegen. Sein erklärtes Ziel war es vielmehr, Werke bereitzustellen, die sich mit der Empfehlung für angehende Komponisten verbanden, sich durch das Studium dieses Kompendiums zunächst »das rechte Fundament eines guten Contrapuncts« anzueignen, um nicht dereinst Motetten produzieren zu müssen, die manchem unbedarften Hörer vielleicht vorkämen wie eine »himmlische Harmoni«, von Zeitgenossen mit »recht gelehrten Ohren« allerdings nicht höher eingeschätzt würden als eine »taube Nuß« (vgl. den originalen Wortlaut und seine Übertragung in heutiges Deutsch im Anhang dieser Werkeinführung).1
Dem alten Mann will die neue Musik nicht schmecken? Schütz sah die Gefahr eines solchen Verdikts durchaus. Anfang 1651 berichtete der 65-Jährige seinem Dienstherrn, dem sächsischen Kurfürsten Johann Georg I. (1585–1656), von einem »mir wol bekandten, nicht übel qvalificirten Cantor«, dessen »junge Ratsherren mit seiner alten Manier der Music, sehr übell zufrieden, und dahero seiner sehr gerne loos weren«. Und weil die junge Generation überhaupt der »alten Sitten und Manier bald pfleget überdrüssig zu werden«, könne ihm, Schütz, »auch derogleichen […] wol von etlichen New anko[mm]enden Jungen Musicanten selbst wiederfahren, welche mit hindansetzung der alten, gemeiniglich Ihre newe Manier, wie wol mit schlechtem grunde, pflegen hervor zu ziehen«.2 Schütz’ Protest findet hier eine entscheidende Differenzierung: Nicht die »newe manier« schlechthin ist Gegenstand der Kritik, sondern Beiträge »mit schlechtem grunde« werden angeprangert – jene Werke also, die das kompositorische Rüstzeug ihrer Urheber vermissen ließen. Dieser Unkenntnis setzt |11| Schütz die Motetten der Geistlichen Chormusik entgegen, in denen er die »nothwendigen Requisita« für qualitätvolles Komponieren in praktischen Beispielen vorführt.
Innovativ zu nennen ist Schütz’ Œuvre freilich nicht. Gewiss: Der Dresdner Hofkapellmeister rühmte sich zu Recht, den konzertierenden Stil samt Basso continuo, der durch den kontrastierenden Wechsel heterogener Klanggruppen charakterisiert ist, in Deutschland eingeführt zu haben. Und wohl hatte Schütz nach seiner lateinischsprachigen Motettensammlung Cantiones sacrae (Dresden 1625) nur noch Werke in diesem Stil geschaffen. Monodische Werke aber – instrumentalbegleitete Einzelgesänge, die von der italienischen Oper inspiriert waren und ihre Attraktivität aus einer affektiven Textdarstellung bezogen, ohne an eine bestimmte Form gebunden zu sein – finden sich bei Schütz nur am Rande; Instrumentalmusiken und Beiträge in modischen Genres, etwa Tanz- und Generalbasslieder, fehlen in seinem Schaffen völlig. Mustergültige Beispiele für Werke in »newer Manier« bieten im zeitlichen Umfeld der Geistlichen Chormusik allerdings die Symphoniae sacrae: Hier, in diesen Concerti mit obligaten Instrumentalstimmen in kleiner (Teil II, 1647) und großer Besetzung (Teil III, 1650), mit oft virtuosem Melos der Singstimmen und durchgängigem Basso continuo, lieferte Schütz den Nachweis, durchaus kein gealterter Meister mit antiquierten Vorstellungen zu sein.
Dass der über 60-jährige Komponist seinen Symphoniae sacrae II ein Verzeichnis seiner bisher im Druck erschienenen Werke beifügte und diesen rückwirkend die Opuszahlen 1 bis 9 zuordnete,3 steht hierzu nicht im Widerspruch, sondern lässt angesichts seines vergleichsweise hohen Lebensalters und jahrzehntelangen Wirkens als kursächsischer Hofkapellmeister auf das Bedürfnis schließen, sein Lebenswerk mit abschließenden Publikationen in den jeweiligen Gattungen abzurunden. Zu diesem Vorhaben passen sowohl Schütz’ wiederholte Gesuche um Entlassung aus den Diensten des Kurfürsten (denen dieser allerdings nie entsprach) als auch die wiederholte Ankündigung, seine »unterschiedliche[n] angefangene[n] Musicalische[n] Wercke zu colligiren und completiren«, also zusammenfassen und ergänzen zu wollen.4 Diese Absichtserklärung auf die Opera 10 bis 12 zu beziehen, bietet sich aufgrund der Veröffentlichungen der Sammlungen in dichter zeitlicher Folge an, zumal sich in ihnen tatsächlich nicht nur neue, sondern auch früher entstandene Kompositionen finden.5 Was die Geistliche Chormusik betrifft, sind allerdings nur für zwei Motetten daraus definitive Nachweise von Frühfassungen zu erbringen:
|12| für die Vertonung des 19. Psalms, »Die Himmel erzählen die Ehre Gottes« SWV 386 (Nr. 18), die in einer Frühfassung aus der Mitte der 1630er-Jahre vorliegt (SWV 455). Schütz übersandte das Werk gemeinsam mit anderen Kompositionen an die Kasseler Hofkapelle.6
für die sechsstimmige Motette »Das ist je gewisslich wahr« SWV 388 (Nr. 20), deren erste Version (SWV 277) als Begräbnismusik für den mit Schütz befreundeten Thomaskantor Johann Hermann Schein († 19. November 1630) erklungen und bereits als Einzeldruck erschienen war (Dresden 1631).
Verschiedene Spekulationen machen allerdings noch für einige weitere Motetten der Geistlichen Chormusik eine frühere Entstehungszeit plausibel:
Die Motetten »Waß mein Gott will. à 6« und »Du Schalcksknecht à 7« von »H. S.« gehörten in dieser Zeit ebenfalls zum Kasseler Inventar. Dass es sich hierbei um Frühfassungen der gleichnamigen und identisch besetzten Motetten Nr. 24 und Nr. 29 der Geistlichen Chormusik handelt, ist nicht zu belegen, weil die »Kasseler Versionen« nicht erhalten sind. Die Annahme einer Analogie zu »Die Himmel erzählen die Ehre Gottes« liegt freilich nahe.7
»Verleih uns Frieden genediglich &c. auff besondere Melodey in die Lauten und Clavicymbel von 5. Sängern«: Diese Musik erwähnt der Oberhofprediger Matthias Hoë von Hoënegg (1580–1645) in einem Bericht über die Jahrhundertfeier der Reformation, die vom 31. Oktober bis 2. November 1617 in Dresden stattfand und deren musikalische Ausgestaltung in den Verantwortungsbereich des erst wenige Monate zuvor neu eingesetzten Hofkapellmeisters des sächsischen Kurfürstentums fiel.8 Es ist gut möglich, dass es sich hierbei um eine Frühfassung jener fünfstimmigen Motette handelt, die Schütz über 30 Jahre später in seine Geistliche Chormusik (Nr. 4) aufnahm.9
Entstehung und Erstaufführung der Motetten »Unser keiner lebet ihm selber« (Nr. 6) und »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« (Nr. 25) – auch sie gegebenenfalls in frühen Fassungen – stehen vielleicht im Zusammenhang mit den Bestattungsfeierlichkeiten für Schütz’ Ehefrau Magdalena (* 1601), die am 6. September 1625 an der Pest gestorben war: Beide Texte waren (neben anderen) Grundlage der Leichenpredigt, die Matthias Hoë von Hoënegg hielt, nachdem Magdalena Schütz, die »etliche Wochen vor ihrem Ende geahnet hat, daß unser Herr Gott sie bald abfordern würde […], etliche Lieder, die man ihr bey ihrem Begräbniß zu guter Letz singen sollte«, bestellt hatte.10 Sofern Schütz die |13| Worte, die seine Ehefrau sich gewünscht hatte, tatsächlich zu diesem Anlass und als Motetten vertont hat, ist nicht ausgeschlossen, dass ihre spätere Platzierung an die 6. und 25. Stelle der Geistlichen Chormusik auf das Sterbedatum Magdalenas verweisen und damit an die ursprüngliche Bestimmung dieser Werke erinnern sollte.11
In den ersten vier Takten der Motette »Ich bin ein rechter Weinstock« (Nr. 21) werden die beiden Singstimmen von einem selbstständig geführten Generalbass begleitet. Schütz’ Auskunft indes, die Geistliche Chormusik sei ihrer Idee nach ein »Wercklein ohne Bassum continuum«, macht es unwahrscheinlich, dass er das Stück speziell für diese Sammlung komponierte.
Im Trauergottesdienst für den Geraer Fürsten Heinrich Posthumus Reuß (1572–1635), für den Schütz die Musicalischen Exequien (Dresden 1636) komponierte, erklang nach deren erstem Teil auf Wunsch des Verstorbenen das Lied »Herzlich lieb hab ich dich, o Herr« – vielleicht in Verbindung mit jener Motette, die als Nr. 19 in die Geistliche Chormusik einging?
Festzuhalten bleibt, dass die Motetten der Geistlichen Chormusik nicht alle in dem gleichen Zeitraum und in einzelnen Fällen schon lange vor ihrer Veröffentlichung entstanden sind.
In dem inhaltsreichen Vorwort zu seiner Motettensammlung bekundete Schütz u. a. seine Absicht, ein Lehrwerk vorzulegen, das die elementaren Prinzipien des Komponierens anhand praktischer Beispiele veranschaulichte. Diesem Ziel diente offenbar auch die Aufnahme eines Werkes, das gar nicht von Schütz selbst stammt: der Motette »Der Engel sprach zu den Hirten« (Nr. 27), der deutschsprachigen Version einer Motette von Andrea Gabrieli, deren Originalfassung »Angelus ad pastores ait« in der Sammlung Concerti di Andrea, et di Gio. Gabrieli (Venedig 1587) erschienen war und die hier nun, in der Geistlichen Chormusik, als ein Beispiel aus dem Repertoire der alten »Classici Autores« fungierte. Zu diesen sind unter anderem jene Komponisten zu zählen, die der Schütz-Schüler Christoph Bernhard (1628–1692) als exemplarische Vertreter des »Stylus antiquus« benannte: Palestrina, Adrian Willaert, Josquin Desprez, Nicolas Gombert – und eben die beiden Gabrielis.12
Verbirgt sich hinter Schütz’ gleichzeitiger Empfehlung zum Studium auch der »Newen Classicos Autores« also der Anspruch, selbst ein solcher zu sein? Schütz wehrte diese Vermutung entschieden ab: Gegen die (nie erhobene) Unterstellung, »dieses oder [ein] eintziges meiner ausgelassenen Musicalischen Wercke […] iemand zur Information oder gewissen Modell |14| vorstellen und recommendiren« zu wollen, wolle er »öffentlich protestiret« haben. Die im barocken Schrifttum verbreitete Figur der »Captatio benevolentiae«, des »Erheischens von Wohlwollen« durch Höflichkeits- und Bescheidenheitsgesten, ist hier rhetorisch brillant umgesetzt – die Aussage selbst aber weithin unglaubhaft: Mit dem Insistieren auf der Notwendigkeit für angehende Tonsetzer, sich zunächst in der Vokalpolyphonie zu üben (und damit »kontrapunktisch« denken zu lernen), signalisierte Schütz dem Leser seiner »Vorrede« eindeutig, in der Geistlichen Chormusik eine Beispielsammlung für die mustergültige Anwendung der »zu einer Regulierten Composition nothwendigen Requisita« vorzufinden. Mit diesem impliziten Anspruch aber präsentierte der Komponist sein Kompendium von vornherein als eine Zusammenstellung nicht nur von Motetten-, sondern von Modell-Kompositionen und insofern als ein veritables »Exemplum classicum«, das ein vielfältig schillerndes Panorama an Satztechniken bot.
Viele Motetten der Geistlichen Chormusik leben noch von den musikalischen Errungenschaften der italienischen Vokalpolyphonie, wie sie Andrea und Giovanni Gabrieli gepflegt hatten: antiphonale Wechsel von Stimmgruppen, blockhaft-akkordische Höhepunkte, auch instrumentale Techniken und rhythmische Innovationen. Andere Motetten der Geistlichen Chormusik wurzeln in ihrem polyphonen Fluss noch in der Renaissance, wiederum andere stehen mit ihren vielen Imitationen von kleinen, oft wortgezeugten Motiven der Monodie nahe. Fast scheint es, als habe der Dresdner Hofkapellmeister demonstrieren wollen, dass alle Stile – jene aus Italien ebenso wie solche aus dem franko-flämischen Raum und von deutschen Meistern – zu einer unerschöpflichen Inspirationsquelle werden konnten, sofern der Komponist nur über das kompositorische Rüstzeug, über die »nothwendigen Requisita«, verfügte.
Die These, Schütz habe sich als ein Vertreter der »Newen Classici« verstanden, könnte auch erklären, warum er darauf verzichtete, ein Werk Giovanni Gabrielis in die Geistliche Chormusik aufzunehmen. Im Widmungstext seiner Symphoniae sacrae I (Venedig 1629) hatte Schütz seinem Lehrer emphatisch gehuldigt: »Ach Gabrieli, Ihr unsterblichen Götter, was für ein Mann!«;13 hier aber störte offenbar die Assoziation zu Gabrielis Sacrae symphoniae (Venedig 1597), deren Titel Schütz für gleich drei Sammlungen adaptierte, die für ein Kompendium mit deutschsprachigen Motetten aber keinen Bezugspunkt boten. Auch der zeitliche Abstand zwischen den »alten Classicos Autores« und ihm selbst war mit der Integration eines Werkes von Giovanni Gabrielis Onkel Andrea in die eigene Sammlung sinnfälliger.