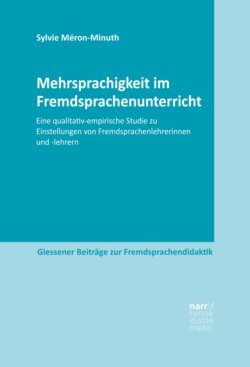Читать книгу Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht - Sylvie Méron-Minuth - Страница 22
2.6.3 Interkomprehensionsforschung
ОглавлениеDie Didaktik der Interkomprehension repräsentiert ein recht junges, innovatives Forschungs- und Praxisfeld, das in der Debatte der (Fremd-)sprachendidaktik um die Förderung der Mehrsprachigkeit in Europa zu Beginn der 1990er Jahre aufgetaucht ist (vgl. Doyé 2005; Ollivier & Strasser 2013). Dieses Forschungsfeld entwickelte sich im europäischen Rahmen (man findet auch das Konzept der Eurokomprehension vor; vgl. Meißner 2004), um das bildungspolitische Ziel der europäischen Union zu erreichen. Das Konzept der Interkomprehension geht auf seinen Urheber, den französischen Linguisten Jules Ronjat zurück, der 1913 dieses Konzept (Französisch: intercompréhension) in seinem Buch zur Syntax der provenzalischen Dialekte « Essai de syntaxe des parlers provençaux modernes » erstmals verwendete. Ronjat begründet den Begriff in der Annahme, dass Sprecher verschiedener provenzalischer Varietäten sich gegenseitig ausgezeichnet verstehen würden, und somit der Eindruck gewonnen werden könnte, dass es um dieselbe Sprache ginge, die lediglich anders ausgesprochen würde. Nach der erstmaligen Prägung des Begriffs der Interkomprehension durch Ronjat wurde das Grundprinzip immer weiter verfeinert und später einige Projekte zur Förderung der europäischen Mehrsprachigkeit durchgeführt, wie per exemplum im skandinavischen Raum (vgl. nähere Ausführungen dazu in: Ollivier & Strasser 2013: 11–15).
Die Interkomprehensionsdidaktik stößt auch in Deutschland seit über zwei Jahrzehnten auf ein reges Interesse, welches sich in zahlreichen Projekten und Publikationen niederschlägt (vgl. z.B. Klein & Stegmann 2000; Schöpp 2008; Bär 2004, 2009; Meißner 2004, 2005, 2008; Mordellet-Roggenbuck 2015; Prokopowicz 2017). Dennoch hat sie nur in wenigen Bundesländern Eingang in Curricula und Lehrpläne gefunden und wird demzufolge auch nur zögernd in die Unterrichtspraxis einbezogen (Ollivier & Strasser 2013). Interkomprehension ist eine Kommunikationsmethode, die einen neuen Ansatz für das Sprachenlernen darstellt. Allerdings zeigt dieser Begriff in der Fülle der existierenden Definitionen, dass er weitgehend diffus und vielschichtig zu betrachten ist, und nicht immer eine allgemeingültige, einheitliche Definition durch die Forscherinnen und Forscher erfährt (vgl. z.B. Klein 2000, 2004; Klein & Reissner 2002; Meißner 2000, 2004, 2007; Ollivier & Strasser 2013: 9f.).
Klein und Reissner (2002) verstehen unter Interkomprehension die Fähigkeit, in einer Gruppe von Sprachen, die einen gemeinsamen Ursprung haben, kommunizieren zu können (Klein & Reissner 2002: 19).
Für Doyé (2005) bedeutet Interkomprehension, dass zwei Sprecherinnen und Sprecher verschiedener Erstsprachen miteinander kommunizieren und unter Verwendung ihrer jeweiligen Sprache interagieren und sich verstehen können, so wie er dies mit folgendem Zitat zu veranschaulichen trachtet:
« L’intercompréhension est une forme de communication dans laquelle chaque personne s’exprime dans sa propre langue et comprend celle de l’autre. » (Doyé 2005: 7)
Die Vorteile dieser Positionierung liegen darin, dass Doyé die gesprochene und geschriebene Sprache miteinschließt und die aktive Nutzung der Zielsprache ausschließt. Hierbei gibt es zwei Aspekte; Ersterer ist die Performanzebene, die sich auf die Aktivität zweier Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen bezieht, die kommunizieren, indem sie ihre eigene Sprache sprechen und die des jeweiligen Anderen verstehen. Der zweite Aspekt ist die Kompetenzebene, die sich auf die Fähigkeit bezieht, eine andere Sprache zu verstehen, ohne sie gelernt zu haben (vgl. Doyé 2005: 7; Übersetzung durch die Verfasserin).
Meißner (2009) und gleichermaßen Meißner, Tesch und Vázquez (2011) erfassen hingegen Interkomprehension als:
„[…] die Fähigkeit und den Vorgang, eine sprachliche Varietät oder eine Sprache zu verstehen, ohne sie in zielsprachlicher Umgebung auf natürliche Weise erworben oder mittels Fremdsprachenunterricht erlernt zu haben.“ (Meißner; Tesch & Vázquez 2011: 81)
Mit dieser Auffassung sehen Meißner, Tesch und Vázquez die Interkomprehension somit als rezeptive Kompetenz, bei welcher das Verstehen von Sprachen für den Kommunikationspartner, die er entweder gar nicht oder jedenfalls nicht produktiv gelernt hat, im Vordergrund steht. Marcus Bär et alii (2005: 84), die die Interkomprehension ebenfalls als die Befähigung auffassen, „[…] eine fremde Sprache lesend oder hörend zu verstehen, ohne sie formale erlernt zu haben“, fügen hinzu, dass es sich um Sprachvarietäten innerhalb derselben Sprachfamilie handelt:
„Nicht nur Varietäten (Dialekte, Soziolekte) einer und derselben Sprache […] füreinander interkomprehensiv, sondern weitgehend auch nah miteinander verwandte Sprachen.“ (Bär; Gerdes; Meißner & Ring 2005: 84)
Die Interkomprehension stellt somit eine Methode zum Erwerb rezeptiver Kompetenzen in allen romanischen, germanischen und slawischen Sprachen dar, auf denen anschließend aufgebaut werden kann. Sie geht von der Beobachtung von Verstehenspotenzialen zwischen Kommunikationspartnerinnen und -partnern der drei genannten großen europäischen Sprachgruppen aus (vgl. Meißner 2004; Doyé 2008; Reissner 2007 und 2011).
Klein und Stegmann (2000) heben drei essenzielle Zielsetzungen für die Interkomprehension hervor:
1 Es ist die Methode, um eine wirkliche Sprachendiversifizierung im Schul- und Bildungssystem Europas realistisch möglich zu machen.
2 Es ist die Methode, um Sprachenkompetenzdiversifizierung zu erreichen und den Erwerb breitgestreuter rezeptiver Kompetenzen als besonders europarelevant aufzuwerten.
3 Es ist die Methode, um kleinen und Minderheitensprachen Europas erstmalig ein Minimum an Präsenz im gesamten europäischen Schulsystem einräumen zu können. (Klein & Stegmann 2000: 9; Hervorhebungen im Text)