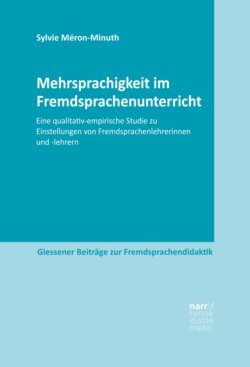Читать книгу Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht - Sylvie Méron-Minuth - Страница 23
2.6.4 Der EuroComRom-Ansatz und seine Umsetzung
ОглавлениеDas von der Europäischen Union geförderte Forschungsprojekt EuroCom steht im engen Verhältnis zur Mehrsprachigkeitsdidaktik und stützt sich auf Forschungen zur europäischen Interkomprehension. Das Projekt, das 1998 in Hagen von der Forschergruppe EuroCom gegründet wurde, nimmt sich die sprachenpolitischen Bestrebungen der europäischen Union von 1995 zum Vorbild und hat dabei die Intention, eine rezeptive Mehrsprachigkeit, vorerst für die romanischen, später für die slawischen und die germanischen Sprachen auszubilden (vgl. Klein 2002: 29).
Die Romanisten Horst G. Klein und Tilbert D. Stegmann der Universität Frankfurt am Main entwickelten in der Folge den Ansatz EuroComRom, der es ermöglicht, in allen romanischen Sprachen simultan rezeptive Kompetenzen bzw. Teilkompetenzen in einer oder mehreren verwandten Fremdsprachen zu erlangen und somit langfristig mit Hilfe der Interkomprehension1 einen produktiven Umgang mit Fremdsprachen zu schaffen. Primäres Ziel der Forschergruppe EuroComRom ist es, einen qualitativen Sprung bei der Förderung europäischer Mehrsprachigkeit zu erreichen. Hierbei soll den Lernenden eine rezeptive Kompetenz innerhalb einer Sprachfamilie durch interlinguale Lese- und Hörkompetenz vermittelt werden, die als Einstieg in das Lernen einer neuen Sprache2 nutzbar gemacht werden kann. Dem Lernenden wird somit verdeutlicht, dass er durch die Kenntnis seiner Muttersprache und lediglich einer Brückensprache bereits eine unerwartete Vielzahl von Kenntnissen mitbringt, um beispielsweise Nachrichten- oder noch Fachtexte in allen typologisch verwandten, aber noch nicht erlernten Sprachen in kürzester Zeit verstehen zu können. Weitere, über das Lese- und Hörverstehen hinausgehende Kompetenzen lassen sich daraus höchst lernökonomisch und nach eigenem Bedarf beschleunigt entwickeln (vgl. Klein 2006).
Darin sieht sich dieses methodische Vorgehen als komplementär zum konventionellen schulischen Sprachen- und Sprachenlernangebot (vgl. Klein & Stegmann 1999: 11). Denn im Vergleich zum traditionellen Fremdsprachenunterricht aktiviert EuroComRom vorhandene, ungenutzte Kompetenzen der Lernenden. Darin liegt der große Unterschied beim Erlernen neuer Sprachen zum konventionellen Fremdsprachenunterricht. Der Lernende wird sprachlich nicht als völlig „unbeschriebenes Blatt“ angesehen, sondern es wird damit begonnen, ihm zu verdeutlichen, was er aus einem einfachen Gebrauchstext in der neuen Sprache schon alles entziffern kann. Strategien zur Erleichterung und Beschleunigung der Anfangsphase von Sprachlernprozessen werden erarbeitet und somit ein früher Übergang zu Nachbarsprachen ermöglicht. Während im konventionellen Anfangsunterricht Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit verbessert werden und darauf geachtet wird, dass die Lernenden möglichst alles korrekt wiedergeben, so verfolgt EuroComRom das Ziel, jede annäherungsweise richtige Erschließungsleistung zu verstärken, und somit das Erlernen anderer Sprachen in einem neuen Kontext zu erfahren. Fehler werden bei dieser Methode neu bewertet. Durch Versuch und Irrtum gelangt der Lerner zu einer neuen Stufe der eigenen Reflexion über Sprachlernprozesse. Damit kann einer Entmutigung auf Seiten der Lernenden entgegengewirkt werden. EuroComRom setzt realistische sprachliche Nahziele und vermeidet einen illusionären Perfektionismus. Vielmehr soll ein Mehr an Teilkompetenzen in vielen Sprachen erreicht werden (vgl. Klein & Stegmann 2000: 13). Zudem wird dem Lernenden aufgezeigt, dass Sprachenlernen machbar ist, wo eine Sprachverwandtschaft besteht. Dies lässt sich innerhalb der Sprachfamilien sehr gut verdeutlichen. Sprecherinnen und Sprecher einer europäischen Sprache besitzen bereits ein sehr breit gefächertes Wissen über die meisten anderen europäischen Sprachen. EuroComRom will aufzeigen, dass Nachbarsprachen keine Fremdsprachen darstellen. Lernende sollen das linguistische Wissen, das sie bereits besitzen, nicht ungenutzt lassen und durch Analogieschlüsse und Nutzung der Logik des Kontextes Unbekanntes erschließen. Hierzu vermittelt EuroComRom transferierbare Erschließungsstrategien und bedient sich der „Sieben Siebe“. Dabei handelt es sich um von Klein und Stegmann (1999) entwickelte linguistische Transferbasen, nach denen der Lerner aus fremdsprachlichen Texten alle verständlichen Elemente (Lexeme und Satzstrukturen) zur Dekodierung herausfiltert und sieben Mal auf Bekanntes hin durchsiebt (vgl. Klein & Stegmann 2000: 13). Das erste Sieb umfasst den internationalen Wortschatz, der in zahlreichen europäischen Sprachen aufgrund der gemeinsamen lateinischen Basis ähnlich ist. Dass der internationale Wortschatz als erstes Sieb steht, ist darauf zurückzuführen, dass er in einem fremdsprachigen Text am einfachsten zu dekodieren ist. Das zweite Sieb schließt den panromanischen Wortschatz ein, demzufolge Lexeme, die in allen romanischen Sprachen auftreten und die ihnen gemeinsam sind. Sofern der Lerner Kenntnisse einer romanischen Sprache aufweist, ist er in der Lage, diesen Gewinn für andere Sprachen heranzuziehen und Wortschatz zu entschlüsseln. Das dritte Sieb untersucht die Lautentsprechungen und ist für die Dekodierung förderlich, da viele häufig auftretende Lexeme vordergründig nicht lexikalisch verwandt zu sein scheinen, dadurch dass sie im Laufe der Sprachgeschichte Modifizierungen durchlaufen haben. Demnach filtert das dritte Sieb Lautentsprechungsformeln, damit der Lerner die Gemeinsamkeiten deutlich erkennt. Das dritte Sieb steht inhaltlich in enger Verbindung mit dem vierten Sieb, den Graphien und Aussprachen, da häufig gleiche Laute unterschiedlich geschrieben und gesprochen werden. Des Öfteren begegnet der Lerner Schwierigkeiten beim Dechiffrieren von Wörtern aufgrund einer divergenten Schreibweise, beziehungsweise einer unterschiedlichen Aussprache. Aus diesem Grund muss er den Zusammenhang zwischen Graphie und Aussprache erfassen, um Wortverwandtschaften aufdecken zu können. Das fünfte Sieb bezieht sich auf die panromanische Syntax. Es existieren neun in allen romanischen Sprachen vorherrschende Kernsatztypen, deren Kenntnis vor allem bei einer komplexen Syntax dienlich ist. Durch das Wissen um die syntaktischen Strukturen kann rasch konstatiert werden, ob ein Wort ein Verb, ein Adjektiv oder noch ein Substantiv ist. Das sechste Sieb ergründet die morphosyntaktischen Elemente wie grammatische Phänomene, z.B. Steigerungsformen, Artikel oder Pluralmarkierungen. Dabei handelt es sich vor allem um Konvergenzen innerhalb der lebenden romanischen Sprachen, die das Lateinische nicht aufweist. Das siebte und letzte Sieb filtert schließlich Präfixe und Suffixe. Diese befähigen den Lerner, den Sinn zusammengesetzter Wörter durch Isolierung vom Wortstamm zu entschlüsseln (vgl. Klein & Stegmann 2000: 13ff.).
Diese interkomprehensive Vorgehensweise wird auch als optimiertes Erschließen bezeichnet und berücksichtigt jede Art des Vorwissens. Die Reihenfolge des Durchlaufens der einzelnen Siebe ist beliebig (vgl. Klein & Reissner 2002). Die dargelegten Erschließungsleistungen sollen, langfristig gesehen, zu einer Optimierung der Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Fremdsprachen führen (vgl. Klein & Stegmann 2000: 19). Die Methode fördert dadurch den Erwerb einer allgemeinen Sprachlernkompetenz. Des Weiteren kann EuroComRom die kulturelle Vielfalt Europas in ihren Zusammenhängen begreifbar werden lassen und durch das Behandeln authentischer Texte zu einem besseren interkulturellen Verständnis führen. Ein weiteres Ziel ist es, den Minderheitensprachen Europas, die oftmals wenig Aufmerksamkeit erfahren, ein Minimum an Präsenz im aktuellen Diskurs über die Mehrsprachigkeit der europäischen Bürgerinnen und Bürger zuzusprechen. Dabei lässt sich meist ohne zusätzlichen Sprachlernaufwand das Verständnis und Kennenlernen der oftmals benachteiligten Minderheitensprachen, die in ihrem Verbreitungsgebiet meist Mehrheitssprachen sind, erreichen. EuroComRom hat deshalb konsequent neben den großen Sprachen Französisch, Spanisch, Italienisch auch das Portugiesische, das Katalanische und das Rumänische integriert und macht es möglich, auf dieser Basis auch Texte in anderen romanischen Sprachen zu verstehen (vgl. Klein & Stegmann 2000; Klein 2006: Anmerkung 8).