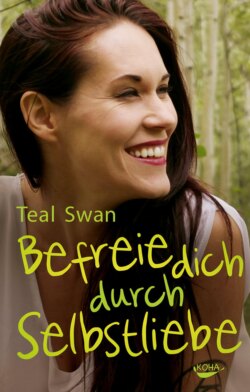Читать книгу Befreie dich durch Selbstliebe - Teal Swan - Страница 10
ОглавлениеKapitel 3
Meine erschütternde Reise zur Selbstliebe
In meinem selbst gemachten Gefängnis
Schließlich erzählte ich Blake die ganze Geschichte meiner Kindheit, von Doc und den Kulten; daraufhin engagierte er sich noch mehr in meinem Heilungsprozess. Als ich sicher bei Blake angekommen war und mich bei ihm verstecken konnte, wusste ich, dass weder Doc noch ein anderes Sektenmitglied nach mir suchen würde, denn das hätte gegen die Regeln des »Bondings« und der »Call Back«-Programmierung verstoßen, die sie mir über die Jahre eingepflanzt hatten. Wenn sie nach mir hätten suchen müssen, wäre das für sie ein Manko gewesen und hätte auch bedeutet, dass ich die Kontrolle hatte. Sie verließen sich darauf, dass ich aufgrund meiner Programmierung willig wie ein entlaufener Hund zu ihnen zurückkommen würde. Aber das tat ich nicht. Langsam eroberte ich mir Schritt für Schritt mein Leben zurück. Bestimmte Leute und Aktivitäten halfen mir, zum ersten Mal so etwas wie Selbstwertgefühl zu entwickeln; das war allerdings keineswegs einfach und unkompliziert.
Ein paar Jahre nach meiner Flucht wurde gegen Doc ein Verfahren eröffnet. Doch wie bei so vielen Missbrauchsfällen war inzwischen für mich zu viel Zeit vergangen, sodass körperlich kaum noch etwas nachzuweisen war. Es gab weder greifbare Beweise noch Zeugen, und so wurde der Fall von der Bezirksstaatsanwaltschaft aufgrund mangelnder Beweise fallen gelassen. Zusätzliche Beweise oder Zeugen wären nötig gewesen, damit der Fall wieder vor Gericht hätte kommen können.
Man könnte meinen, die Geschichte wäre damit zu Ende. Doch körperlich einer Situation zu entkommen ist keineswegs das Ende des Heilungsweges; diese Straße geht noch sehr viel weiter. Ich war zwar der Kontrolle meines Peinigers entronnen, aber ich war nach wie vor nur eine leere Hülle. Ich hatte kein eigenes Leben, sondern nur die Bruchstücke eines Lebens, wie es hätte sein können. Als junge Frau hatte ich keine Ahnung, wie ich mich in der Gesellschaft zurechtfinden konnte. Ich war nicht »lebenskompetent«, litt unter schweren posttraumatischen Belastungsstörungen und war voller Selbsthass.
In Wirklichkeit war mein Peiniger durch meine Flucht keineswegs verschwunden; vielmehr setzte er sich in meinem Kopf fest, und ich führte das Muster des Missbrauchs selbst weiter. Ich war süchtig nach Ritzen und nach wie vor selbstmordgefährdet. Fast jede Entscheidung, die ich damals bezüglich meines Lebens traf, diente der Selbstsabotage und nicht der Selbstliebe. Ich war davon überzeugt, ich müsste mich selbst missbrauchen, sonst würde das Schlechte in mir über das Gute siegen und ich würde ein genauso schlimmer Mensch werden wie die Peiniger meiner Kindheit. Ich glaubte wirklich, dass der einzige Unterschied zwischen ihnen und mir ledigleich in meiner Selbstbestrafung bestand.
Blake, der für die ersten Schritte meines Heilungsprozesses eine so entscheidende Rolle spielte, wurde zu meiner rechten Hand, als ich mir eine berufliche Zukunft aufbaute. Wir haben eine Firma und eine Non-Profit-Organisation gegründet und helfen heute gemeinsam Menschen in aller Welt, positive Veränderungen zu bewirken. Der Weg dahin war jedoch sehr weit, und die Reise in mein neues Leben war alles andere als einfach. Ich musste eine Möglichkeit finden, mich selbst zu lieben. In diesem Buch stelle ich ein Toolkit, also einen »Werkzeugkasten«, mit Techniken und Methoden vor, mit deren Hilfe ich mein Leben verändern konnte.
Durch Therapie zu einem neuen Leben
Mit 21 wurde ich zu einer Therapie gezwungen, und zwar von einem Mann, mit dem ich zusammen war und der es einfach nicht mehr schaffte, mit mir eine stabile Beziehung zu führen. Die Nachwirkungen des Missbrauchs in meiner Kindheit machten das gar zu schwer. Er sah mich an und sagte: »Das ist einfach nicht normal; was du mitgemacht hast, ist nicht normal, und das musst du verstehen. Ich bleibe nur mit dir zusammen, wenn du dir professionelle Hilfe suchst.«
Er brachte mich zu einem Krisenzentrum für Vergewaltigungsopfer und sagte der Frau am Empfang: »Sie gehört hierher.« Die Direktorin wurde gerufen, sie führte mit mir ein Gespräch und fragte, warum mein Freund meiner Meinung nach wohl glaubte, ich sei hier am richtigen Platz. Ich öffnete mich und erzählte ihr von den Leiden meiner Kindheit. Ihr Gesicht wurde angespannt, und sie wurde ganz unruhig, als ich ihr nur ein paar wenige Einzelheiten mitteilte.
Sie versicherte mir, ich bräuchte tatsächlich ihre Hilfe, aber mit dem, wovon ich da sprach, seien sie und auch das Zentrum überfordert. Aber sie kannte eine Frau, die auf rituellen Missbrauch an Kindern spezialisiert war, und versprach, sie anzurufen und zu fragen, ob sie meinen Fall übernehmen würde.
Noch in derselben Woche traf ich mich zum ersten Mal mit der Expertin. Sie war äußerst warmherzig und liebevoll, ganz anders als die Psychologen, die ich sonst so gewohnt war. Diese Zuneigung und ihr großes Wissen über Traumabehandlung rissen alle meine Mauern ein, und gemeinsam mit ihr begann ich, mir ein neues Leben aufzubauen.
Durch die Therapie konnte ich irgendwann zugeben, dass ich den als Kind erlittenen Missbrauch nicht verdient hatte und keine Schuld daran trug. Doch mit 24 erkannte ich, dass ich das Ende dessen erreicht hatte, was durch Therapie möglich war. Ich wusste tief in mir, es musste noch etwas anderes geben als Mitleid oder das Gefühl, ein Opfer zu sein, mehr als den Versuch, mit meiner posttraumatischen Belastungsstörung fertig zu werden.
Von Ihrem Standpunkt als Leser aus betrachtet, klingt das vielleicht schrecklich, aber für mich war Selbstmord meine Ausstiegsstrategie. Ich lebte von einem Tag zum nächsten, indem ich mich immer wieder daran erinnerte, dass ich mich morgen ja umbringen könnte. Dadurch konnte ich mich auf das konzentrieren, was ich am jeweiligen Tag tun konnte, um mich besser zu fühlen. Und ich tat alles dafür. Mich wohlzufühlen wurde zur wichtigsten Sache meines Lebens.
Also stürzte ich mich in den Wintersport, übte mich als Köchin, fand Plätze, an denen ich in Sicherheit leben konnte, und begann mit dem Meditieren. Langsam veränderte sich mein Mantra von »Ich kann mich ja morgen umbringen, was mache ich also heute?« hin zu »Ich kann mich ja nächstes Jahr umbringen, was mache ich also in diesem Jahr?«.
Irgendwann erkannte ich, dass ich mich nicht mehr umbringen wollte. Ich hatte zwar nach wie vor mit Suizidneigungen zu kämpfen, aber die gingen vorüber und setzten sich nicht mehr dauerhaft in meinem Leben fest.
Nachdem ich dem Missbrauch entronnen war, wollte ich mit meinen übersinnlichen Fähigkeiten nichts mehr zu tun haben. Ich machte Wintersportwettkämpfe mit, um sie zu vermeiden. Ich versuchte, mich so gut wie möglich in der physischen Welt zu erden. Gelegentlich half ich mit meinen übersinnlichen Gaben zwar nach wie vor Leuten, wenn sie verzweifelt waren, aber für mich waren diese Fähigkeiten an all den Schmerzen schuld, die ich erdulden musste, und dass ich sie nicht loswerden konnte, war eine Qual für mich. Immer noch hatte ich furchtbare Angst vor der Welt.
Auf der Suche nach Liebe aus falschen Gründen
Weil ich mir Sicherheit und Fürsorge wünschte, heiratete ich mit 22 einen Mann, den ich nicht liebte. Diese Ehe ging in die Brüche und wurde nach sechs Monaten annulliert. Noch im selben Jahr heiratete ich ein zweites Mal, wieder aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus. Was mir damals nicht klar war: Ich benutzte die Männer, um zu versuchen, vor mir selbst wegzulaufen. Ich wollte in Sicherheit gebracht werden, nicht nur vor der Welt, sondern auch vor mir selbst. Innerlich war ich noch immer so voller alles durchdringendem Selbsthass, dass ich mir selbst nicht trauen konnte.
Mit 25 brachte ich meinen Sohn zur Welt. Nach einer Behandlung wegen Unfruchtbarkeit und drei Schwangerschaftsabbrüchen als Teenager hatte ich den verzweifelten Wunsch nach einem eigenen Kind und der damit verbundenen magischen Erfahrung. Doch ganz anders als in meiner Fantasie waren die Schwangerschaft und die Geburt extrem traumatisierend.
Es sollte ein Junge werden, und ich hatte mir vorgestellt, mein Sohn wäre eine körperlich aktive Sportskanone, ein begeisterter Sportler, der nie dieselben Schmerzen durchleiden müsste wie ich. Die Liebe zu meinem Sohn war mit keiner anderen Liebe in meinem Leben zu vergleichen. Doch zu meinem Entsetzen wurde er mit einer leuchtend klaren Aura geboren, die aussah wie ein prismatisches Kristalllicht. Solche Auras, aufgrund ihrer Farbe auch als Kristallaura bezeichnet, haben nur Menschen mit angeborenen übersinnlichen Fähigkeiten.
Und jawohl, wie meistens hatte mir das Universum genau das Kind geschenkt, das ich brauchte. 40 Minuten lang weinte ich, aus Angst, er würde wegen seiner Gaben genauso leiden wie ich. Doch dann dämmerte es mir: Wenn ich ihm beibrächte, seine angeborenen Fähigkeiten anzunehmen, müsste ich zunächst einmal meine eigenen Fähigkeiten akzeptieren.
Scrat und seine Eichel
Es war das Jahr 2009. Mein sechs Monate alter Sohn hielt gerade ein Schläfchen. Ich saß in meiner Küche auf dem Linoleumfußboden mit dem schwarz-weißen Schachbrettmuster und versank in Verzweiflung. Nachdem ich Mutter geworden war, hatte ich mich ins Land der Kinderunterhaltung gewagt und unter anderem den Film Ice Age gesehen. Darin kommt ein »Säbelzahneichhörnchen« namens Scrat vor, das ständig versucht, seine für ihn so kostbare Eichel zu finden und zu retten.
Scrat ist ständig auf der Jagd nach seiner Eichel, aber diese Jagd ist nie von Erfolg gekrönt. Immer wenn man meint, er hat sie endlich, schlägt das Unglück wieder zu, und durch irgendeine völlig unwahrscheinliche Wendung der Geschehnisse geht sie ihm wieder verloren. Scrat wird von Murphys Gesetz heimgesucht, welches einfach ausgedrückt lautet: Alles, was schiefgehen kann, geht schief, damit du nicht das bekommst, was du willst.
Als Vollzeitmutter fühlt man sich, als ob man statt eines Erwachsenengehirns Disneyland im Kopf hat. An jenem Tag saß ich also auf dem Küchenfußboden und musste immerzu an Scrat denken. So lustig die Figur Scrat auf der Leinwand bzw. dem Fernsehschirm auch war, für mich hatte sie einen schlechten Beigeschmack: Ich war tief bekümmert und identifizierte mich mit seinem Dilemma. Scrat – das war ich. Seine Eichel – das war das Glück, hinter dem ich herjagte. Mein Leben war nichts als eine endlose, unglückselige Suche nach Glück, und hier saß ich auf dem Fußboden und hatte ein Gefühl der Niederlage, weil das nie funktioniert hatte. »Warum ging es nie gut?«, fragte ich mich im Stillen. Ich kannte die Antwort: Weil ich mich nicht wollte. Die Haut, in der ich steckte, war für mich eine Gefängnisstrafe und nicht etwas, was ich mir ausgesucht hatte. Und ich dachte weiter: Wie soll ich mich auf etwas einlassen, das ich gar nicht will?
Ich bin, wo ich bin
Ich erkannte, dass ich mich seit Langem nicht mehr liebte, wenn ich mich überhaupt jemals geliebt hatte. Ich fühlte keine Selbstliebe und hatte nicht die leiseste Ahnung, wie das gehen sollte. Ich hasste die Vorstellung von Selbstliebe. In meiner Familie standen Selbstlosigkeit, Selbstaufopferung und Dienen an erster Stelle, und Selbstliebe fühlte sich wie etwas Schlechtes an – wie der Teufel, der das Gute in mir zerstören wollte und damit jede Chance, von jemand anderem geliebt zu werden.
Ich war ganz unten angekommen. So mussten sich Leute fühlen, deren Leben so jämmerlich und am Ende war, dass sie gar nichts mehr unternehmen konnten. Ich hatte mich in die Ecke manövriert. Alle meine Versuche, mich in meiner Haut wohlzufühlen, waren gescheitert. So wie jemand zugibt, Alkoholiker zu sein, gestand ich mir in diesem Moment ein, dass ich mich hasste.
Sich selbst einzugestehen, an welchem Punkt man steht, ist einerseits schmerzhaft und andererseits auch eine Erleichterung. Zu erkennen, dass man in sich einen Feind mit sich herumträgt, ist alles andere als lustig, aber gleichzeitig akzeptiert man durch dieses Eingeständnis auch etwas, was man jahrelang nicht wahrhaben wollte; dieser Widerstand ist sehr energieraubend. Gibt man das endlich zu, hat man das Gefühl, man würde endlich mit dem Strom schwimmen, nachdem man jahrelang gegen Stromschnellen angekämpft hat und gegen den Strom geschwommen ist. Mit dieser Erleichterung ging ein Entschluss einher: Ich müsste herausfinden, wie ich mich selbst lieben konnte. Dazu würde ich wirklich alles versuchen.
Anscheinend gab es dazu jede Menge Theorien. Leute, die Selbsthilfekurse oder -bücher anbieten, reden ständig von Selbstliebe, wissen aber meistens überhaupt nicht, was Selbstliebe wirklich bedeutet. Sie erzählen dir zwar den lieben langen Tag, dass du dich selbst lieben musst, und führen auch Gründe dafür an, ja sagen dir sogar, warum du liebenswert bist. Aber niemand lehrt, wie man sich selbst lieben kann und wie Selbstliebe in der Praxis aussieht.
Am Ende meiner Suche nach Selbstliebe war ich also noch frustrierter als am Anfang. Schließlich fragte ich mich: »Wodurch unterscheiden sich Menschen, die sich lieben, von Leuten, die das nicht tun?« Diese unterschiedlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen würden aufzeigen, was ich brauchte, um mich zu lieben.
Viele der stereotypen Selbsthilfetechniken zur Steigerung des Selbstwertgefühls funktionierten bei mir einfach nicht. Ich hatte das Gefühl, ich würde mit einem Teelöffel an einem Gletscher herumschaben. Affirmationen machten alles nur noch schlimmer. Ich saß am Küchentisch und probierte damit herum. Ich schrieb: »Ich liebe mich«, hundert Mal auf ein Blatt Papier und versuchte dabei, diese Worte auch zu fühlen. Doch mein Kopf sagte gleichzeitig: »Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich so dumm bin, oder?« Ich konnte den ganzen Tag lang die Worte »Ich liebe mich« wiederholen, aber sie waren und blieben eine Lüge. Doch noch im selben Jahr hatte ich meinen ersten Durchbruch mit der Selbstliebe.
Das Glas Wasser
Dank meiner übersinnlichen Fähigkeiten kann ich die Wirkung von Gedanken auf Dinge und die Wirkung der Frequenz einer Sache auf etwas anderes visuell sehen. Ich sehe buchstäblich, wie Gedanken wie »Ich werde niemals gut genug sein« direkt im Magenbereich Einzug halten und dort gesundheitliche Probleme wie Magenschleimhautentzündungen oder Geschwüre verursachen.
Wenn irgendwie möglich, trinke ich kein Leitungswasser, weil ich sehe, wie sich die Chemikalien und die Wasserrohre auf die Energie des Wassers auswirken. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, existiert für mich die Grenze zwischen Gedanke und Wirklichkeit, der physischen und der nicht physischen Ebene nicht. Und dennoch hatte ich, gefangen in der Ohnmacht meines Selbsthasses, eine großartige Chance übersehen.
Eines Abends ging ich in die Stadtbibliothek, um ein paar Filme auszuleihen. Schon immer schaue ich mir gerne Dokumentarfilme an, und diesmal zog mich der Film Water: The Great Mystery an. Darin ist vom »Strukturieren« von Wasser die Rede, und es wird gezeigt, was ich schon immer gesehen habe, nämlich dass alles im Umfeld des Wassers auf das Wasser Einfluss ausübt und unser Körper mit seinem hohen Wasseranteil genauso funktioniert. In dem Dokumentarfilm wird strukturiertes Wasser ins Meer geschüttet, um damit, so die Vorstellung, das Meerwasser positiv zu beeinflussen.
Nachdem ich den Film zur Hälfte gesehen hatte, drückte ich auf die Pausetaste und suchte eiligst nach einem Stift und Papier; mir war endlich ein Licht aufgegangen. Ich konnte kaum glauben, wie mir etwas so Offensichtliches entgangen war. Ich konnte mich nicht so positiv auf mich fokussieren, dass ich mich selbst lieben konnte, aber ich konnte mich positiv auf etwas anderes fokussieren. Bei der Vorstellung, etwas Liebenswertes an mir zu finden, drehte sich mir der Magen um; aber wenn ich meinen Sohn anschaute, fielen mir unzählige Dinge ein, die ich an ihm liebte. Es war ganz einleuchtend: Ich könnte ein Glas Wasser nehmen und an all das denken, was ich an meinem Sohn liebte; ich konnte diese ganze, von Herzen kommende Zuneigung und den positiven Fokus auf das Wasser lenken und dieses Wasser dann trinken.
Ich fühlte mich wie ein General im Krieg, der sich gerade das »Trojanische Pferd der Selbstliebe« ausgedacht hatte. Wie ein Gegengift konnte ich das Wasser in meinem Körper, in dem der Selbsthass einprogrammiert war, umstrukturieren und mit den Schwingungen der Liebe überschwemmen, die ich dem Glas Wasser eingegeben hatte. Ich war mir nicht sicher, wie ich darauf reagieren würde, und führte mein kleines Experiment aus Angst an diesem Abend noch nicht durch. Aber als mein Sohn am nächsten Tag ein Schläfchen hielt, fasste ich Mut und probierte es aus.
Teal, das Versuchskaninchen
Viele große Geister, beispielsweise Benjamin Franklin, Jonas Salk und Albert Hofmann, probierten ihre Hypothesen selbst an sich aus. Auch ich habe das mit meinen Ideen immer so gemacht. Und so stand ich am Tag, nachdem ich diesen Einfall hatte, in der Küche und war leicht panisch. Sicher, ich ließ keinen Drachen in einem Gewittersturm fliegen wie Benjamin Franklin, aber mein ganzer Körper schrie: »Lauf weg!«, als ob ich einen Riesenfehler machte.
In mir tobte ein Kampf, als ich das Wasser ins Glas goss und alles, was ich an meinem Sohn so liebte, in dieses Wasser fokussierte. Als die Zeitschaltuhr nach fünf Minuten klingelte, hob ich das Wasserglas an meine Lippen und trank das Wasser wie eine Arznei, so schnell ich konnte. Ich dachte, ich würde mich auf der Stelle besser fühlen und voll innerer Freude sein. Aber da hatte ich mich gründlich getäuscht! Ich fing an zu zittern, und mir wurde schlecht. Mein ganzer Körper war in Aufruhr, aber anstatt mich zu übergeben, begann ich zu schluchzen. Mein Körper reinigte sich von jahrelang angestautem Kummer und Leid, und ich hatte buchstäblich das Gefühl, als hätte ich ein Abführmittel genommen.
Gut 20 Minuten lag ich wie ein Fötus auf dem Küchenboden und weinte. Allmählich klang das Schluchzen ab, und ich verspürte eine überwältigende Erleichterung, fühlte mich geerdet. Bei einem Spaziergang empfand ich das allererste Mal eine Ahnung von innerem Frieden. Es hatte nichts mit ekstatischer Begeisterung zu tun, aber ich versuchte auch nicht mehr verzweifelt, vor mir selbst wegzulaufen. Also beschloss ich, mit meinem kleinen Experiment weiterzumachen, und zwar jeden Tag, einen Monat lang immer zur selben Zeit.
In der ersten Woche reagierte ich immer gleich. Das Wassertrinken war wie eine chemische Reaktion, bei der zwei sich heftig bekämpfende Energien in meinem Körper einen Krieg miteinander ausfochten. Danach ließen die Reaktionen auf meine »Übung« allmählich nach. Ich war dabei, mich der mir unvertrauten Frequenz der Liebe anzupassen.
Dann passierten immer wieder seltsame Dinge. Auch im Außen fanden Veränderungen statt. Ich lobte einem Freund gegenüber meine Kochkünste; das hätte früher sofort eine Spirale des Selbsthasses und der Schuldgefühle in mir ausgelöst, doch diesmal fühlte es sich nicht falsch an. Ich probierte es mit Affirmationen und stellte fest, dass es nicht mehr ganz so schwierig war, sie zu glauben. Ich konnte sagen: »Ich mag die Farbe meiner Haut«, und meinte das auch so. Die wütende Stimme in meinem Kopf, die immer so Sachen sagte wie: »Kein Mensch kann dich lieben, du bist einfach zu schwierig«, oder: »Ausgerechnet du musst das sagen«, oder: »Na, da hast du Dummkopf ja mal wieder was Schönes angerichtet« – diese Stimme verstummte nach und nach. Und auch meine Angst wurde weniger.
Das erinnerte mich daran, wie ich einmal vor Jahren zufällig ein Interview im Radio hörte, als ich über Land fuhr; ich werde nie vergessen, was dabei über die Buchstaben des Wortes »Anxiety« (Angst) geäußert wurde. Wenn man die Buchstaben anders anordnet, entsteht »any exit« (»irgendein Ausweg«). Angst ist der Versuch, irgendeinen Ausweg zu finden, um zu entkommen. Wie ich erkannte, war die Ursache meiner Angst mein Versuch, einen Ausweg zu finden, um vor mir selbst zu flüchten. Mit zunehmendem »Training« in Selbstliebe schwand allmählich mein Wunsch, vor mir davonzulaufen, und damit auch meine Angst.
Durch das Trinken von Wasser, das mit Liebe getränkt worden war, gewann ich durch die Hintertür Zugang zu meinem Selbsthass; damit wurden für mich auch die anderen Selbstliebe-Übungen einfacher. Ich hatte sozusagen durch die Hintertür die dicken Mauern eingerissen, die die Liebe abwehren sollten, und von diesem Zeitpunkt an konnte ich mich der Selbstliebe auch durch die Vordertür nähern. Ich machte mich an die Aufgabe, das perfekte Rezept für Selbstliebe zu entwickeln und dafür alle einzelnen Zutaten zu identifizieren.
Schluss mit dem Ritzen
Körperlich schwächte mich mein Selbsthass vor allem aufgrund meiner Sucht nach Selbstverletzungen durch Schnitte, und das war meine nächste große Hürde. Seit ich elf Jahre alt war, war ich süchtig danach, mich selbst zu verletzen. Endorphine blockieren das Schmerzempfinden und spielen auch bei Gefühlen der Erleichterung und der Lust eine Rolle. Sie haben eine ähnliche Wirkung wie Kodein oder Morphium. Wenn Endorphine an die Opioidrezeptoren im limbischen System andocken, zu dem auch der Hypothalamus gehört, empfinden wir Erleichterung, Lust und Befriedigung und fühlen uns ruhiger und mit positiver Energie aufgeladen.
Es ist so: Wenn der Körper Schmerz verspürt, werden im Gehirn Endorphine freigesetzt; sie lindern den Schmerz und laden uns mit Energie auf, sodass wir uns in Sicherheit bringen können. Die Schnitte, die ich mir zufügte, linderten also meine negativen Emotionen. Es ist ein Bewältigungsmechanismus, durch den intensive Gefühle wie Angst, Schuld, Niedergeschlagenheit, Stress und emotionale Gefühllosigkeit zeitweilig gemildert werden, desgleichen Versagensgefühle, Selbstverachtung, mangelndes Selbstwertgefühl oder Perfektionsdruck.
Genauso, wie man süchtig nach einer Droge werden kann, kann man auch süchtig werden nach den chemischen Stoffen, die der eigene Körper in Reaktion auf bestimmte Dinge produziert. Sobald der Akt des Ritzens mit dem damit einhergehenden Gefühl der Erleichterung assoziiert wird, werden im Gehirn neurale Pfade aufgebaut, die die betroffene Person automatisch dazu zwingen, beim Fühlen negativer Emotionen nach Erleichterung zu suchen, in diesem Fall durch Ritzen.
Dieses Gefühl ist mir zutiefst vertraut. Wie ein eingesperrtes Tier, so sind Menschen, die sich selbst mit Schnitten verletzen, in einem Gefängnis, in dem negative Emotionen, insbesondere Verzweiflung, Hass und Wut, nicht ausgedrückt werden können. Solche emotionalen Zustände werden deshalb verinnerlicht. Die Energie kann nirgendwohin, außer nach innen.
In meiner Kindheit und Jugend trug ich an der Last eines sehr großen Geheimnisses. Ich führte ein Doppelleben: einerseits das Leben mit meinen Eltern, andererseits eines ohne meine Eltern, ein krankes und verdrehtes Leben, erschaffen von einem Psychopathen, der angeblich mein Mentor war.
Von Anfang an hatte mein Peiniger mir beigebracht, dass das Gefühl der Ruhe durch Bestrafung, entweder durch jemand anderes oder sich selbst, das Licht Christi sei, der einen von seinen Sünden freispricht. Ritzen wurde zu meinem Bewältigungsmechanismus. Immer, wenn ich mich in der Falle, schuldig, verzweifelt oder wütend fühlte, nahm ich dazu Zuflucht, insbesondere dann, wenn ich meinte, mit mir stimmte etwas nicht oder ich sei schlecht. Mit Selbstverletzungen verdeckte ich auch andere Verletzungen, die mein Peiniger mir zugefügt hatte.
Nur eine Phase … oder doch nicht?
Leider schürten meine Eltern ganz unabsichtlich meinen Selbstverletzungsdrang. Zu Hause waren meine Emotionen nichts wert, ich war ja als »psychisch krank« gebrandmarkt, denn meine Eltern glaubten, es gäbe überhaupt keinen Grund für mich, mich so schlecht zu fühlen, wie ich es offensichtlich tat. Sie dachten, die einzig mögliche Erklärung sei, mit mir würde etwas nicht stimmen. Eigentlich ein ganz logischer Schluss, aber er wandte sich gegen mich. Meine Eltern stützten die Vorstellung, mit mir würde etwas nicht stimmen, weil ich mir diese Schnitte zufügte, doch dadurch verstärkten sie in erster Linie den Grund dafür, warum ich das tat.
Die Psychologen und Psychiater waren keine Hilfe, denn sie erzählten meinen Eltern immer wieder, das sei nur eine Phase, eine »Teenager-Sache«, die ich, wenn ich erst einmal 18 sei, hinter mir gelassen hätte. Doch dann wurde ich 18 und ritzte mich immer noch. Daraufhin versicherten sie, mit 25 sei es vorbei. Doch ich wurde 25 und fügte mir nach wie vor Schnitte zu. Nun hieß es, sobald ich selbst Mutter sei, sei Schluss damit. Doch ich wurde Mutter und hatte immer noch gelegentliche Rückfälle. Und natürlich gaben meine Eltern irgendwann auf. Ich probierte alles aus, was an Vorschlägen so kam, um damit aufzuhören, und unter Umständen wäre ich vielleicht immer noch damit beschäftigt, wenn ich nicht mein inneres Kind kennengelernt hätte.
Bei einer der wichtigsten Techniken der Traumaintegration lässt man die Klienten bewusst zu ihren traumatisierenden Erinnerungen zurückgehen, das kindliche Selbst aus all diesen Erinnerungen erlösen und diese kindliche Version der eigenen Person an einen sicheren Ort bringen, um es dort neu zu »beeltern«.
Nachdem ich meinen Fall bei der Polizei angezeigt hatte, erhielt ich als Opfer eines Verbrechens etwas Geld als Entschädigung, welches es mir ermöglichte, die führende Traumaspezialistin des Bundesstaates aufzusuchen, die warmherzigste Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Als sie ins Wartezimmer kam, um mich aufzurufen, dachte ich, sie sah ein bisschen wie eine Barbie-Puppe in mittleren Jahren aus. Als sie mich das erste Mal in meine Erinnerungen führte, damit ich mit meinem kindlichen Selbst interagieren konnte, weinte ich unaufhörlich. Ich sah, wie klein, verletzlich und rein ich war. Nachdem ich mich so lange verdorben und schmutzig gefühlt hatte, war es für mich ein Schock, diese verletzliche und unschuldige Seite von mir zu sehen.
Eine schockierende Begegnung mit mir selbst
Zunächst hatte ich Angst vor meinem kindlichen Selbst. Beim mentalen Kontakt hatte ich Angst davor, dieses kleine Mädchen zu berühren. Ich musste mir Engel oder Kriegerprinzessinnen vorstellen, die es vor ihren Erinnerungen, in denen es gefangen war, retteten und es trösteten. Mit der Zeit gewann ich so viel Vertrauen, dass ich mir vorstellen konnte, wie ich selbst mein kindliches Selbst in den Armen hielt. Ich nahm Verbindung mit meinem inneren Kind auf und begann, dieses Kind zu lieben. Für mich ist die Arbeit mit dem inneren Kind die vielleicht beste emotionale Heiltechnik, die je entdeckt worden ist. Dabei wird nicht nur ein Symptom angegangen, sondern die Ursächlichkeit des emotionalen Traumas modifiziert. Doch mein Respekt für diese Arbeit sollte noch weiter steigen.
Wie mir vor einigen Jahren klar wurde, geht das innere Kind mit dem physischen Erwachsenwerden nicht weg, bei niemandem – es wohnt immer in uns. Ich dachte mir, alles, was ich mir selbst antue, tue ich letztendlich auch meinem inneren Kind an. Wie fast alle Menschen mit Selbstverletzungstendenzen hatte ich einen »rituellen Ort«, an dem ich mir die Schnitte zufügte. Bei mir war das die Badewanne. Ich durchwühlte meine alten Fotos in der Garage, suchte nach einem Kinderbild von mir, auf dem ich ganz besonders unschuldig und liebenswert aussah, und befestigte dieses Bild an den Kacheln neben meiner Badewanne.
Und tatsächlich verspürte ich eines Tages erneut ein wahnsinniges Verlangen, mich zu ritzen. Ich ging ins Badezimmer, sperrte die Tür zu, zerbrach eine Glastasse und nahm mir das größte Stück Glas, das ich finden konnte. Ich stieg in die Badewanne und sah mich selbst als kleines Kind auf dem Foto. Zuerst war ich fast wütend über die Last der Verantwortung, die ich beim Anblick dieses Bildes verspürte. Ich brauchte Erleichterung, aber dieses kleine Kind auf dem Bild schaute mich mit so unschuldigen Augen und so voller Vertrauen an – und ich war dabei, dieses Vertrauen zu enttäuschen und diese Unschuld zu zerstören.
Ich überlegte mir: Was machte ich da im Hinblick auf »Alles, was ich mir antue, tue ich meinem inneren Kind an?« Ich sah geistige Bilder, wie dieses kleine Mädchen spielte und kicherte, sah, wie ich seinen winzig kleinen Arm ergriff und mit der Glasscherbe darüberfuhr, bis es blutete. Ich stellte mir vor, wie es weinte, sein Ärmchen von mir wegzog und einfach nicht verstand, womit es das verdient hatte.
Ich fühlte mich wie eine Kinderschänderin und brach angesichts der Tragödie, die ein solches Handeln verursachen würde, in Tränen aus. Es war, als ob ich mich wieder mit der Unschuld und dem Vertrauen verband, welche, als ich ein Kind war, in mir zerstört worden waren. Ich konnte mich als Erwachsene verletzen. Aber einem Kind konnte ich nicht wehtun. Ich ließ die Scherbe in die Badewanne fallen, schaute das Foto an und weinte. Mein Körper verlangte immer noch danach, verletzt zu werden, aber ich brachte es nicht fertig.
Durch den Kontakt mit meinem inneren Kind erkannte ich die Tragödie meines Lebens und konnte mich als verletzten anstatt als schlechten Menschen betrachten. Jahrelang hatte ich gedacht, bei mir wäre alle Mühe vergeblich und ich könnte nicht geheilt werden; doch jetzt sah ich, dass meine Unschuld nicht wegging. Sie war wie ein winziges Flämmchen eines Streichholzes, das zwar flackerte, aber nicht verlosch.
Ich fand das mir innewohnende Gute wieder, den Teil von mir, der von diesen Leuten, die alles andere an mir verletzt und zerstört hatten, nicht verletzt werden konnte. Nach und nach beelterte ich mich neu. Ich liebte mein inneres Kind und sorgte für es, und so lernte ich, mich selbst zu lieben und mich um mich zu kümmern. Letztendlich befreite ich mich dadurch aus einer Sucht, mit der ich über 20 Jahre gekämpft hatte.