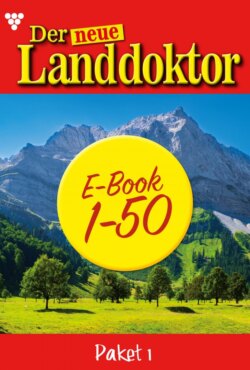Читать книгу Der neue Landdoktor Paket 1 – Arztroman - Tessa Hofreiter - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Ratet mal, was mir eben passiert ist!« Emilia Seefeld stürmte grußlos in die Küche und ließ sich auf einen Stuhl am gedeckten Abendbrottisch fallen. Ihre grauen Augen blitzten, also konnte es nur eine gute Überraschung gewesen sein. Unternehmungslustig schaute sie ihre Familie an. »Na? Nun ratet doch mal!
»Du hast einen Mega-Popstar getroffen«, schlug ihr Vater vor.
»Papa!« Emilia verdrehte genervt die Augen.
»Na, dann eben einen berühmten Filmstar!« Ihr Vater, der junge Doktor Seefeld, konnte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, seine Tochter ein wenig aufzuziehen. »Bitte? Ausgerechnet hier in Bergmoosbach?« Aus dem Mund der pubertierenden Vierzehnjährigen klang es, als lebte man an dem verschlafenen Ort, an dem sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. »Welcher Promi würden sich denn wohl schon hierher verirren!«
»Hm, lass mich mal überlegen. Vielleicht dieser attraktive Grauhaarige, der vor kurzem diese ebenso schöne wie kluge Staranwältin geheiratet hat? Er ist doch der absolute Frauenschwarm.« Ihr Vater zog sie immer noch auf, obwohl er wusste, wie leicht er damit einen Gewittersturm heraufbeschwören konnte. Den warnenden Blick seines eigenen Vaters beantwortete er mit einem verstohlenen Augenzwinkern.
»Mensch, Papa, der ist doch voll alt!«, stöhnte Emilia und verdrehte wieder angenervt die Augen.
»Also bitte, sooo alt ist er nun auch wieder nicht. Dieser Mann ist keine zehn Jahre älter als ich!«, entgegnete Sebastian Seefeld milde empört.
»Sag ich doch, voll alt!«, konterte Emilia. »Kann ich bitte mal das Brot haben? Und wollt ihr nun endlich wissen, was los ist, oder interessiert euch das mal wieder nicht?«
»Natürlich wollen wir das, Emmchen«, sagte ihr Großvater beruhigend. Seinem Sohn warf er einen warnenden Blick zu. »Dein Papa hat doch nur Spaß gemacht.«
Emilia verdrehte gereizt die Augen. Sie war in einem Alter, in dem man Späßchen des eigenen Papas alles andere als witzig findet. Aber die ruhige Freundlichkeit ihres Großvaters glättete ihr gesträubtes Gefieder, und ihre gute Laune kehrte zurück. Sie strahlte übers ganze Gesicht. »Ich werde Brautjungfer!«
»Wie schön, Emmchen!«, rief Traudel Bruckner. Sie war viel mehr als nur die Haushälterin, sie war die gute Seele des Doktorhauses. »Und jetzt lass mich mal raten: Du wirst die Brautjungfer von Marie Höfer?«
»Ist das nicht genial? Ich war heute auf dem Ebereschenhof, und da haben sie und Ben mich gefragt, ob ich die Brautjungfer sein will.« Emilias kindliche Begeisterung brachte den ganzen Raum zum Leuchten. »Ich freu mich so, das wird bestimmt eine ganz, ganz tolle Hochzeit, und Marie wird wunderschön aussehen und Ben auch, und ich brauch unbedingt was Neues zum Anziehen, und was tut so eine Brautjungfer eigentlich?«, sprudelten ihre Fragen in die Runde.
Ihr Vater griff bedächtig nach den Salzflocken und streute sie über sein leckeres Tomatenbrot. »Tja, wie gut, dass wir unsere Traudel haben!«, meinte er. »Für das Protokoll in Sachen Brautjungfern fühle ich mich leider nicht zuständig.«
Traudel lächelte. »Du wirst die Braut begleiten, ihr beim Ankleiden helfen und bei der Trauung, wenn sie mit ihrem Mann die Ringe wechselt, den Brautstrauß halten. Du tust halt alles, was eine gute Freundin tut, damit es der Braut an ihrem Ehrentag gut geht. Ein schönes Kleid für dich ist Ehrensache, und es wird bestimmt viel Spaß machen, das gemeinsam mit Marie auszusuchen.
Und weißt du, warum es überhaupt den Brauch mit den Brautjungfern gibt? Früher glaubten die Menschen an böse Geister und wollten sich vor ihnen schützen, vor allem dann, wenn ein glückliches Ereignis stattfinden sollte. Das konnte nämlich leicht den Neid der bösen Geister wecken. Wenn jetzt also eine Hochzeit gefeiert wurde, dann musste die Braut von Jungfern in schönen Kleidern umgeben sein. Das würde den Geist verwirren, denn er konnte ja nicht erkennen, wer die eigentliche Braut war. So konnte er keinen Schaden anrichten und musste unverrichteter Dinge wieder abziehen.«
»Mann, was die Leute früher so alles geglaubt haben!«, meinte Emilia. »Da bin ich aber froh, dass wir heute leben!«
»Beim Stichwort glauben fällt mir übrigens noch etwas ein«, sagte Sebastian Seefeld ganz unschuldig. »Ich glaube, gehört zu haben, dass morgen eine Mathe-Arbeit geschrieben wird. Und ich glaube auch, gehört zu haben, dass dafür noch einiges zu lernen war?«
»So, Papa, jetzt hast du’s mir aber gegeben, was?« Herausfordernd blitzte Emilia ihren Vater an. »Weil ich auf dem Ebereschenhof war und über Brautjungferzeug geredet habe, anstatt Mathe zu lernen, gell? Ha! Da wirst du dich aber wundern! Ich hab nämlich Mathe gelernt! Mit Benjamin! Der ist Zimmermann, und als Zimmermann muss man sehr gut in Mathe sein!«, trumpfte sie auf.
Sebastian, der selbst gern mit seiner Tochter arbeitete, guckte etwas sparsam. Sein Vater klopfte ihm liebevoll auf den Arm und meinte: »Der Punkt geht an Emilia, mein Sohn.«
Der junge Arzt seufzte. »Ihr habt wohl recht. Ich muss halt noch lernen, dass mein kleines Mädchen jetzt ein großes Mädchen ist und viele Dinge alleine auf die Reihe bringt, ohne dass ich dafür sorgen muss.«
»Och, Papa, gib nicht auf, du machst das schon ganz toll! Manchmal.« Emilia warf ihm ein Kunsthändchen zu und widmete sich dann wieder mit Hingabe den aufgebratenen Knödeln auf ihrem Teller. »Hmm, lecker, Traudel. Niemand kocht so gut wie du!«
*
So sehr man sich im Doktorhaus über die Nachricht gefreut hatte, dass Emilia Brautjungfer werden sollte, so wenig Begeisterung löste das in einem anderen Haus, nur wenige Straßen entfernt, aus. In der Wohnung über dem Friseursalon Glamour lag knisternde Spannung in der Luft! Lisa Ecker, die selbsternannte Starfriseurin von Bergmoosbach und angebliche beste Freundin Maries, beklagte sich lang und breit, weil eine andere als Brautjungfer ausgewählt worden war. Auch die Vorstellungen der Braut hinsichtlich der Kleidung wurden wild kritisiert: »Dirndl und Flechtfrisur, was du für einen Geschmack hast!«
»Einen guten!«, antwortete Marie selbstbewusst und lachte glücklich. »Den habe ich doch wohl in der Auswahl meines Lebensgefährten bewiesen.«
Lisa nickte und versuchte, ihren Gesichtsausdruck unter Kontrolle zu halten. Sie würde niemals verstehen können, was den attraktiven Benjamin Lauterbach an diese Langweilerin band! Und sie würde sich auch niemals damit abfinden!
In der Vergangenheit hatte Lisa bereits versucht, durch geschicktes Reden Maries Zweifel an dieser neuen Liebe zu schüren und eine Trennung zu erreichen. Während Lisa den attraktiven Benjamin früher für sich selbst beanspruchte, hatte sie inzwischen erkannt, dass er sich niemals für sie interessieren würde. Deshalb ging es ihr nur noch darum, aus purer Bosheit die glückliche Beziehung zu zerstören. Mit einer Mischung aus falscher Freundlichkeit, Dreistigkeit und Geduld beobachtete sie das junge Paar und spann ein dunkles Netz, mit dem sie die Liebe von Marie und Ben zu Fall bringen wollte.
*
Leuchtender Sonnenschein geleitete das Brautpaar durch seinen Hochzeitstag. Als Marie fertig geschmückt vor dem Spiegel stand, konnte sie kaum an das glauben, was sie dort sah. Diese junge Frau, strahlend vor Glück und erfüllter Liebe, sollte sie sein?
Die junge Frau trug ein wadenlanges Dirndl in wunderschön harmonierenden Grün- und Lila-Tönen. Dezente weiße Doppelpünktchen, die in den Stoff eingewebt waren, unterstrichen das traditionelle Aussehen des Kleides. Miederhaken und Kette aus feinem Silber verzierten das Oberteil. Die festliche Eleganz dieses Dirndls wurde durch einen eleganten Stehkragen unterstrichen, der sich um Maries zarten Nacken schmiegte. Vervollständigt wurde das Kleid durch eine weiße Dirndlbluse aus feinster Baumwolle mit zierlichen Spitzenkanten.
Ihre dunklen Haare waren in einer Flechtfrisur sanft aus dem Gesicht geführt und im Nacken zu einem weichen, lockigen Knoten zusammengesteckt. Winzige cremefarbene Rosenblüten schimmerten zwischen den einzelnen Haarsträhnen.
»So ist es richtig, gell, Mama? So hast du es dir für mich gewünscht«, flüsterte Marie. Sie schickte ein Lächeln hinauf zu ihren Eltern in die Ewigkeit. »Ich weiß, dass ihr heute bei mir seid.«
Dann griff sie nach ihrem Brautstrauß, einem kleinen, wunderhübschen Kunstwerk aus cremefarbenen Rosen, zartem Frauenmantel, grünem Blattwerk und grünen Brombeeren, die erst kurz davor standen, ihren tiefdunklen Farbton zu entwickeln. Alles passte perfekt zu den Farben ihres Dirndls.
Als es an der Tür klopfte, drehte sie sich tief ausatmend zu ihrem Mann um und schaute ihm lächelnd entgegen. Benjamin war sprachlos von ihrem Anblick. Dieses wunderschöne Wesen war seine Frau! Die Frau, mit der er sein Leben teilte, seine Gefährtin am Tag und in der Nacht. Und die Hüterin ihres größten Schatzes: Sie trug ihr Kind unter dem Herzen.
Er konnte nichts gegen die Tränen tun, die in ihm aufstiegen. Der Gedanke, dass sie jetzt eine Familie waren, berührte ihn in der Tiefe seiner Seele. Er nahm ihre Hand und schaute sie mit einem Blick an, in dem sein ganzes Herz lag.
»Sind wir bereit, Marie?«, fragte er leise.
Seine tiefe, zärtliche Stimme und sein vertrauensvoller Blick hüllten Maries ganzes Wesen ein, und sie antwortete: »Ja, wir sind bereit, Benjamin!«
Seite an Seite gingen sie die Treppe hinunter zu den wartenden Freunden. Eine niedliche, aufgeregte Brautjungfer geleitete sie zu der mit Blumen geschmückten Kutsche, und der Brautzug setzte sich in Bewegung.
*
Abends erstrahlten auf dem Ebereschenhof Haus und Garten im Licht vieler Kerzen. Die Gäste saßen an weiß gedeckten Tischen oder bewegten sich zwanglos zwischen den Räumen innen und dem duftenden Garten. Es wurde getanzt und gelacht, man hielt zwei, drei herzliche Reden auf das Glück des Paares, dessen Liebe und Verbundenheit mit Händen zu greifen war. Sowohl Marie als auch Ben hatten keine nahen Familienangehörigen mehr und freuten sich von Herzen über den Kreis der Freunde, die ihnen Familie geworden waren.
Benedikt Seefeld tanzte wie ein Brautvater mit Marie, die er gerührt anschaute. »Wo ist denn nur die Zeit geblieben? Es war doch gerade erst gestern, dass du hier geboren wurdest und später als kleines Mädchen an der Hand der Mutter in meine Praxis getrippelt kamst.«
»Ja, die Zeiten ändern sich«, lächelte Marie ihren väterlichen Freund an. »Und vieles bleibt gleich. Du weißt ja, Benedikt. Es dauert gar nicht mehr lange, und dann kommt wieder ein kleines Mädchen oder ein kleiner Bub an der Hand der Mutter in eure Praxis.«
»Ich freue mich sehr für euch!« Der ältere Mann strahlte übers ganze Gesicht. »Ihr könnt es sicher kaum erwarten. Wann ist es denn soweit?«
»Na ja, ein bisschen Zeit haben wir noch«, sagte sie und schaute hinunter auf ihren Bauch, der sich so schön und verheißungsvoll unter ihrem seidenen Schürzenband wölbte. »Zur Adventszeit wird es wohl kommen.«
»Jetzt, da du es sagst …«, schmunzelte Benedikt. »Ich als alter Arzt hätte es eigentlich erkennen müssen. Wo hatte ich nur meine Augen?«
»Dirndl sind eben sehr kleidsam mit ihren weiten Röcken und Schürzen«, lachte Marie. Sie tanzte aus den Armen Benedikt Seefelds in die seines Sohnes Sebastian und von ihm wieder an die Seite ihres Mannes. Mit allen Sinnen genoss sie ihren Ehrentag und war die strahlende Königin dieses Festes.
Auch Lisa hatte sich für die Hochzeitsfeier geschmückt, nur wie so oft, kannte sie dabei kein Maß. Sie trug ein hautenges Kleid aus schimmerndem dunkelrotem Stoff, das ihre üppigen Kurven wirklich äußerst knapp umschloss. Seitlich war das Kleid fast bis zur Hüfte geschlitzt, und es hatte einen tiefen Ausschnitt. Ihr blondiertes Haar umspielte in wilden Locken und Wellen ihre nackten Schultern. Statt der üblichen riesigen Creolen trug sie lange Ohrgehänge aus funkelndem Strass, die bei jeder Kopfbewegung verführerisch über ihren Hals streiften. Die Augen hatte sie tiefschwarz betont, und ihr Schmollmund leuchtete mit dem Rot ihres Kleides um die Wette. Sie trank zu viel, und im Laufe des Abends wurden ihr Gang und ihre Art zu tanzen immer sinnlicher. Freigiebig verteilte sie Küsse und Umarmungen, was von den anderen Gästen teils amüsiert, teils missbilligend wahrgenommen wurde.
»Meine Güte, trägt dieses verrückte Huhn überhaupt Unterwäsche unter ihrem roten Fummel?«, murmelte Traudel, als sie mit einem Teller voller Schmankerln am Buffet neben ihrer Freundin stand.
»Glaub mir, das willst du nicht wirklich wissen«, meinte diese augenzwinkernd.
Traudel nickte ein wenig geistesabwesend. Sie beobachtete Lisa, die gerade neben Marie stand und freundschaftlich ihren nackten Arm um die Schultern der Braut legte. Im Dämmerlicht wirkte es für einen Augenblick so, als gleite eine hautfarbene Schlange um den Hals der jungen Frau.
»Marie, was für ein schönes Fest du hast!«, flötete Lisa. »Es ist wirklich, wirklich toll, obwohl es so viel kleiner und bescheidener ist als damals deine Hochzeit mit Fabian, gell?«
Marie beschloss, diese Taktlosigkeit zu überhören. »Es freut mich, dass es dir gefällt«, antwortete sie und befreite sich aus der Umarmung ihrer Freundin. »Ich sehe dort drüben die Fanny, bei der hab ich heute noch gar nicht gesessen. Ich gehe mal rüber zu ihr.«
Lisa stand nur einen Augenblick allein und nahm sich gerade ein frisch gefülltes Sektglas, als eine sehr tiefe und warme Männerstimme neben ihr fragte: »Na, Lisa, amüsierst du dich gut?«
»Ah, der glückliche Bräutigam!«, gurrte Lisa. Sie lächelte mit feucht glänzenden Lippen. Ihr Blick glitt anzüglich über Gesicht und Körper des Mannes. Sie seufzte tief. Was für ein außerordentlich gut aussehender und attraktiver Kerl dieser Benjamin Lauterbach war!
Ein ausgesprochen männliches Gesicht mit blau-grünen Augen, glänzenden dunkelblonden Haaren und einem sinnlichen Mund, der von einem gepflegten Bart gerahmt wurde. Ben war sehr groß und breitschultrig, man sah seinem durchtrainierten Körper an, dass er schwere Arbeit gewohnt war. Dennoch wirkte der Mann nicht schwerfällig; im Gegenteil, seine Art, sich zu bewegen, erinnerte an die geschmeidige Kraft eines eleganten Raubtiers.
Lisa seufzte erneut, und ihre Augen verschleierten sich. Diese vollen, männlichen Lippen zu küssen, sich mit diesem prachtvollen Körper im Rhythmus der Liebe bewegen zu können… und das nur für die hausbackene Marie mit ihrer Flechtfrisur und dem spießigen Dirndl, was für eine Verschwendung! Was würde sie, Lisa, mit diesem herrlichen Kerl an ihrer Seite hermachen! Im Bergmoosbacher Alltag hätte sie mit diesen angesehenen Jungunternehmer an ihrer Seite und im Bett jede Menge Spaß. Die Art von Spaß, die er mit seinem schwangeren Frauchen jetzt bestimmt vermisste. Man sollte …
»Lisa? Ist dir nicht gut? Du schaust ein wenig … weggetreten aus«, sagte Ben und trat einen Schritt zur Seite. Lisas Hand, die eben noch unter sein Jackett hatte schlüpfen und über seine Brust streichen wollen, fiel ins Leere. Ben schüttelte lachend den Kopf. »Mir scheint, du hast genug für heute, Lisa! Wir sollten schauen, dass wir dich nach Hause bekommen.«
»Ich hab noch lange nicht genug, und das weißt du genau!«, flüsterte sie heiser. Sie schaute ihm nicht in die Augen, sondern ihr gieriger Blick saugte sich an seinen Lippen fest.
Ben runzelte irritiert die Stirn. Selbst wenn man einen kleinen Schwips in Rechnung stellte – das hier ging entschieden zu weit.
»Wir haben auch noch gar nicht genug getanzt«, gurrte Lisa, schlang die Arme um seinen Hals und schmiegte sich schamlos an seinen Körper. Sie wiegte sich im Takt der Musik und beobachtete Ben aus halb geschlossenen Augenlidern.
Jetzt gelang es ihm kaum noch, seinen Ärger zu beherrschen. Mit einem harten Griff befreite er sich aus Lisas Umarmung und schob die Frau ein gutes Stück von sich weg. »Es reicht!«, sagte er böse. »Du gehst jetzt besser!«
Lisa kicherte und schwankte leicht in dem harten Griff, mit dem er ihre Handgelenke umfasst und sie auf Abstand hielt.
»Ist alles in Ordnung?« Wie aus dem Boden gewachsen stand Traudel plötzlich neben der jungen Frau in ihrem billigen Fummel.
»Upsi, das war wohl ein bisschen zu viel Sekt für mich«, kicherte Lisa.
»Scheint so!«, antwortete Ben. Er wollte eine Szene auf seiner Hochzeit vermeiden, aber es war deutlich, dass er Lisas Benehmen nicht weiter höflich umgehen würde. Wenn es sein musste, würde er sie vor die Tür setzen!
Die lebenserfahrene Traudel hatte die Situation sofort richtig eingeschätzt. Sie nickte Ben zu und fasste energisch nach Lisas Arm. »Du gehörst ins Bett!«, sagte sie entschieden.
Lisa kicherte wieder. »Da sagst du was, ehrenwerte Traudel. Was meinst du, hier gibt’s doch bestimmt ein Gästezimmer? Ob ich vielleicht hier ins Bett gehen kann?« Ihr Blick glitt von Ben zu Marie, die mit einem der Freunde tanzte, und blieb provozierend an dem gewölbten Bauch haften. »Eure Hochzeitsnacht würde ich ja nicht mehr groß stören!«, fügte sie anzüglich hinzu.
Am liebsten hätte Traudel ihr einen Klaps auf ihr loses Mundwerk gegeben! »Es reicht!«, sagte sie scharf. »Du fährst sofort!«
»Ja, wie denn, du selbst ernannter Wachhund!«, erwiderte Lisa mit ätzendem Spott. »Du willst doch nicht verantworten, dass ich mich jetzt hinters Steuer setze?«
»Ich fahre!«, antwortete Traudel knapp.
Sie verstaute Lisa auf dem Rücksitz ihres Wagens und setzte sich vorn neben Emilia, die müde, aber mit glänzenden Augen von der Hochzeit schwärmte. »Ach, Traudel«, seufzte das Mädchen, »glaubst du, wenn ich mal heirate, wird es auch so schön wie bei Marie und Ben?«
Ehe Traudel antworten konnte, meldete sich Lisa von der Rückbank zu Wort. »Was, du willst nicht die ganz große Show? Mit weißem Kleid, das mit Strass bestickt ist, und meterlanger Schleppe und Schleier und einem Blumengebinde, das dir bis zu den Füßen reicht?«
»Nee! Ich will doch keine Glitzershow, ich will eine richtig schöne Hochzeit! Eine mit Herz und Stil, eben in der Art wie heute«, antwortete Emilia verträumt.
Gutes Kind!, dachte Traudel und griff liebevoll nach der Hand des Mädchens. »Du wirst deine Traumhochzeit bekommen, Emmchen, verlass dich drauf!«
Der Rest der Fahrt verlief schweigend, jede der drei Frauen hing ihren eigenen Gedanken nach. Vom Streckenverlauf her hätte Traudel eigentlich Lisa zuerst bei sich absetzen können, aber sie fuhr einen kleinen Umweg über das Doktorhaus. »Leg dich schon schlafen, Emmchen, in ein paar Minuten bin ich wieder da. Ich bringe nur eben noch Lisa nach Hause«, sagte sie.
»Ist gut, Traudel, bis gleich. Nacht, Lisa!« Emilia verschwand im Doktorhaus, hinter dessen Fenstern freundliches Licht auf die Heimkehrende wartete.
Schweigend fuhr Traudel das kurze Stück zu Lisas Wohnung.
Lisa stieg aus und schwenkte lässig ihre unglaublich hochhackigen, goldenen Riemchenschuhe durch die Luft.
»Tschau, tschau, Traudel!« Lisa winkte ihr grinsend zu und schwebte hinüber zu ihrer Haustür.
Traudel fand Lisas Verhalten unentschuldbar.
Sie musste sich einen Augenblick sammeln, ehe sie ins Haus gehen konnte. Dort traf sie auf Vater und Sohn, die inzwischen ebenfalls das Fest verlassen hatten.
»Ich geh‘ schlafen; gute Nacht, alle miteinander!«, rief Sebastian in den Flur und ging dann nach oben in sein Schlafzimmer.
In der Küche brannte noch Licht, und Traudel hörte das vertraute Geräusch der Kaffeemaschine. Sowohl sie als auch Benedikt Seefeld gehörten nicht zu den Menschen, die spätabends durch eine Tasse Tee oder Kaffee um den Schlaf gebracht wurden. Sie ging hinüber in die gemütliche Wohnküche, die nur noch vom warmen Schein einer Tischlampe erhellt wurde. Zwei dampfende und herrlich duftende Kaffeebecher standen auf dem Holztisch, und Doktor Benedikt Seefeld lehnte sich behaglich in einen der Korbstühle zurück. Er hatte das Jackett ausgezogen und die Krawatte abgenommen. Sein warmherziges Lächeln begrüßte Traudel, und er reichte ihr ihren Lieblingsbecher, den mit den grünen Punkten und dem Rosenmuster.
»Was für ein schöner Tag!«, sagte er zufrieden.
Die hübsche ältere Frau setzte sich ihm gegenüber an den Tisch und schaute ihn über den Rand ihres Bechers hinweg an. »Ja, ein sehr schöner Tag«, antwortete sie.
Benedikt griff nach dem Teller mit Walnusskeksen, die niemand so gut backen konnte wie Traudel, der gute Geist des Doktorhauses. »Mit einem sehr gemütlichen Ende in vertrauter Gesellschaft«, lächelte er.
*
Auch die allerletzten Gäste hatten nun den Ebereschenhof verlassen, und tiefe Stille breitete sich aus. In den gläsernen Windlichtern erloschen die Kerzen, benutzte Gläser und Teller standen zwischen den Blumenvasen auf den Tischen und erzählten von einer fröhlichen Feier.
Benjamin umfasste Hof und Garten mit einer weit ausholenden Geste und sagte zu seiner Frau: »Weißt du, was, Frau Lauterbach? Das Aufräumen verschieben wir auf morgen. Ich meine, wir sollten unseren Hochzeitstag nicht in der Spülküche beenden.«
Sehr glücklich und sehr müde lehnte Marie ihren Kopf an seine Brust. »Das ist ein sehr guter Gedanke, Herr Lauterbach. Ich merke, dass ich mich kaum noch auf den Beinen halten kann.«
»Das musst du auch nicht, meine Liebste«, sagte Benjamin zärtlich. Er hatte schützend die Arme um seine Frau gelegt und barg sein Gesicht in ihren seidigen Haaren. Sie duftete nach den winzigen Rosenblüten, die in ihre Zöpfe eingeflochten waren. »Du hast ja noch ein Paar Beine, die für dich laufen, wenn es zu schwer für dich wird. Und ein Paar starke Hände, die für dich arbeiten, wenn du es nicht mehr kannst.« Er legte seine Hand unter ihr Kinn und hob es sanft zu sich empor, sodass sie in seine Augen schauen konnte. Im Licht der Sterne schimmerten sie grünlich und so klar wie ein Bergsee.
Ich liebe ihn! Ich liebe ihn so sehr, dachte Marie atemlos.
Sein Blick hüllte sie ein wie ein wärmendes Tuch, das gegen die Kühle der Nacht um ihre bloßen Schultern gelegt worden war. »Und außerdem …«, fuhr Ben leise fort, und nun waren seine Lippen nur noch einen Hauch von ihren entfernt, und sie zitterte vor Sehnsucht nach ihm, »… außerdem hast du ein Paar Arme, die dich tragen werden; wenn du es willst, bis ans Ende der Welt.«
Sein Kuss war ein sanftes, lockendes Versprechen, und dann hob Benjamin seine Frau in seine Arme und trug sie ins Haus hinein.
*
Marie saß an ihrem Schreibtisch und war in die Gestaltung des Albums mit den wunderschönen Hochzeitsfotos versunken. Sie schien nicht bemerkt zu haben, dass die lauten Hammerschläge, die über den Hof hallten, seit einiger Zeit verstummt waren. Konzentriert klebte sie einige der getrockneten Rosenblätter ihres Brautstraußes in das Album, als ihr Mann seinen Kopf durch die Tür streckte.
»Hallo, Frau Lauterbach, wo bleibst du?«, fragte er erstaunt.
Marie schaute hoch, stutzte und sprang dann hastig auf. »Meine Güte, der Termin mit der Hebamme bei Doktor Seefeld wegen des Ultraschalls! Den hab ich glatt vergessen vor lauter Schwelgen in den Hochzeitsfotos.« Hastig griff sie nach dem Mutterpass und wollte ins Nebenzimmer rennen, um ihre Tasche zu holen, als Ben sie mit einer liebevollen Umarmung stoppte.
»Nicht so schnell, Mami!«, lachte er. »Wir haben noch genug Zeit, und du willst doch unser kleines Fragezeichen nicht zu sehr durchschaukeln mit dieser Rennerei!«
Marie seufzte glücklich und suchte jetzt in einem gemäßigteren Tempo ihre Sachen zusammen. Wie sehr sie Bens Fürsorge liebte! Er achtete auf alles, was sie tat oder tun wollte, sprach mit ihrem Ungeborenen und hatte ihm den Namen Fragezeichen gegeben. Beide hatten entschieden, sich vom Arzt das Geschlecht ihres Kindes nicht mitteilen zu lassen; erst bei der Geburt wollten sie wissen, ob ihnen ein Mädchen oder ein Bub geschenkt worden war. So war es einfach ihr kleines Fragezeichen, das schon vor der Geburt von der Liebe seiner Eltern getragen wurde.
Heute war ein weiterer Vorsorgetermin fällig, zu dem Marie nicht zu ihrer Hebamme Anna gehen würde, sondern zu Doktor Seefeld. Allein hätte Anna sich das teure Ultraschallgerät nicht leisten können, es wäre durch ihre Patientinnen auch gar nicht ausgelastet gewesen. Daher teilte sie sich das Gerät mit Sebastian Seefeld in dessen Praxis.
Marie und Ben nahmen im Wartezimmer Platz. Außer dem jungen Paar saß nur noch eine ältere Frau in dem hellen, freundlich eingerichteten Raum und blätterte gelangweilt in den Zeitschriften. Es war Afra, die einen Kiosk betrieb und außerdem als Kellnerin im Biergarten arbeitete, sie war sozusagen die Nachrichtenzentrale Bergmoosbachs.
»Grüß Gott!«, sagte sie, und sofort nahmen ihre Augen Maries Figur in Augenschein. Dass diese jungen Frauen aber auch keine weiten, wallenden Umstandskleider mehr trugen! Nein, eng und figurbetont musste es auch in der Schwangerschaft sein, sodass das Bäuchlein für jedermann sichtbar war. Und überhaupt – erst ein Baby machen und danach heiraten, was war das für ein Verfall der guten Sitten!
Aber spannend war’s schon!
»Na, Marie, wie geht’s denn? Es soll ja so eine schöne Hochzeit gewesen sein, hab ich gehört«, eröffnete Afra das Gespräch. »Und wann kommt nun das Kleine?«
Ben legte den Arm um die Schultern seiner Frau. »Das dauert noch«, antwortete er ruhig.
Das war auch wieder etwas, das Afra missbilligte: Dass die Mannsleute mitkamen, wenn es zur Hebamme und zum Doktor ging. Mal ganz abgesehen davon, dass sie unverheiratet und selbstverständlich kinderlos war –, so etwas wäre bei ihr nie in Frage gekommen!
»Wie geht es denn nun weiter bei euch auf dem Ebereschenhof? Mit dem Kind wird es wohl nichts werden mit dem Umbau?«, fragte Afra ungeniert weiter.
Ben und Marie wechselten einen Blick. Die ältere Frau hatte ein schwieriges Thema angesprochen, das ihnen Kopfzerbrechen bereitete. Wäre Marie alleine geblieben, hätte sie wie geplant das erste Stockwerk ihres Hauses in Gästeappartements umwandeln können. Nun wurde es knapp, sie brauchte den Platz für ihre eigene Familie, und Ben und sie mussten neu überlegen.
Marie verschränkte ihre Finger mit denen von Ben. »Das wird schon!«, antwortete sie zuversichtlich.
»Und wie?«, bohrte Afra weiter. Ihr Blick richtete sich anzüglich auf Maries Bauch. »Wo ihr doch jetzt mehr Platz braucht! So kurz nach der Hochzeit!«
»Wenn unsere Gäste an deinem Kiosk ihre Zeitungen kaufen, kannst du sie ja fragen, wie es auf dem Ebereschenhof geworden ist«, sagte Marie freundlich.
Auch diese diplomatisch verpackte Abfuhr hätte Afra nicht von weiteren Fragen abgehalten, aber jetzt öffnete sich die Tür, und Lisa trat ein. Auf ihrer linken Hand ruhte ein umhülltes Kühlkissen, und sie trug eine äußerst wehleidige Miene zur Schau.
Als sie sah, wer im Wartezimmer saß, setzte sie sich sofort neben Ben und Lisa und belegte sie mit Beschlag. »Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie gefährlich mein Beruf ist?«, klagte sie mit ihrer Klein-Mädchen-Stimme, die jetzt auf weinerlich gestellt war. »Alle diese Chemikalien zum Haarefärben, zum Beispiel, und denn erst die Elektrogeräte! Eben habe ich mich so furchtbar an einem Lockenstab verbrannt! Wenn ihr nur wüsstet, wie höllisch weh das tut!« Unaufgefordert hob sie das Kühlkissen an und hielt Ben und Lisa ihre Hand vor die Augen.
Durch ihre Worte beunruhigt, erwarteten sie Verbrennungen dritten Grades zu sehen, deshalb dauerte es einen Augenblick, bis sie erkannten, worüber Lisa gesprochen hatte: Über den Handrücken verlief ein hellrosa Streifen, so blass, das er kaum auffiel. Offenbar war Lisa hier mit dem heißen Lockenstab in Kontakt gekommen und hatte sich eine leichte Hautreizung zugezogen.
»Hm, ja, ich sehe. Im wahrsten Sinne des Wortes: Brandgefährlich!«, sagte Ben mit todernster Miene.
»Gell, du verstehst mich!«, schnurrte Lisa und rückte noch näher an ihn heran. »Kommst du …« Ihr Satz wurde durch Sebastian Seefeld unterbrochen, der seine Tür öffnete und den nächsten Patienten in sein Sprechzimmer bitten wollte. Lisa sprang auf die Beine und hielt ihm ihre Hand entgegen. »Ich bin ein Notfall, Doktor, Sie müssen mich sofort versorgen!«
Sebastian Seefeld stutzte, warf Marie und Ben einen kurzen, entschuldigenden Blick zu und schaute dann auf Lisas Hand. Er unterdrückte einen Seufzer. »Das ist alles andere als ein Notfall, Frau Ecker! Das ist noch nicht einmal eine Verbrennung ersten Grades. Wenn Sie ernsthaft wollen, dass ich mir das ansehe, dann setzen Sie sich bitte und warten, bis Sie an der Reihe sind. Jetzt kommen bitte Frau und Herr Lauterbach mit mir!« Der Doktor führte das junge Paar in sein Sprechzimmer und bevor er die Tür schloss, wandte er sich noch einmal zu Lisa um: »Und versuchen Sie, nicht zu kollabieren, während ich die anderen Patienten untersuche!«
Verdattert starrte Lisa die geschlossene Tür an. »Hä? Ich soll was nicht?«
»Zusammenbrechen!«, erklärte Gertrud über den Empfangstresen hinweg. »Das kann manchmal vorkommen bei so schweren Verletzungen.«
»Aber …, was …«, stammelte Lisa mit weit aufgerissenen Augen.
Gertrud erkannte, dass Bergmoosbachs Starfriseurin den Scherz überhaupt nicht verstanden hatte und sagte kopfschüttelnd: »Nun setz dich halt hin, ich werd‘ schon ein Auge auf dich haben!«
Lisa setzte sich neben Afra, und sofort entspann sich ein reger Austausch über alle größeren und kleineren Verletzungen, welche die Damen jemals hatten erleiden müssen.
*
Nach einem Gespräch und den üblichen Untersuchungen lag Marie auf der Liege neben dem Ultraschallgerät. Sie war so aufgeregt, denn endlich würde sie ihr Baby sehen! Ben stand neben ihr, und sein Herz pochte mindestens genau so schnell wie ihres.
Die Hebamme und Doktor Seefeld hatten im Vorfeld eine Besprechung wegen Maries Schwangerschaft abgehalten. Anna war bei ihrer letzten Untersuchung etwas aufgefallen, was sie abklären wollte. Arzt und Hebamme warteten heute ebenso gespannt wie die jungen Eltern auf das Ergebnis dieser Untersuchung.
Marie fühlte die Kälte des Gels und den leichten Druck, mit dem der Arzt den Schallkopf über ihren Bauch gleiten ließ. Der Bildschirm stand noch so, dass sie ihn nicht einsehen konnte, gleich würde Doktor Seefeld ihn zu dem Paar umdrehen. Die junge Mutter wartete mit großer Aufmerksamkeit und drückte Bens Hand vor Spannung.
»Siehst du? Hier und hier«, sagte Hebamme Anna leise zu dem Arzt.
Sehr konzentriert bewegte er den Schallkopf, neigte ihn, setzte ihn erneut an einer anderen Stelle an. Es kam Marie so vor, als dauerte diese Untersuchung länger als die vorherige. Beunruhigt runzelte sie die Stirn. Der Arzt schien mehr als gründlich vorzugehen, und warum deutete er wiederholt auf den Bildschirm? Und warum nickte Anna bestätigend, und warum murmelten die beiden unverständliche lateinische Begriffe?
»Stimmt etwas nicht?«, fragte Marie mit einer ganz fremden Stimme, die viel zu hoch und dünn klang. Sie hatte plötzlich entsetzliche Angst!
Aber sowohl Arzt als auch Hebamme schauten sie freundlich lächelnd an. »Nein, es ist alles in bester Ordnung!«, beruhigte sie Doktor Seefeld sofort. »Meine Kollegin und ich haben nur etwas abgeglichen, das wir gesehen haben.« Er drehte den Bildschirm so, dass Marie und Ben ihn sehen konnten, und betätigte einen Regler am Gerät. »Und jetzt wollen wir uns mal anhören, was dein Bauch zu erzählen hat.«
Er hatte den Lautsprecher eingeschaltet, und das seltsam fauchende und schwappende Geräusch, das der Schallkopf auffing, wurde laut in den Raum übertragen. Und dann kam es! Ein sehr schnelles, rhythmisches Geräusch, wie ein rasches Pochen, das durch das Fruchtwasser verfremdet klang; ein Geräusch, für das es keine lautmalerische Umschreibung gibt: Der Herzschlag ihres ungeborenen Kindes!
Marie stockte der Atem. »Ist das …?«, flüsterte sie.
Anna nickte. »Ja, das ist der Herzschlag eures Babys!«
Und auf Maries Gesicht erwachte ein Lächeln, für das es keine Worte gibt.
Marie und Ben lauschten atemlos und entzückt diesem fremden und doch bereits so vertrauten Rhythmus. Unfassbar, dass sie ihrem Ungeborenen so nah sein konnten, dass sie seine Lebenszeichen hören durften.
Aber – was war das? Neben diesem einen pochenden, schwappenden Rhythmus war plötzlich ein zweiter zu hören! Mal überlagerte er das erste Geräusch, mal wurde er schwächer, dann hörte man beide gleichzeitig und gleich stark.
»Was ist das?«, fragten Marie und Ben wie aus einem Mund. Ihre Blicke klebten geradezu am Bildschirm.
»Ja …«, antwortete Doktor Seefeld gedehnt. Sein lächelnder Blick wandert über das atemlos staunende Paar hinüber zur Hebamme, und er nickte ihr zu. Sie hatte es zuerst bemerkt, und er wollte ihr nicht die Freude nehmen, den Eltern die freudige Überraschung mitzuteilen.
»Das, was ihr hört, sind die Herzschläge eurer Kinder. Ihr erwartet Zwillinge!«, sagte Anna sanft.
»Zwi…« Ben fehlten die Worte. Tränen glänzten in seinen Augen.
»Zwillinge!«, sagte Marie andächtig. Sie legte beide Hände auf ihren Bauch und betrachtete ihn aufmerksam. plötzlich hob sie den Blick und schaute Doktor Seefeld durchdringend an. »Werde ich sehr dick sein?«, fragte sie.
Sebastian Seefeld konnte nicht anders, er platze heraus vor Lachen. Schwangere Frauen und ihre Hormone!
Marie guckte von einem zum anderen. »Hab ich das eben wirklich gesagt?«, fragte sie leicht verwundert.
»Hast du, mein Herz!«, bestätigte ihr Mann. »Und ich weiß jetzt schon, dass du den allerschönsten dicken Babybauch der Welt haben wirst.«
»Zwei Babys, wir bekommen zwei Babys!«, flüsterte Marie, bei der die Neuigkeit erst jetzt richtig angekommen war. »Wie wunderbar!«
»Wir lassen euch jetzt erst einmal etwas Zeit, die Nachricht zu verarbeiten. Ihr werdet viele Fragen haben, die wir dann ausgiebig besprechen. Scheut euch nicht, wirklich alles zu fragen, was euch durch den Kopf geht! Nichts ist banal oder unwichtig, was euch dazu einfällt! Ihr kommt Anfang nächster Woche wieder in die Sprechstunde zu Anna und mir. Bis dahin alles wie gehabt: gesundes Essen, ausreichend Bewegung, frische Luft, viel Schlaf und keine große körperlichen Anstrengungen.
Wenn du irgendwelche Beschwerden hast oder das Gefühl, es könnte etwas nicht stimmen, komm sofort her! Ansonsten sehen wir uns in vier Tagen wieder hier zum Gespräch. Macht’s gut, ihr beiden, und noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch!«, verabschiedete sich Doktor Seefeld von dem Paar.
Anna und er begleiteten die werdenden Eltern hinaus und setzten sich dann ins Arztzimmer, um Maries Patientendaten zu besprechen und die weitere Vorsorge in der Zwillingsschwangerschaft.
Als Marie und Ben Hand in Hand das Wartezimmer betraten, saßen dort immer noch Afra mit ihren Magenbeschwerden und Lisa mit ihrer eingebildeten Verbrennung. Sie beleuchteten gerade die Ehe eines gewissen Monegassischen Fürsten, als das junge Paar zu ihnen trat. Marie wollte mit einem freundlichen Kopfnicken weiter zur Tür gehen, aber Ben war mit ein, zwei großen Schritten bei den Frauen, hob die überrascht aufkreischende Afra in seine Arme, schwenkte sie übermütig im Kreis herum und drückte ihr einen schallenden Schmatz auf die Wange!
»Was? Warum? Wofür war das denn?«, stotterte Afra überrumpelt.
»Das war ein Busserl von unserem Kind!«, erklärte Ben strahlend.
Schnappte sich Lisa und tat mit ihr genau dasselbe wie vorher mit Afra. »Und das war das Busserl von unserem anderen Kind! Das Glück kommt nämlich im Doppelpack zu uns auf den Ebereschenhof!«, rief übermütig. »Ich wünsch euch noch einen schönen Tag, Mädels!«
Und weg war er mit seiner glückstrahlenden Marie im Arm.
»Jesses, das werden Zwillinge!«, schlussfolgerte Afra.
*
Die Welt war noch dieselbe, als Marie und Benjamin Doktor Seefelds Praxis verließen, nur für sie beide hatte sie sich verändert. Sie war größer geworden. Nach dieser Neuigkeit sofort in den Alltag zurückzukehren, war unmöglich. Es gab so viel zu fühlen, zu bedenken und zu besprechen.
»Was tun wir jetzt?«, fragte Marie. Sie stand so dicht neben ihrem Mann, dass sie den Kopf in den Nacken legen musste, um ihm in die Augen schauen zu können. Ben sah Hundert winzige Lichter darin leuchten.
Er legte die Arme um sie und drückte sie an sich. »Jetzt, mein Herz, gehen wir hinüber zu Fanny und kaufen ein«, verkündete er fröhlich. »Und dann fahren raus, immer der Nase nach, und steigen dort aus, wo wir es am schönsten finden. Dort machen wir unser Picknick, und dann legen wir uns ins weiche Gras und schauen hinauf in den Himmel und erzählen den Wolken, dass wir zwei Kinder bekommen und wie wir uns die Zukunft mit ihnen verstellen.«
»So machen wir das!«, antwortete Marie lächelnd.
Das Ehepaar ging hinüber zu Fannys kleinem Supermarkt und kaufte Brötchen, Käse und Kaminwurzen, Tomaten, Obst und Getränke und als Nachtisch Apfelküchle. Als Marie noch Servietten und hübsch verzierte Teller und Trinkbecher aus Pappe mit in den Einkaufskorb legte, meinte Fanny mit einem freundlichen Lächeln: »Das schaut ja ganz nach einem Picknick aus. Nehmt ihr zwei euch einen freien Tag?«
»Ja, es ist so schön heut, nicht zu kühl und nicht zu heiß, wie wollten ein bisschen raus fahren und den Sommer genießen«, antwortete Marie. Von ihrem doppelten Glück mochte sie in diesem Augenblick noch nichts sagen, für das rasante Verbreiten der Nachricht würde die gute Afra schon sorgen.
»Dann wünsche ich euch viel Freude!«, sagte Fanny und legte als kleine Dreingabe zwei Schokoladenherzchen in rotem Glanzpapier zu dem Einkauf.
»Danke, Fanny, das ist nett!«, antwortete Ben. Er sah auf die beiden leuchtend roten Herzen und dachte: Tief in Marie schlagen jetzt auch zwei andere Herzen … Er musste sich mit der Hand über die Augen fahren und räusperte sich verlegen. Meine Güte, er hatte doch sonst nicht so nahe am Wasser gebaut! »Ja, äh, dann dir auch noch einen schönen Tag, Fanny!«, sagte er rasch.
Marie und er verließen Bergmoosbach und fuhren in die schöne bayerische Landschaft hinein, ohne Zeitdruck und ohne die Absicht, irgendein Ziel erreichen zu müssen. Irgendwo stiegen sie aus und folgten einem schmalen Weg durch eine sonnige Wiese, die an einen Wald grenzte. Dort fanden sie im Schatten der Bäume eine Stelle mit dichten Moospolstern, auf denen sie die alte Decke ausbreiteten, die Ben immer im Wagen mitführte. Sonnenlicht tanzte und flirrte zwischen den Blättern, und die Kühle des Waldes mischte sich mit der Hitze, die von der sonnenbeschienen Wiese aufstieg. Ein Duft von wilder Minze und Kamille lag in der Luft.
Mit einem tiefen Seufzer des Behagens streckte Marie sich auf der weichen Decke aus und schloss die Augen. »Wie schön es hier ist«, sagte sie dankbar, »und wie gut es mir geht! Ich fühle mich wie im Paradies.«
»Wir können die Kinder ja Adam und Eva nennen, falls es ein Pärchen wird«, neckte Ben sie.
»Oder Max und Moritz, wenn es zwei Buben sind«, antwortete Marie träge, ohne die Augen zu öffnen.
»Oder Pünktchen und Anton«, entgegnete Ben.
Marie öffnete ein Auge und blinzelte in den hellen Sommerhimmel. »Winnetou und Old Shatterhand?«, schlug sie vor.
»Harry und Sally!«, konterte Ben mit den Namen eines Pärchens aus einem bekannten Liebesfilm der späten achtziger Jahre.
»Du sagst jetzt aber nicht Dick und Doof!«, sagte Marie und boxte spielerisch gegen seinen Arm.
»Niemals!«, lachte Ben und beendete das übermütige Spiel mit der Namensuche durch einen innigen Kuss.
Er schaute in ihr Gesicht und zeichnete sanft mit seinen Fingerspitzen den feinen Bogen ihrer Augenbrauen nach. »Es wird wundervoll werden, wenn wir uns ernsthaft auf die Suche nach Namen für unsere Kinder machen«, sagte er.
»Oh, ja!« Maries Augen leuchteten auf. »Und das Kinderzimmer! Was für ein schönes Nest können wir für die Kleinen herrichten. Im Haus und in der Scheune haben wir noch alte Möbel, die wir aufarbeiten, und später wirst du ihnen die allerschönsten Betten bauen, und ich streiche die Wände und nähe die Gardinen und die Bettwäsche. Aber zuerst haben wir nur ein Gitterbettchen, und wir legen die beiden Babys zusammen hinein, damit sie bei einander sind, gell? Stell dir doch mal vor, wie seltsam sie sich nach der Geburt fühlen müssen, wenn sie auf einmal getrennt voneinander sind! Das muss doch zuerst ganz furchtbar für die Kleinen sein Marie hatte sich aufgesetzt und schaute Ben mit gerunzelter Stirn an.
»Hey, süße Mami!« Benjamin strich sanft über ihre winzigen Sorgenfalten. »Vielleicht freuen sie sich auch, endlich ein bisschen mehr Platz zu haben? Wir werden es schon richtig machen. Deine Idee mit dem gemeinsamen Bettchen für die erste Zeit finde ich sehr gut, lass es uns so einrichten.« Ben griff nach dem Korb mit den Lebensmitteln und begann, sie auf der Decke zu verteilen. »Und jetzt lass uns unser Picknick genießen.«
Das Paar ließ sich die mitgebrachten Sachen schmecken, fütterte sich abwechselnd mit Trauben und Pfirsichen aus dem Obstkorb und naschte von den herrlichen Apfelküchlein, bis kein einziger Krümel mehr übrig war.
»Wie lecker!«, seufzte Marie und kuschelte sich zufrieden an Benjamins Brust. Er saß an einem Baumstamm gelehnt und hielt seine Frau in den Armen.
Auch Ben seufzte, aber es klang nicht so zufrieden wie eben bei Marie. »Das, was Afra vorhin über unseren Platz gesagt hat, geht mir auch schon länger durch den Kopf. Leider hat sie recht mit ihren Worten, wir müssen unsere Pläne völlig neu überdenken. Als Familie mit zwei Kindern brauchen wir den Platz im Haus für uns selbst. Wir haben uns den alten Stall doch schon angeschaut; wenn die Bausubstanz in Ordnung ist, könnten wir dort mit dem Ausbau von Ferienwohnungen beginnen. Meinst du, wir bekommen das hin, jetzt, da so viel anderes zu bedenken und zu tun ist und du für die körperliche Arbeiten ausfällst?«
Marie nickte. »Ich denke, ja!«, antwortete sie fest. »Den größten Teil der Arbeiten sollten wir bis zur Geburt fertig haben. Das müsste zu schaffen sein, weil das eigentliche Gebäude vorhanden ist, und neben dem Zimmermann auch andere Gewerke dort arbeiten werden. Es ist doch größtenteils eine Frage des Geldes. Ich …«, sie unterbrach sich und sprach dann mit einem kleinen Lächeln in der Stimme weiter, »… wir müssen dann wegen einer neuen Hypothek auf den Ebereschenhof verhandeln.«
Ben schmiegte seine Wange gegen ihr Haar. »Unser Zuhause!«, sagte er leise.
Sie sprachen noch weiter von ihrem Bauvorhaben, aber mehr und mehr driftete das Gespräch wieder zu dem großen Abenteuer Schwangerschaft und Zwillingsgeburt. Sie verloren sich in praktischen Überlegungen und Träumerei, überlegten die Fragen für ihr Gespräch mit dem Arzt und der Hebamme, malten sich das Kinderzimmer aus und überlegten sich jetzt ernsthaft mögliche Namen für ihre beiden winzigen Fragezeichen.
*
Was für ein rundum bescheuerter und langweiliger Abend!
Genervt drückte Lisa auf die Fernbedienung ihres Flachbildfernsehers und schaltete von einem Programm zum nächsten. Wer wollte diesen langweiligen Mist schon sehen!
Fußball! Sendungen über Schleiereulen oder Krabbenfischer an der Nordsee, politische Talkshows, einen französischen Spielfilm, bei dem kein Mensch wusste, worum es hier eigentlich ging. Die dritte Wiederholung eines alten Tatorts.
Weit und breit keine interessante Casting Show in Sicht oder diese Sendung, bei der Leute gezeigt wurden, die Kneipen oder Nagelstudios auf Mallorca aufmachen wollten und sich dabei so dämlich anstellten, dass man sich vor Schadenfreude auf dem Sofa kugeln konnte.
Keine Nachbarn, die sich fetzten, weil die Fußmatte um Null Komma Fünf Zentimeter verrutscht im Treppenhaus lag, kein Gekeife in irgendwelchen Promi-Ehen.
Gähnend warf Lisa die Fernbedienung in die Ecke und hätte vor Langerweile fast an ihren Fingernägeln gekaut, wenn das nicht so aufwändige Kunstwerke aus Gel und Glitzer gewesen wären. Die wenigen Menschen, bei denen sie hätte anrufen können, hatte sie bereits abtelefoniert, und nicht einer war zu einem längeren Tratsch bereit gewesen. Weil sie keine Lust auf den Biergarten hatte und ihr gar nichts anderes mehr einfiel, griff Lisa zu dem Taschenbuch, das sie letztes Jahr von jemandem geschenkt bekommen hatte. Es handelte sich um den Krimi ›Narbengeld‹, in dem es um Erpressung und einen Mord aus Leidenschaft ging.
Nachdem Lisa den in ihren Augen ziemlich langweilig geratenen Einstieg in die Geschichte geschafft hatte, nahm sie das Thema gefangen. Donnerwetter, die Frau, von der erzählt wurde, entpuppte sich als durchtriebenes und eiskaltes Biest! Mit genau überlegter Zielstrebigkeit verfolgte diese Tonya ihre finsteren Pläne, um einen reichen Industriellen zu Fall zu bringen. Das mit den ganzem Wirtschaftskram und womit dieser Typ so reich geworden war, interessierte Lisa weniger, das übersprang sie beim Lesen.
Aber das Vorgehen der Frau war Klasse!
Wie Tonya sich in die Familie des Industriellen einschlich und niemand, am wenigsten ihr späteres Opfer, merkte, worum es ihr wirklich ging! Wie freundlich und hilfsbereit sie war, dabei bescheiden und unauffällig.
Vor allem unauffällig.
Und gleichzeitig im Verborgenen aktiv wurde.
Nachdenklich ließ Lisa das Buch sinken. Mit Speck fängt man Mäuse, war bisher ihre Devise gewesen. Unauffälligkeit und Vorausschau gehörten nicht unbedingt zu ihren Verhaltensweisen. War sie deshalb bei Ben nicht zum Zug gekommen? Hatte sie ihn zu direkt zu ködern versucht? War ihre Freundlichkeit gegenüber Marie zu dick aufgetragen gewesen? Sollte sie vielleicht einerseits ihr Verhalten ein wenig zurückfahren und andererseits besser planen?
Als sie vor der Hochzeit versuchte, Lisa und Ben auseinander zu bringen, hatte sie es nur mit Worten probiert. Wenn sich die Gelegenheit bot, hatte sie Maries ohnehin schwaches Selbstvertrauen durch Gerede über Männer, Untreue und schmerzliche Erfahrungen zu erschüttern versucht.
Tonya, die Frau aus dem Krimi, tat scheinbar nichts, um ihre Interessen voran zu treiben, und dennoch handelte sie.
Äußerst interessant!
Lisa las, bis die letzten Glockenschläge zur Mitternacht verklungen waren. Dann hatte sie genügend Anregungen bekommen.
Sie ging hinüber ins Schlafzimmer und inspizierte die Schublade mit ihren Dessous. Lisa kicherte zufrieden; das, was sie im Haus hatte, eignete sich gut für einen gewissen Störfall. Und morgen würde sie in die Kreisstadt fahren und das richtige Briefpapier besorgen. Das, was man hier in Bergmoosbach kaufen konnte, war schlicht weiß und langweilig, es eignete sich nicht für ihre Zwecke. Sie wollte eine andere Farbe, ein leuchtendes Scharlachrot.
Überaus zufrieden mit sich und ihrem Plan, stolzierte Lisa ins Bett.
*
Im Doktorhaus saß man heute in kleiner Runde am Mittagstisch. Benedikt Seefeld war bei einem Kongress der Rheumatologen in München und wurde erst am nächsten Tag zurückerwartet. Sebastian nahm sich zum zweiten Mal von der leckeren Pilzpfanne, die Traudel auf den Tisch gestellt hatte. Er tunkte das noch ofenwarme Brot mit der krossen Kruste in die Sauce und genoss das erdige Aroma der Pilze, das sich mit dem der frischen Kräuter und des Knoblauchs verband. »Traudel, es schmeckt mal wieder fantastisch!«, sagte er. »Aber ohne fünf Minuten Zähneputzen und eine ganze Packung Pfefferminzpastillen werde ich wohl kaum durch die Nachmittagssprechstunde kommen.«
»Das wird schon«, antwortete die Haushälterin unbekümmert und griff noch einmal zur Pfeffermühle. Sie mochte ihr Essen gerne scharf gewürzt. »Bis dahin hast du noch genügend Zeit für Kirschkuchen und Kaffee, das neutralisiert den Knoblauch auch ein wenig, und danach kannst du dich deiner Atempflege widmen.«
»Mensch, Papa, das ist doch gar nicht so schlimm. Du bist aber auch so was von empfindlich!«, stichelte seine pubertäre Tochter.
Ihr Papa beschloss, das zu überhören, und fragte stattdessen: »Und wie war’s heute in der Schule?«
Diese Frage wurde jeden Mittag bei Tisch gestellt, und so gut wie immer gab es darauf die Antwort: »Normal.«
Auch das ließ Sebastian so stehen. Er wusste, wenn Emilia etwas wirklich Wichtiges auf dem Herzen hätte, würde sie es sagen. Und wenn sie alles andere, was in ihrem persönlichen Kosmos wichtig war, eifersüchtig für sich behalten und ausschließlich mit ihren besten Freundinnen teilen wollte –, daran mussten Eltern sich in dieser Entwicklungsphase ihrer Kinder gewöhnen.
Ob Emmchen mit ihrer Mama mehr reden würde?, überlegte Sebastian. Über alle diese Mädchensachen, die im Kreis ihrer Freundinnen für unerschöpflichen Gesprächsstoff sorgten? Wieder einmal spürte er diesen nadelfeinen Stich der Trauer und des Verlustes, weil Helen nicht mehr bei ihnen war.
Sebastian atmete einmal tief ein und aus und fragte dann ruhig: »Und was hast du heute Nachmittag vor?«
»Ich muss nächste Woche den Deutschaufsatz abgeben, dafür will ich heute die Gliederung machen. Na, und den anderen Schulkram eben. Und dann will zum Ebereschenhof fahren. Marie hat doch gesagt, dass sie einen Hund haben wollen, vielleicht auch zwei, und bei Toni auf dem Gestüt sind gerade Colliewelpen geboren worden. Sie sind sooo süß!«, schwärmte Marie. »Das wollte ich ihr erzählen und sie fragen, ob sie Interesse hat.«
»Hm!«, meinte der Arzt. »Ich bezweifle, dass Marie und Ben in ihrer jetzigen Situation Zeit und Kraft haben, sich um die Erziehung eines Welpen zu kümmern. Denk doch nur mal an die Zeit, als Nolan so klein und furchtbar anstrengend war!«
Emilia richtete sich auf und sagte äußerst erwachsen und würdevoll: »Meinst du nicht, dass wir ihnen diese Entscheidung überlassen sollten, Papa?«
»Äh, ja, wohl wahr«, stotterte Sebastian. Emilia schaffte es doch immer wieder, ihn mit ihren Reaktionen zu überraschen! »Wenn du zum Hof fährst, nimmst du dann bitte diese Broschüre zum Thema Impfungen mit, von der ich Marie und Ben erzählt habe? Ich lege sie dir nachher hier auf den Küchentisch.«
»Klar, Papa, mach ich gerne, und …«, sie schaute ihren Vater an, der gerade seinen Mund öffnete, und grinste, »… und nein, ich werde auch bestimmt nicht vergessen, sie aus meinem Rucksack zu holen und bei Marie abzugeben!«
Sebastian Seefeld klappte den Mund zu und erwiderte das spitzbübische Grinsen seiner Tochter.
Im Laufe des Nachmittags machte sich Emilia auf den Weg zum Ebereschenhof. In ihrem Rucksack lag nicht nur die Broschüre über das Impfen, sondern auch eine Dose mit dem Rest des Kirschkuchens. Marie solle jetzt nicht mehr so viel am Herd stehen, sondern sich ein bissl verwöhnen lassen, hatte Traudel gemeint. Mal die Beine hochzulegen und ein Stückchen Kuchen zu essen habe noch keiner Schwangeren geschadet.
Gerade als Emilia von der einsamen Landstraße auf den Weg zum Ebereschenhof abbiegen wollte, kam ihr das Postauto entgegen. Jeder im Ort kannte den Fahrer, es war der Kräutner Michl. Er stammte aus Bergmoosbach, versorgte den gesamten Landkreis mit Post und war immer für ein Schwätzchen zu haben. Auch jetzt fuhr er sein Auto zur Seite, kurbelte das Fenster herunter und hielt einen kleinen Plausch mit Emilia, die ihrerseits auch immer etwas zu erzählen wusste.
»Du, Michl«, meinte sie, »wenn du jetzt gleich heim und zum Üben zu deinem Posaunenchor willst, kann ich dir den Weg zum Ebereschenhof nicht abnehmen? Ich fahre jetzt dort hoch, und du kannst gleich weiter nach Hause. Ich vergesse bestimmt nicht, die Post abzugeben! Vom Papa habe ich auch etwas dabei, was ich der Marie geben soll.«
Michl zögerte kurz. Natürlich durfte er die Briefe nicht an Dritte aushändigen, aber Pakete gab man ja auch schon mal bei freundlichen Nachbarn ab, und er kannte Emilia Seefeld als hilfsbereites, freundliches Mädchen. Also reichte er ihr die Post für den Ebereschenhof: eine Zeitschrift, zwei Kataloge und ein paar Briefe. »Gut drauf achten und gleich abgeben, gell?«, ermahnte er beim Abschied.
»Keine Sorge, das tu ich!«, rief Emilia, und dann trat sie kräftig in die Pedale ihres Mountainbikes, um die Anhöhe zum Ebereschenhof in Angriff zu nehmen.
Auf dem Hofplatz empfingen sie Radiomusik aus den geöffneten Küchenfenstern und die Geräusche von Hammer und Säge. Benjamin war offenbar im alten Stall und arbeitete. Emilia stellte ihr Rad ab und betrat die gemütliche Küche, wo Marie bei Radiomusik und einem großen Krug Eistee mit Bügeln beschäftigt war. Vernünftigerweise im Sitzen, wie die Tochter und Enkelin zweier Ärzte zufrieden feststellte!
»Hallo, Jungfer Seefeld!«, wurde sie begrüßt. Seitdem Emilia bei der Hochzeit die Brautjungfer gewesen war, redete Marie sie manchmal aus Spaß so an. »Schön, dass du mal wieder bei uns vorbei schaust!«
Das Mädchen ließ sich auf die Küchenbank fallen und kramte in ihrem Rucksack. »Eh ich’s vergesse, ich hab einiges für euch«, sagte sie. »Hier, superleckeren Kirschkuchen von Traudel, die Impfbroschüre von Papa und eure Post für heute. Ich habe eben den Michl getroffen, und er hat sie mir mitgegeben.« Sie legte alles vor sich auf den Tisch.
»Danke, Emilia«, antwortete Marie. Sie stellte das Bügeleisen aus, stand auf und streckte sich, wobei sie eine Hand ins Kreuz stützte. »Genug gebügelt für heute! Ich brauch mal ein bisschen Bewegung. Gib mir doch bitte mal die Post rüber, ich sortiere sie gleich und bringe sie rüber in Bens Büro.«
Marie legte die Zeitschrift und Kataloge auf den Küchentisch und schaute nach, welche Briefe an sie und welche an ihren Mann adressiert waren. Ben erhielt einiges in größeren, geschäftsmäßig aussehenden Umschlägen und einen kleinen, in einem auffallenden Rot. Die Adresse war nicht von Hand geschrieben, obwohl dieser Brief einen sehr persönlichen Eindruck machte, und er trug keinen Absender.
»Eigenartig«, murmelte Marie, legte ihn mit einem kleinen Achselzucken auf Bens Schreibtisch und vergaß ihn. Sie freute sich auf die Lektüre der beiden Kataloge, einen mit schöner Umstandsmode, einen mit Kinderwagen.
Bei einem neuen Krug mit Eistee und Traudels herrlichem Kirschkuschen vertieften sie und Emilia sich in die verlockende, bunte Vielfalt der Dinge, die angeblich rund ums Kinderkriegen unverzichtbar waren.
»Krass!«, staunte Emilia, die sich zum ersten Mal in dieser sehr speziellen Welt wiederfand. »Was man da alles kaufen kann! Und was das kostet …«, sprachlos deutete sie auf einen Gefährt der Luxusklasse, der eher nach einem kleinen Mondfahrzeug der NASA aussah als nach einem Kinderwagen. Und der exakt 1.895,- Euro kosten sollte. »Die spinnen doch total!«
Marie lachte. »Eigentlich unvorstellbar, wie unsere Mütter uns ohne all diesen Schnickschnack überhaupt großziehen konnten!«
»Aber guck mal, das hier ist doch süß«, schwärmte das Mädchen und wies auf ein altmodisches Gitterbettchen aus Metallgeflecht, über das ein hauchzarter, mit Sternchen bestickter Himmel gebreitet war.
Maries Augen leuchteten auf. »Das könnte mir auch gefallen! Aber siehst du, wie klein es ist? Lange kann ein Baby darin nicht liegen, und dafür ist es dann doch arg teuer. Leider!«
Die beiden blätterten weiter und unterhielten sich bestens sowohl beim Träumen als auch mit realistischen Möglichkeiten. Sonnenstrahlen tanzten auf dem Küchentisch, von draußen drangen das Lärmen der Spatzen und die Geräusche von Bens Bautätigkeit herein. Es war angenehm war; ein perfekter, goldener Spätsommertag mit einer unbeschwerten, heiteren Stimmung – bis wüstes Gebrüll die Gemütlichkeit des Nachmittags zerriss!
»Oh, nein! Nein, nein, nein, NEIN! So eine verdammte Sch…!«
»Ben!« Entsetzt sprang Marie auf und rannte, Emilia auf den Fersen, hinüber in den alten Stall. »Ben! Um Himmels willen, was ist passiert!«
Ben stand schwer atmend inmitten von altem Holz und Isoliermaterial und wies an die Decke des Stalls. »Das ist passiert!« antwortete er.
Marie starrte nach oben und konnte kaum glauben, was sie dort sah. Ben hatte begonnen, die Zwischendecke zwischen Stall und Dach zu entfernen, um das tragende Balkenwerk freizulegen. Aber anstelle stabiler Balken, die nur vom Alter nachgedunkelt waren, erwartete ihn verrottetes, schwarzes Holz, das mit widerlichem Schimmel und bräunlich-gelben Auswüchsen überzogen war! Über einen sehr langen Zeitraum musste Wasser in den Hohlraum eingedrungen sein, welches das Holz durch und durch verfaulen ließ. Die Balkenkonstruktion war inzwischen derart verrottet, dass sie unter der Berührung der bloßen Hand zu ekelhaftem, weichem Abfall zerfiel.
Marie erfasste die Tragweite der Zerstörung mit einem Blick. »Nein!«, flüsterte sie tonlos.
»Ist es denn so schlimm?« fragte Emilia verängstigt.
»Es ist das Aus für uns«, antwortete Ben bitter. »Diesen Schaden können wir nicht mehr auffangen.«
Emilia schaute mit großen Augen auf das schwarze Loch in der Decke und auf Ben, der die leise weinende Marie in seinen Armen hielt. »Ich – ich lass euch jetzt lieber mal allein, ihr habt bestimmt viel zu besprechen oder so«, stammelte sie hilflos.
Ben nickte dankbar. »Wir telefonieren bald, in Ordnung?«
»Ja!« Unsicher strich Emilia der jungen Frau über die Schulter. »Ich fahr dann jetzt. Und – und darf ich zu Hause erzählen, was hier los ist? Oder wollt ihr lieber, dass das unter euch bleibt“
»Natürlich darfst du das.« Marie wischte sich die Tränen von den Wangen, und ihr gelang ein kleines Lächeln. Die Umsicht und Rücksichtnahme des Mädchens taten ihr gut. »Ihr seid doch unsere Freunde. Es wird gut tun, mit euch darüber zu sprechen. Wir sehen uns bald.«
»Also, bis dahin!« Bedrückt machte Emilia sich auf den Heimweg.
*
Marie lehnte sich haltsuchend gegen Bens Brust. Ihre Augen glitten noch immer fassungslos über das Werk der Zerstörung, das die Feuchtigkeit angerichtet hatte. »Was – was wird denn nun? Ist denn überhaupt noch irgendetwas von der Balkenkonstruktion zu retten?«, fragte sie mutlos.
»Das weiß ich noch nicht genau, ich muss erst den Rest freilegen. Aber was ich bisher gesehen habe, macht mir keine große Hoffnungen.« Müde beugte er seinen Kopf zu Marie herab und sagte mit einem kleinen, zärtlichen Lächeln: »Komm, lass uns hier herausgehen. Die Luft ist voller Schimmelsporen, und es ist nicht gut für dich und die Kinder, wenn du dieses giftige Zeug einatmest. Mach uns doch bitte einen Kaffee, während ich dusche und mich umziehe. Wir setzen uns zusammen hin und verdauen erstmal diesen Schock. Und danach machen wir uns allem zum Trotzt einen gemütlichen Abend! Nur du und ich und gemütliche Zweisamkeit. Für die Sorgen ist dann der nächste Tag da.«
»Mein kluger Mann«, lächelte Marie und fühlte sich bereits etwas getröstet. Arm in Arm ging das Paar ins Haus hinüber.
Bevor Benjamin sich zu seiner Frau in die Stube setzte, ging er in sein Büro, um die Post des Tages durchzusehen: Rechnungen, Angebote zweier Firmen für neue Kreissägen, eine Nachricht seines Freundes Niklas, der zur Zeit in Norwegen lebte.
Und ein Brief in einem scharlachroten Umschlag, der keinen Absender trug.
Ben öffnete ihn und zog einen Briefbogen hervor, der in einem ebenso tiefen, sündigen Rot leuchtete. Schon als er die Anrede gelesen las, runzelte Ben irritiert die Stirn.
Mein heiß geliebter, einziger Ben,
du weißt, wie sehr ich Dich vermisse! Die letzten Stunden unserer Liebe brennen auf meinem Körper und in meiner Seele. Ich bin hungrig, gierig nach dir, mein Geliebter, und ich werde niemals genug haben von unserer heißen Liebe. Ich zähle die Minuten bis zu unserem nächsten Wiedersehen, dem nächsten heimlichen Treffen. Es ist doppelt und dreifach erregend, weil niemand außer uns weiß, was wir zusammen treiben! Komm schnell, mein Geliebter, ich erwarte dich!
Und, Ben, ich bin nackt, während ich Dir schreibe …
DEINE EINZIGE
Fassungslos ließ Ben den Brief sinken.
Wer schrieb ihm diesen Mist? Es gab weder einen Absender noch einen Namen als Unterschrift. Was hatte dieser sehr intime, anonyme Liebesbrief zu bedeuten? War er ein schlechter Scherz? Ein Versehen? Das schien eigentlich unmöglich, sein Name und die Anschrift stimmten. Aber wer sollte ihm solche Zeilen schicken und vor allem: Warum?
Ratlos drehte Ben den Brief in seinen Händen. Was sollte er jetzt damit anfangen? Sein erster Impuls war, ihn Marie zu zeigen. Er hatte keine Geheimnisse vor ihr und wusste, dass sie sich alles sagen konnten. Aber dann dachte er daran, wie erschüttert sie von dem Zustand des Stalles gewesen war, und dass sie gerade erst zu ein wenig innerlicher Ruhe zurückgefunden hatte. Sollte er sie jetzt mit diesem Wisch aus ihrem brüchigen Frieden aufstören? Sollte er ihren Seelenfrieden mit einem anonymen Brief trüben? Ben wusste, dass dieser so genannte Liebesbrief nur haarsträubender Blödsinn war und dass Marie es ebenso sehen und ihm vertrauen würde. Aber er wusste auch, dass die schamlosen Worte sie verletzen würden. Ihre tiefe Liebe gehörte nur ihnen, und ihre Intimität verband nur sie zwei. Niemand außer ihnen hatte das Recht, darüber zu sprechen.
Musste sie erfahren, dass jemand versuchte, sich dazwischen zu drängen? Sollte er sie beunruhigen ohne zu wissen, wer oder was sich hinter diesen Zeilen verbarg? Wäre es nicht besser, diesen Wisch einfach zu ignorieren?
Einen Augenblick noch war Benjamin unschlüssig, dann nahm er den Brief und zerriss ihn sehr sorgfältig in viele, winzige Schnipsel, die er umsichtig in seinem Papierkorb unter anderem Papiermüll versteckte. Von diesem Blödsinn, den sich irgendjemand ausgedacht hatte, würde er weder Marie noch sich selbst den Abend verderben lassen. Sie hatten, weiß der Himmel, ganz andere Sorgen!
*
Emilia saß bedrückt am Abendbrottisch. Sie war schweigsam, aber es war ein anderes Schweigen als das eines mürrischen Teenagers.
»Geht es Marie gut?«, fragte Doktor Seefeld. »Du siehst etwas besorgt aus, Emmchen.«
»Doch, Papa, mit Marie und den Babys ist alles in Ordnung. Sie war richtig gut drauf heute Nachmittag. Aber dann hat Ben bei den Arbeiten im Stall entdeckt, dass dort alle Balken total verrottet sind. Mann, hat das übel gerochen und eklig ausgesehen! Alles schwarz und faulig und gammelig. Und es muss wohl was ganz Schlimmes sein, das sie nicht reparieren können, denn Ben hat gesagt, das ist jetzt das Aus, und Marie hat so geweint.«
Traudel und Doktor Seefeld wechselten einen bestürzten Blick. Wenn ein so positiv denkender Mann wie Benjamin, der außerdem Holzfachmann war, so etwas sagte, war die Lage wirklich ernst.
Traudel streckte ihre Hand aus und strich Emilia liebevoll über die Schulter. »Es tut mir leid, dass ich jetzt weg muss«, sagte sie bedauernd, »aber ich bin mit Regina zum Kino verabredet. Sie hat bereits die Karten, und ich muss los. Aber wenn ich etwas tun kann, dann sagst du’s mir sofort, gell? Was auch immer dort draußen los ist, die Lauterbachs können sich auf uns verlassen.«
»Danke, Traudel, und viel Spaß euch beiden im Kino«, antwortete Emilia. Ihr war schon ein wenig leichter ums Herz, seitdem sie über das Dilemma auf dem Hof erzählen konnte.
»Aber warum hat Ben gesagt, es ist das Aus für sie? Warum kann er nicht einfach neue Balken einziehen?«, wandte Emilia sich an ihren Vater.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Sebastian. »Vielleicht wird das Bauvorhaben dann zu umfangreich und zu teuer? Und vielleicht bekommen sie andererseits Probleme, wenn sie es nicht tun, und das Gästehaus eröffnen, um damit Geld zu verdienen? Sie sind bald zu viert, und das Leben ist teuer.«
»Können sie denn nicht zur Bank gehen und sich Geld leihen? Damit wird doch immer geworben. Wenn du etwas haben möchtest, und du hast nicht genug Geld, dann leiht es dir die Bank, das geht ganz schnell und problemlos«, sagte Emilia.
»Schnell schon, problemlos allerdings nicht«, antwortete ihr Vater ernsthaft. Er lehnte sich zurück und erklärte seiner heranwachsenden Tochter die Zusammenhänge von Krediten, Zinsen und Ratenzahlungen und den möglichen Fallen, in die viele Menschen dadurch gerieten.
Emilia hörte konzentriert zu und seufzte dann tief auf. »Mensch, Papa, das Erwachsenenleben ist aber ganz schön kompliziert!«, meinte sie.
»Ja, manchmal schon«, gab ihr Vater zu. »Aber wenn man nicht allein ist, wenn man einen guten Partner hat, so wie Ben und Marie, dann hilft das sehr und macht alles leichter.«
Über das junge Gesicht seiner Tochter glitt ein Schatten. »Aber, Papa, wie ist es denn dann für dich? Mama ist doch nicht mehr bei dir.«
Sebastian musste schlucken, so tief berührte ihn Emilias Einfühlungsvermögen. »In Gedanken ist Mama bei mir«, antwortete er leise, »und oft rede ich mit ihr. Das hilft auch. Und außerdem bin ich ja nicht allein. Ich habe dich und meinen Vater und Traudel, und ihr helft mir unglaublich viel!«
Emilias Augen wurden ganz groß. »Echt? Ich helfe dir, Papa? Bei diesem ganzen Erwachsenenkram, von dem ich eigentlich noch gar nichts verstehe? Wie denn?«
Sebastian lächelte sein Kind voller Liebe und in tiefem Einverständnis an. »Ganz einfach, weil du da bist, Emilia Rose Seefeld!«, antwortete er schlicht.
Das Mädchen richtete sich auf und saß sehr aufrecht am Tisch. Wenn ihr Papa sie mit ihrem vollen Namen ansprach, dann war es ihm sehr ernst mit seinen Worten! Emilia fühlte sich auf einmal ziemlich erwachsen und es war ein gutes Gefühl.
Als hätte er ihre Gedanken lesen können, zwinkerte ihr Vater ihr verschmitzt zu und meinte: »Das heißt aber nicht, dass Erwachsene nicht auch ihren Spaß haben können! Wie wäre es denn jetzt mit einer großen Portion Schokoladeneis und einer Partie Rummikub oder Streitpatience?«
»Streitpatience!«, rief Emilia mit kindlicher Begeisterung. »Du kannst dich immer so schön ärgern, wenn ich klopfe, weil du etwas übersehen hast, Papa!«
»Kleine Kröte!«, brummte ihr Vater und gab ihr einen zärtlichen Nasenstüber. »Und darf es vielleicht auch etwas Sahne für die junge Dame sein?«
»Klar, Papa!« Das Mädchen war schon auf dem Weg zum Kühlschrank. »Schokieis ist doch erst richtig toll mit Sahne.«
Und so endete dieser Tag im Doktorhaus wie so häufig: Gemeinsam am Küchentisch sitzend, mit Gelächter und hitzigen Debatten um falsch angelegte Karten, mit Spaß und dem wundervollen Gefühl der Zusammengehörigkeit.
*
Lisa Ecker föhnte ihrer Kundin die Haare, und in Gedanken rechnete sie. Vor drei Tagen hatte sie einen, scharlachroten Brief in den Kasten geworfen. Das hieß, dass er inzwischen auf dem Ebereschenhof angekommen sein musste und hoffentlich recht viel Staub aufgewirbelt hatte.
Denn was würde der treue und ehrliche Benjamin tun? Um jeden Verdacht von sich zu weisen wäre er höchstwahrscheinlich zu seiner Frau gegangen, um ihr den Brief zu zeigen. So herrlich ahnungslos und unschuldig und ganz darauf bedacht, bei der lieben Marie nicht in ein schlechtes Licht zu geraten.
Und das schwangere Mariechen würde ihm natürlich glauben wollen …, aber konnte sie das völlig uneingeschränkt? Denn sagte man nicht: Wo Rauch ist, ist auch Feuer? Könnte nicht vielleicht doch etwas dran sein an dieser mysteriösen Geschichte von Ben und einer anderen Frau? Ehe sie den kleinen Trick mit dem heißen Slip in Angriff nahm, würde sie noch …
»Hey, Lisa! Wenn du jetzt noch weiter föhnst, steckst du meine Haare in Brand! Sie sind längst knochentrocken!«, beschwerte sich ihre Kundin.
»Was du nicht sagst! Da war ich wohl mit den Gedanken woanders«, flötete Lisa.
»Kann man wohl so sagen!«, brummelte die Frau und beschloss, heute kein Trinkgeld zu geben.
Beim Kassieren guckte Lisa ziemlich schnippisch, verkniff sich aber eine Bemerkung. Sollte die alte Schabracke doch ihren zusätzlichen Euro behalten, sie hatte ihr für das Shampoo sowieso den doppelten Preis berechnet.
»Tschau, tschau!«, sagte Lisa zerstreut und machte sich auf den Weg in ihre Wohnung. Sie wollte sich für den Besuch auf dem Ebereschenhof umziehen.
Wenig später stand sie vor ihrem großen Spiegel und musterte sich zufrieden. Ben sollten die Augen aus dem Kopf fallen!
Lisa trug extrem knappe, weiße Shorts, bei denen schon mal der Ansatz einer Pobacke hervor blitzte. Dazu ein bauchfreies, sehr tief ausgeschnittenes, schwarzes Top, das viel von ihrem üppigen Busen sehen ließ. Schließlich wäre es schade, ihn zu verstecken, er hatte sie bei einem Münchner Schönheitschirurgen ein kleines Vermögen gekostet.
Sehr zufrieden mit ihrem Aussehen wollte Lisa die Wohnung verlassen, als ihr im letzten Augenblick noch etwas einfiel.
Wie war das doch mit dieser Krimifrau namens Tonya? Was war so wichtig, damit der Spaß nicht zu schnell vorbei war? Richtig: Sie musste unauffällig sein!
Also pellte Lisa sich wieder aus ihren engen Klamotten heraus und suchte nach etwas weniger Auffälligem in ihrem Schrank. Das war gar nicht so einfach, aber schließlich stand sie in einem neuen Outfit vor dem Spiegel, das für ihre Rolle als gute Freundin wohl angemessener war. Jetzt trug sie nicht zu enge Shorts aus hellem Leinen, die zwar auch ihre langen, gebräunten Beine sehen ließen, aber ansonsten nichts. Dazu eine weiße, ärmellose Bluse, die leicht und luftig ihre Figur umspielte. Mit einem Seufzer entfernte Lisa auch die künstlichen Wimpern und ersetzte den tiefroten Lippenstift durch einen Hauch farbiges Lipgloss. Sie fand sich durch und durch langweilig, aber wenn es wirkte, bitte schön!
Sie hatte ihr Autoradio voll aufgedreht und kam ausgesprochen guter Dinge auf dem Hof an. Als sie ausstieg, fiel ihr als erstes die Stille auf, nirgendwo hörte man das sonst allgegenwärtige Hämmern, Sägen oder Klopfen. Die Küchentür stand offen, und Lisa trat vorsichtig ein.
»Hallo? Marie? Ben? Seid ihr hier irgendwo?« rief sie.
»Hier oben!«, antwortete Maries Stimme gedämpft. »Warte, ich komme runter.«
Lisa blieb in der Diele stehen und beobachtete ihre Freundin, die vorsichtig die Treppe hinunter ging, über deren Stufen sie sonst achtlos gelaufen war. Die Treppe war steil, und die junge Frau hielt sich am Geländer fest. Maries Gestalt hatte sich in den letzten Wochen stark verändert; kein Wunder, es waren zwei kleine Menschen, die in ihr heranwuchsen. Ihr Bauch hatte nun einen beachtlichen Umfang erreicht, und ihr Gang war langsamer und ein wenig schwerfällig geworden.
Lisa schaute ihrer Freundin aufmerksam ins Gesicht. Marie wirkte blass, und unter den Augen zeichneten sich dunkle Schatten ab. Waren das nun Spuren der Schwangerschaft, von Schlafmangel oder von Sorgen? Vielleicht gar wegen eines gewissen anonymen Briefes?
»Hallo, Lisa, schön, dass du da bist!«, begrüßte Marie arglos ihre Freundin.
»Ich habe mir heute Nachmittag frei genommen und dachte, ich schau mal bei euch vorbei«, antwortete Lisa. »Hier, ich habe Kuchen mitgebracht.«
»Danke, das ist lieb«, freute sich Marie. »Längeres Stehen fällt mir langsam schwer, und backen kann man nun mal schlecht im Sitzen.«
Lisa fragte sich im Stillen, wieso überhaupt jemand den Wunsch verspüren sollte, seine Zeit in der Küche zu verbringen, es gab doch genügend Bäckereien. Sie hatte Pflaumenkuchen und Nusstörtchen gekauft, warum sich also dafür Hände und Hochglanzküche schmutzig machen?
Marie wirkte tatsächlich etwas angegriffen, deshalb schlug Lisa vor: »Weshalb setzt du dich nicht draußen in die Laube? Ich koche eben den Kaffee und bringe ihn dann zu uns raus.«
»Danke!« Marie drückte ihrer Freundin ein Küsschen auf die Wange. »Das ist wirklich nett von dir. Aber koch den Kaffee bitte nur für Ben und dich, ich trinke in der Schwangerschaft lieber etwas anderes.« Sie griff zu dem Krug mit erfrischendem Eistee und trug ihn hinaus zu ihrem Lieblingsplatz im Garten. Dort stand die alte Laube aus verschnörkeltem Eisen, das im Laufe der Jahre eine rostige Patina bekommen hatte. Weinranken überwucherten das Gerüst und wehten wie zarte Vorhänge zwischen den filigranen Eisenstäben. Hier hielt Marie sich am liebsten auf, manchmal sogar im Winter, wenn sie sich in eine dicke Wolldecke einmummeln musste. Entspannt lehnte sie sich auf den weichen Kissen zurück und ruhte sich vom Einräumen des Kinderzimmers aus. Ben hatte eine alte, unansehnliche Kommode vom Speicher geholt, mit einem angeschraubten Brett zu einer Wickelkommode vergrößert, und Marie hatte alles in einem sanften Salbeigrün gestrichen. Mit den neuen Knäufen und den runden Füßen, die Marie in mattem Gold abgesetzt hatte, sah der Wickeltisch nun wunderschön aus.
Während die werdende Mutter ihre Gedanken ins Blaue wandern ließ, wartete Lisa in der Küche darauf, dass der Kaffee in der Maschine durchgelaufen war. Sie hörte Schritte draußen auf dem Kiesweg und schaute erwartungsvoll zur Küchentür, denn sie hoffte, Ben zu treffen.
Der Mann betrat rückwärts die Küche. Er trug zwei übereinander gestapelte, große Kartons vor sich her und hatte die Tür mit dem Ellenbogen geöffnet. »Hallo, Schatz«, sagte er ein wenig atemlos, »hier sind die Sachen vom …«
»Ich bin zwar nicht dein Schatz, aber helfen kann ich dir doch trotzdem, gell?«, unterbrach ihn eine bekannte Frauenstimme. Lisa war unbemerkt zu ihm getreten und hielt die schwere Tür weit geöffnet. »Soll ich dir einen Karton abnehmen?«
»Äh, nein, danke, es geht schon«, antwortete Ben überrascht. Er stellte seine Last ab und drehte sich zu der Besucherin um. »Sie waren nicht schwer, nur unhandlich«, erklärte er.
»Hallo, Ben!«, begrüßte ihn Lisa. Sie verteilte zwar ihre üblichen Luftküsschen, war aber deutlich zurückhaltender als früher, wie der Mann sofort bemerkte. »Der Kaffee ist fertig, und ich wollte ihn eben zu Marie in die Laube bringen. Du kommst doch mit zu uns hinaus?«
»Geh du schon vor, ich komme gleich nach«, antwortete Ben reserviert. Er war sehr zurückhaltend in Lisas Gegenwart, weil ihm ihre aufdringliche Art nicht gefiel. So ganz konnte er nicht verstehen, was Marie mit dieser oberflächlichen und oft ordinär wirkenden Frau verband, aber bisher hatte er nichts dazu gesagt. Er ging hinüber ins Badezimmer, um sich den Staub von den Händen zu waschen, und setzte sich dann zu den Freundinnen in die Laube.
Lisa musterte ihn aus den Augenwinkeln. Auch Ben wirkte stiller als sonst. Die junge Frau spielte mit ihrer Kuchengabel. »Und? Wie geht es euch denn so?«, fragte sie.
»Eigentlich ganz gut«, antwortete Marie. »Mit den Babys ist alles bestens und mit mir auch. Ich werde nur viel schneller müde als sonst.«
»Du siehst auch etwas erschöpft aus«, tastete Lisa sich vor, »so als ob gerade alles ziemlich anstrengend ist.«
»Na, das kann man wohl gut nachvollziehen, auch wenn man nicht schwanger ist!«, antwortete Ben. Er klang leicht vorwurfsvoll, denn er fand Lisas Bemerkung über Maries Aussehen etwas taktlos.
Aber seine Frau schien es anders zu empfinden, denn sie antwortete gleichmäßig freundlich: »Ich weiß, was du meinst, Lisa, aber es sind nicht nur die Schwangerschaft und der Umbau. Wir haben jetzt ein wirkliches Problem.«
Lisa senkte kurz den Blick, um den Triumph in ihren Augen zu verbergen. Dann gelang es ihr, teilnehmend und besorgt dreinzublicken. »Welches Problem meinst du denn?« Innerlich frohlockte sie! Käme jetzt der Brief zur Sprache, würde sie natürlich erst einmal voller Empörung jeden Verdacht von Ben abweisen und sich als echte Freundin erweisen. Aber später, wenn sie mit Marie allein wäre, würde sie unmerklich die Zweifel an seiner Unschuld wecken. »Ist denn irgendetwas passiert, was euch besondere Sorgen macht?«, fragte sie scheinheilig.
»Das kann wohl sagen!«, antwortete Ben mit Bitterkeit in der Stimme. »Im alten Stall haben wir einen Schaden an der Bausubstanz entdeckt, den wir nicht auffangen können. Damit ist unser schöner Plan, hier Ferienwohnungen einzurichten, gescheitert.«
»Was?« Lisas Fassungslosigkeit und das Nichtbegreifen waren nicht gespielt. Wovon redete dieser Mann? Von einem Bauschaden? Und deshalb hatten die Stress? Wo blieb denn nun dieser verdammte Brief! »Du meinst, mit dem alten Stall ist etwas nicht in Ordnung? Das gibt’s doch gar nicht!«
Marie griff nach ihrer Hand. »Das ist lieb von dir, dass du so mit uns fühlst!«, antwortete sie weich. »Wir waren zuerst auch völlig fertig, als wir es entdeckt hatten.«
Lisa holte tief Luft. »Ja, äh, kann ich mir gut vorstellen«, murmelte sie.
»Tja, das war schon ein harter Schlag«, warf Benjamin ein. »Aber langsam kommen wir auch damit klar. Jetzt ruht das Projekt, und ich muss mich nach mehr neuen Aufträgen umschauen. Deshalb muss ich auch jetzt los, die Brauerei Schwartz will anbauen, und ich habe einen Termin mit dem alten Schwartz. Danke für die Kaffeepause, Mädels!« Er nickte den beiden Frauen freundlich zu und verabschiedete sich mit einem zärtlichen Kuss von Marie. »Bis nachher, mein Schatz, pass gut auf euch auf!« Seine Hand ruhte kurz auf dem Bauch seiner Frau, es war ein liebevoller Abschiedsgruß an die Babys. Lisa winkte er zu. »Man sieht sich!« Damit war er schon zur Tür hinaus, und man hörte seinen Wagen vom Hof fahren.
Lisa kaute immer noch an der Situation, mit der sie so nicht gerechnet hatte. Hatten die beiden ihr etwas verschwiegen? Oder war der Brief gar nicht angekommen? Sie musste unbedingt einen Blick in Bens Büro werfen und dort ein wenig herum schnüffeln!
»Ich gehe mal kurz in euer Bad, in Ordnung?«, fragte sie.
»Natürlich, du weißt ja, wo es ist«, antwortete Marie arglos. Sie bediente sich mit einem Stückchen Pflaumenkuchen und schien damit für die nächsten Minuten beschäftigt zu sein.
Lisa verschwand in der Diele und achtete darauf, die Tür fest zu schließen. Anstatt ins Gäste-WC zu gehen, schlüpfte sie in Bens Büro, das neben der Haustür lag. In Windeseile blätterte sie sich durch die eingegangene Post und schaute in die Schubladen vom Schreibtisch. Nichts außer Büroartikeln und geschäftlichen Unterlagen. »Sch…!«, fluchte Lisa und wollte schon wieder gehen, als ihr der Papierkorb einfiel. Rasch tauchte sie mit der Hand zwischen die Papiere, die dort lagen. Und siehe da: Ganz unten lagen sehr viele, äußerst sorgsam zerkleinerte Schnipsel eines Briefes, dessen scharlachrote Farbe ihr sehr bekannt vorkam!
»Also doch!«, stellte sie zufrieden fest. »Und offensichtlich willst du nicht, dass die liebe Marie davon etwas zu sehen bekommt? Warten wir doch einmal ab, was du mit meinem nächsten Brief tun wirst!«
Sorgfältig bedeckte Lisa die Schnipsel wieder mit den anderen Papieren, schloss geräuschlos die Tür uns kehrte in die Laube zurück. Dort setzte sie sich zu Marie an den Tisch, und die beiden Freundinnen verplauderten den Rest des Nachmittags. Das unerschöpfliche Thema waren natürlich die Zwillinge, für die Lisa Interesse heuchelte. Nur als es um die Gestaltung des Kinderzimmers und mögliche Namen ging, war Lisa wirklich bei der Sache. Wenn es nach ihr ginge, wäre das Kinderzimmer ein quietschbunter Abklatsch vom Disneyland, und ihre Namensvorschläge klangen in Maries Ohren ziemlich abenteuerlich: Queeny-Mae und Ocean-Felice für Mädchen und Kevin-Taylor und Jemy-Blue für Jungs.
»Doch, das klingt … besonders«, erwiderte Marie. »Wir, äh, wir werden es uns überlegen.«
»Das ist doch mal was anderes als dieser ganze altmodische Kram!«, befand Lisa zufrieden.
Marie lächelte nur und behielt eine Antwort für sich. Ben und sie fanden gerade die alten Namen sehr schön und in diese Richtung würde ihre Entscheidung gehen.
Sie begleitete ihre Freundin zu deren Auto, wo Lisa beim Abschiednehmen sagte: »Das ist ja wirklich eine mittlere Katastrophe mit dem verfaulten Gebälk, aber so wie euch kenne, werdet ihr auch das hinkriegen. Und du weißt ja, Marie, egal, was passiert, du kannst dich auf mich verlassen! Ein Anruf, und ich komme! Du kannst über alles mit mir reden!«
»Das weiß ich, Lisa, und ich danke dir dafür!« Marie drückte sie an sich. »Du bist zwar manchmal ein verrücktes Huhn, aber meine Freundin! Ich bin froh, dass ich dich habe.«
»Also dann, bis bald!«, winkte Lisa und machte sich auf den Heimweg.
In Gedanken formulierte sie bereits ihren nächsten Brief.
*
Der Sommer war in einen herrlichen Spätsommer übergegangen, der die ersten Vorahnungen des Herbstes in sich trug. Noch waren die Blätter an den Bäumen grün, aber es lag bereits ein goldener Schimmer über allem. Die Ebereschen auf dem Hof reiften ihrer leuchtenden Farbe entgegen, und am frühen Morgen verzauberten Nebelschwaden das Land.
Marie und ihren Babys ging es sehr gut. Sie wurden engmaschig von einer Gynäkologin der Uniklinik, in der die Entbindung stattfinden sollte, Doktor Seefeld und Hebamme Anna überwacht. Benjamin war der aufmerksamste Ehemann und werdende Vater, den eine Frau sich nur wünschen kann. Er las Marie jeden Wunsch von den Augen ab und achtete vor allem darauf, dass sie sich nicht überanstrengte und ausreichend Ruhe bekam.
Manchmal lachte Marie ihn sehr zärtlich aus. »Ben, ich bin nicht krank, nur schwanger! Ich zerbrösele schon nicht in meine Einzelteile, wenn ich jetzt aus diesem Sessel aufstehe, nach oben gehe und mir meine Strickjacke selbst hole.«
»Nein, das nicht, aber vielleicht stolperst du auf der Treppe oder stößt irgendwo gegen! Das alles passiert nicht, wenn ich dir die Jacke hole«, erklärte Ben entschieden.
Marie seufzte nachsichtig und nur ein klitzekleines bisschen genervt von seiner Überbesorgnis. »Mein Herzblatt, es ist sehr süß, dass du so auf uns aufpasst, aber ich bin weder leichtsinnig, noch unbeweglich wie ein Walross«, sagte sie und fügte mit einem kleinen Schnaufer hinzu, »noch nicht! Außerdem bist du wegen deiner Aufträge tagsüber viel unterwegs, dann muss ich doch auch allein klarkommen. Und wenn du diesen Auftrag in Norwegen annimmst, von dem Niklas gesprochen hat, dann bist du sogar vier Wochen fort.«
»Eben! Und weil das leider so ist, nehme ich dir alles ab, wenn ich zu Hause bin!«, beendete er die Diskussion, drückte einen Kuss auf Maries Bauch und ging, um die Jacke zu holen.
Marie kuschelte sich ergeben in ihren Sessel und lächelte. Eigentlich war es doch wunderschön, so umsorgt zu sein! Wieviel schlimmer wäre es, wenn ihr Mann das Familienleben in gewohnter Weise weiterführen würde, und die Schwangerschaft nur eine hübsche Randerscheinung wäre. Hauptsache, das Essen steht pünktlich auf dem Tisch, und im Schrank hängen gebügelte Hemden!
»Wenn du dich manchmal etwas überbehütet und bevormundet fühlst, dann hast du ein Luxusproblem, meine Liebe!«, ermahnte sie sich selbst. Und als Ben nicht nur mit ihrer Strickjacke, sondern noch mit einer Schale schwarzer, zuckersüßer Brombeeren auf Joghurteis zu ihr ins Wohnzimmer zurückkehrte, fühlte Marie sich verwöhnt wie eine Königin.
Als ihr Mann sich neben sie setzte, spürte er den Brief in seiner Hosentasche knistern. Den dritten scharlachroten Brief ohne Namen.
Bens Gedanken drehten sich im Kreis.
Als der zweite Brief eingetroffen war, hatten sie gerade einen Termin bei Doktor Seefeld hinter sich. Maries Blutdruck ging in die Höhe, nicht besorgniserregend, aber es musste im Auge behalten werden. Der Arzt empfahl gemäßigte Bewegung an frischer Luft, und vor allen Dingen sollte jeder Stress vermieden werden.
Innerlich verfluchte Ben die Situation, er hasste es, ein Geheimnis vor Marie zu haben! Äußerlich bewahrte er Ruhe, kochte Kräutertee aus Mistel, Melisse und Weißdorn und ließ seine Frau, soweit seine Arbeit es erlaubte, nicht aus den Augen.
Aber natürlich beunruhigten ihn die Briefe. Ben schwankte zwischen dem Wunsch, es möge sang- und klanglos wieder aufhören, dann müsste man jetzt nicht darüber reden. Oder der Möglichkeit, die Schreiberin aufzuspüren und ihr gehörig die Hölle heißzumachen! Um nach möglichen Hinweisen suchen zu können, hatte er den zweiten Brief nicht vernichtet, sondern ganz hinten in der untersten Schreibtischschublade versteckt. Dann herrschte eine gewisse Zeit Ruh und Ben dachte schon, der Spuk sei vorbei, aber heute war der dritte Brief gekommen.
Und nun?
Benjamin öffnete gerade seinen Mund, um Marie von den hässlichen Briefen zu erzählen, als seine Frau tief aufseufzte und sagte: »Weißt du, was, mein Schatz? Ich lasse mir jetzt ein herrliches Schaumbad ein und lege mich vorm Schlafengehen noch ganz entspannt in die Wanne. Du wolltest dir doch sowieso noch im Fernsehen den Film über das Projekt in Norwegen angucken, bei dem Niklas mitmacht. Mich interessiert es zwar auch, aber ich glaube, heute Abend fühle ich mich in der Wanne wohler als im Sessel.«
»Gute Idee.« Ben ging mit seiner Frau nach oben und ließ ihr ein entspannendes Bad ein, während sie sich im Schlafzimmer auszog und ihr Bettzeug bereit legte. Dann dämpfte er das Licht, zündete Kerzen an und half seiner wunderschönen Frau in die Wanne. Auf einen Stuhl in Reichweite stellte er einen Teller mit Apfelsinenspalten und den Eistee, den Marie so gerne trank, dann schaltete er leise Musik an. »Brauchst du noch etwas, mein Schatz?«, fragte er.
»Bin wunschlos glücklich!«, schnurrte Marie. »Ich fühle mich verwöhnt wie Königin Kleopatra.«
Ben küsste ihre zarte Schulter, die seidig-feucht glänzend aus dem Schaum heraus ragte. »Königin Kleopatra war nur schön«, sagte er, »aber du bist schön und schwanger. Da kannst du wohl einen besseren Service erwarten als eine ägyptische Königin.«
»Ach, Ben!« Marie legte ihre Hände um sein Gesicht und schaute ihn voller Liebe an. »Manchmal kann ich gar nicht an das große Glück glauben, das mir einen so wundervollen Mann geschenkt hat.«
»Das solltest du aber!«, antwortete Ben unerwartet ernst. »Solange ich lebe, gehöre ich an deine Seite, Marie!«
»Ich weiß!« Die junge Frau schwieg einen Augenblick. Sie suchte nach den richtigen Worten, um erklären zu können, was sie tief im Inneren empfand. »Ich genieße es, schwanger zu sein, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Aber gleichzeitig habe ich oft auch Angst, Ben. Vor der Welt da draußen. Es gibt so viel Schlimmes und Gemeines, und ich fühle mich oft so verwundbar. Wenn ich in der Zeitung das Bild von dem angefahrenen Reh sehe, das jetzt in einer Wildtierstation wieder aufgepäppelt wird, dann muss ich weinen.« Ihre Augen schwammen bereits in Tränen, und gleichzeitig versuchte sie zu lachen. »Siehst du? Sogar jetzt, wo ich nur darüber rede, weine ich schon los. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch und es sind nur die Hormone, die mich so empfindlich machen. Es wird sich ja auch wieder ändern.
Aber jetzt bin ich froh, dass ich hier in unserer heilen Welt leben kann. Unsere Liebe ist wie ein Mantel, der mich gegen alles Bedrohliche von außen beschützt. Das ist so schön, Ben, und ich bin dir sehr dankbar dafür. Ich weiß, dass du alles tust, damit unser Leben und unser Zuhause ein sicherer Hort inmitten der geschäftigen Welt bleibt.«
Zum ersten Mal konnte Benjamin den Blick ihrer klaren Augen kaum ertragen. Er beugte sich vor und küsste Marie, dann vergewisserte er sich noch einmal, dass sie alles in Reichweite hatte, was sie brauchte, und ging aus dem Badezimmer.
Bei jedem Schritt knisterte der scharlachrote Brief in seiner Tasche kaum wahrnehmbar, aber für ihn hörte es sich lauter an als das wilde Lodern eines zerstörerischen Feuers.
Benjamin ging hinunter in sein kleines Büro, schloss die Tür, setzte sich an seinen Schreibtisch und öffnete den Brief. Dieser schien länger zu sein als die beiden vorherigen.
Mein geliebter Ben,
in Gedanken bin ich bei dir und küsse Deine Lippen, Deinen Hals, Deine Brust. Ich liege auf Dir, mein prächtiger, starker Mann, und ich trage nichts außer meiner heißen Haut, und du hast …
Der Brief schilderte sehr ausführlich und äußerst deutlich die Praktiken des Liebesspiels, das angeblich zwischen der unbekannten Briefschreiberin und Ben stattgefunden hatte. Es stieß ihn ab, das zu lesen! Seine Frau und er teilten in der Liebe eine tiefe, innige Intimität, die wunderschön war und niemanden außer sie als Paar etwas anging. Jetzt tat die Schreiberin so, als sei die Unbekannte selbst Teil dieser Verbindung geworden, und allein dafür hätte Ben ihr schon den Hals umdrehen können! Dass eine Fremde mit ihren Gedanken versuchte, Marie auszulöschen und sich selbst und Benjamin als Paar beschrieb, verletzte ihn und machte ihn unheimlich wütend! Und wenn er schon so fühlte, wie würde es dann Marie damit ergehen!
Aber es sollte noch schlimmer werden! Nachdem die Unbekannte aufgehört hatte, die körperliche Liebe zu schildern, ergoss sie Bosheit und Häme über Marie!
Geliebter, ich würde verrückt werden, wenn ich nicht wüsste, wie Du zu mir stehst! Aber weil ich weiß, wie Du über Deine dicke, langweilige Frau denkst, kann ich die Stunden unserer Trennung überstehen. Immer wieder denke ich daran, wie wir im Bett liegen und über Deine Hochzeit lachen. Wie ernst Dein Frauchen im biederen Dirndl den ganzen Quatsch genommen hat! Ist das herrlich! Und Du als »liebender Ehemann“ stehst daneben und siehst unglaublich heiß aus und ich weiß genau, was Du denkst …, ja, mein Starker, genau das werden wir tun, wenn wir uns wieder treffen!
Wie dumm Marie ist, so dumm, einfältig und langweilig! Du verdienst einen Orden, weil Du bis zur Geburt bei der fetten Langweilerin aushältst! Und wenn sie dann den Ebereschenhof verkaufen muss, weiß ich, wie wir den Preis in die Höhe treiben können, damit wir ein ordentliches Stück vom Kuchen abbekommen. Das ist dann die Entschädigung für die Zeiten, in denen wir aufeinander verzichten mussten!
Marie sieht jetzt schon aus wie eine aufgeplusterte Glucke, die auf ihrem Nest hockt. Sie bekommt die Gören, und ich bekomme Dich – jetzt rat‘ doch mal, wer den besseren Teil erwischt? Lass uns feiern, wenn wir uns das nächste Mal treffen! Wir lachen sie aus, »die ahnungslose, dämliche graue Maus mit ihrem dicken Bauch«, wie Du sie immer nennst. Wir lachen zusammen und sagen schmutzige Sachen über sie und haben hemmungslosen, wilden Sex, bald, bald, bald!
DEINE EINZIGE
Benjamin zerknüllte den Brief und hieb mit der geschlossenen Faust auf den Tisch. »Himmel, hilf!«, knirschte er zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. »Wenn ich diese Frau erwische – ich weiß nicht, was ich dann tue! Wie kann sie wagen, so etwas Gemeines, Hinterhältiges, Widerliches über Marie zu sagen! Ich könnte dieses widerwärtige Weibsstück umbringen!«
Er atmete ein paar Mal tief durch, um sich zu beruhigen, und griff dann zum Handy. Mit irgendjemandem musste er über diesen Dreck reden und sich Rat holen!
»Hallo, Niklas!«, sagte er.
»Hallo, Ben!«, klang es freudig aus Norwegen zurück. »Schön, von dir zu hören! Wie geht’s denn so bei euch? Wie ist es als werdender Vater, und wie geht es Marie? Ist alles in Ordnung mit ihr und den Kleinen?«
»Ja, danke, gesundheitlich ist alles bis jetzt in Ordnung«, sagte Ben.
Darauf blieb es einen Augenblick lang still am Telefon, dann fragte Niklas vorsichtig nach: »Gesundheitlich? Ist denn – irgendetwas anderes nicht in Ordnung bei euch?«
»Kann man wohl so sagen!«, knurrte Ben. Und dann erzählte er seinem besten Freund von den Briefen und seinem großen Dilemma, dass er nicht wusste, wie er sich verhalten sollte.
»Hmm«, überlegte Niklas, »ist es denn wirklich so schlimm, dass du überlegst, Marie jetzt damit behelligen zu müssen? Oder sind es vielleicht nur die Schwärmereien eines verknallten Teenies, die sich in dich verguckt hat?«
»Das ist keine harmlose, dumme Teenagerschwärmerei, das hier ist eine ganz andere Hausnummer!«, wetterte Ben. »Kleine Kostprobe gefällig?«
Er las seinem Freund die Briefe vor.
Zunächst herrschte betroffenes Schweigen am anderen Ende der Verbindung. Dann kam ein: »Mann, was für eine Gemeinheit!« Niklas schluckte hörbar. »Wer immer das auch geschrieben hat, verdient nur das Allerschlechteste! Ich kann verstehen, dass du Marie mit diesem Schmutz nicht belästigen willst, aber wahrscheinlich kommst du nicht darum herum. Du hast überhaupt keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte?«
»Nein, ich kenne niemanden, dem ich etwas derart Gemeines zutraue«, antwortete Ben. Dann zögerte er kurz. »Warte mal …, da gibt es eine Freundin von Marie, die sich bei unserer Hochzeit ziemlich daneben benommen und sich an mich herangemacht hat. Aber irgendwie …«, er unterbrach sich und schüttelte dann den Kopf. »Nein, vergiss es. Sie hatte wohl nur etwas zu viel getrunken und war neben der Spur. So eine Gemeinheit wie diese Briefe, das ist ja schon richtig bösartig, nein, das traue ich Lisa nicht zu. Außerdem ist sie Maries Freundin. Und wenn ich es mir so überlege: Sie ist zwar nicht mein Fall, aber wenn sie in der letzten Zeit hier zu Besuch war, dann war sie eigentlich ganz nett und immer freundlich und fürsorglich gegenüber Marie. Das auf der Hochzeit ist wirklich nur ein einmaliger Ausrutscher gewesen. Wir sollten es nicht dem Zeug hier in Verbindung bringen, das ist nicht richtig!«
»Mensch, Kumpel, es tut mir leid, dass du dich ausgerechnet in dieser Zeit damit befassen musst!«, meinte Niklas. »Und ich finde es gut, dass du mich ins Vertrauen gezogen hast. Du wolltest meinen Rat, und hier ist er: Rede mit Marie! Eigentlich hättest du es schon längst tun sollen. Ich finde es auch schlimm, sie jetzt mit solchen Dingen belästigen zu müssen, aber es geht nicht anders. Stell dir nur mal vor, sie findet einen dieser Briefe! Natürlich wird sie dir glauben, dass nichts dran ist an diesem Mist, aber verletzen wird sie es schon. Euer gegenseitiges Vertrauen ist euer stärkster Schutz! Du solltest ihr nichts verschweigen, selbst wenn es erst einmal unangenehm sein wird. Und an deiner Stelle würde mir auch überlegen, damit zur Polizei zu gehen und Anzeige gegen Unbekannt zu stellen!«
»Oh, Mann, und das macht dann die Runde durchs ganze Dorf!«, seufzte Ben entsetzt.
Niklas lachte leise. »Tja, Dienstgeheimnis und Buschtrommel heben sich wohl gegenseitig auf. Aber vielleicht muss es gar nicht so weit kommen, vielleicht gibt diese …, diese Schlampe einfach auf.«
»Hoffen wir’s, aber ich glaube es eher nicht!«, antwortete Ben düster.
Niklas wollte seinen Freund ein wenig aufheitern und meinte: »Hey, hast du eigentlich bemerkt, dass ich dich mit keiner Silbe gefragt habe, ob an dieser Geschichte auch ein Fünkchen Wahres ist?«
»Dann, mein Lieber, wäre kein norwegischer Fjord tief genug gewesen, um dich darin vor mir zu verstecken!«, brummte Ben mit einem Lachen in der Stimme. »Und ich wäre schneller dort gewesen, als du bis drei zählen kannst!«
»Werd’s mir merken!«, grinste Niklas. »Mach’s gut, Kumpel! Pass auf dich auf, und grüß Marie von mir. Und wenn was ist, melde dich!«
»Danke, Niklas, und gute Nacht.«
Benjamin schob den Brief vorläufig zu den anderen nach ganz hinten in die Schublade. Dann machte er die übliche Abendrunde, bei der er Fenster und Türen im Erdgeschoss vor der Nacht verschloss und die Lichter löschte. Anschließend ging er ins Bad und half Marie aus der Wanne. Zärtlich trocknete er sie ab, legte sie auf ihr Bett und begann, ihren schönen, gerundeten Körper mit einem duftenden Öl zu massieren.
»Mmmmmh!« Marie schnurrte wie eine kleine Katze, und dann gähnte sie ausgiebig. »Wenn du wüsstest, wie gut und entspannend sich das anfühlt«, murmelte sie mit geschlossenen Augen. »Ich bin … schon … fast eingeschlafen.«
»Das sollst du auch, mein Herz«, antwortete Ben leise. Er drückte zwei Küsse auf Maries Bauch, für jedes Baby einen, dann deckte er zärtlich die alten, spitzenbesetzten Leinentücher über seine Frau. »Schlaf gut, Liebste.«
Er legte sich neben sie ins Bett, zog sie sanft in seine Umarmung und legte seine Wange gegen ihren Kopf. Wie oft waren sie so eingeschlafen, Marie an seine Brust gekuschelt und er mit seinem Gesicht im Duft ihrer seidigen Haare. Ben lauschte ihren ruhigen, regelmäßigen Atemzügen und wünschte verzweifelt, er könnte den gleichen friedlichen Schlaf finden wie seine Frau.
Aber so war es nicht.
Die Gemeinheiten der Briefe mischten sich mit der Erinnerung an Niklas‘ Worte. Er wusste, dass er mit seiner Frau reden musste, ganz dringend, aber er konnte es nicht übers Herz bringen. Wie widerwärtig die unbekannte Schreiberin über Marie redete! Er konnte es ihr einfach nicht antun, diesen Dreck lesen zu müssen.
*
Als der junge Zimmermann für drei Tage zu einem Auftrag fort musste, der ihn bis in die Alpen führte, schickte Lisa wieder einen Brief. Sie wusste, jetzt würde Marie die Post selbst entgegen nehmen!
Am dritten Tag, einem dunklen, stürmischen Herbsttag, der ein aufziehendes Unwetter in sich barg, fuhr Lisa zum Ebereschenhof hinaus, um genau dann dort zu sein, wenn der Kräutner Michl die Post abliefern würde.
Es war früher Nachmittag und unverhältnismäßig dunkel, weil dicke, schieferfarbene Wolken den Himmel bedeckten. Heftige Sturmböen peitschten den Regen gegen die Autoscheiben und verschlechterten die Sicht von Augenblick zu Augenblick. Der Wetterbericht im Autoradio kündigte Wind in Orkanstärke und sturzbachartige Regenfälle an.
»Verdammter Mist!«, fluchte Lisa, als sie sich am Sternwolkensee vorüber kämpfte. Wasser und Himmel schienen zu einer einzigen, wild bewegten Fläche zu verschwimmen. Wild bogen sich Bäume und Sträucher unter der Gewalt des Windes, und abgerissene Äste trieben über die Straße. »Das ist ja kaum zu schaffen! Ich glaube, ich kehre lieber wieder um, ehe das Wetter noch schlimmer wird.« Mühsam wendete sie den Wagen und fuhr langsam in den Ort zurück. Sie stellte das Auto in der sicheren Garage ab und lief so schnell sie konnte ins Haus, dennoch wurde sie durch und durch nass. Heute war wirklich kein Wetter, um sich draußen aufzuhalten!
Nach einer warmen Dusche zog Lisa bequeme Kuschelsachen an, kochte sich Tee mit reichlich Zucker und einem guten Schuss Rum und machte es sich auf dem Sofa gemütlich. Warum die anstrengende und sogar gefährliche Fahrt zum Ebereschenhof auf sich nehmen, es gab ja schließlich auch das Telefon!
Marie meldete sich, noch ehe der erste Klingelton verklungen war. »Ben? Ben, bist du das?«, fragte sie atemlos.
»Nein, hier ist nicht Ben. Ich bin’s, Lisa«, antwortete die junge Frau.
»Ach, Lisa, du bist es. Hallo!« Maries Stimme klang eindeutig enttäuscht und ängstlich.
»Marie? Ist etwas passiert? Du klingst so komisch«, meinte Lisa.
»Entschuldige!«, kam es prompt zurück. »Ich wollte nicht unhöflich sein, ich mache mir nur solche Sorgen um Ben!«
»Was ist denn mit ihm?«, fragte Lisa irritiert.
»Na, er ist doch jetzt auf dem Heimweg, und das Wetter wird immer schlimmer! Im Radio warnen sie vor umstürzenden Bäumen; wenn ihm nur nichts passiert!«, sagte Marie mit zitternder Stimme.
»Das wird schon gut gehen«, erwiderte Lisa so tröstlich, wie es ihr möglich war. »Er ist doch ein erfahrener und umsichtiger Autofahrer.«
»Und was nützt ihm das, wenn ein Baum auf seinen Wagen kracht?«, klagte Marie.
»Jetzt mach dir doch nicht solche unnötigen Sorgen, es wird ihm schon nichts passieren! Und falls das Wetter zu schlimm wird, ist er doch vernünftig genug, sich unterwegs ein Zimmer zu nehmen, wirst schon sehen!
Komm, lass uns mal von etwas anderem reden. Du, stell dir vor, ich hatte heute einen ganz irren Katalog in der Post! Der muss von einem Versandhaus für sexy Wäsche und Spielzeug für Erwachsene kommen – du verstehst schon«, improvisierte Lisa drauflos. »Keine Ahnung, wie die an meine Adresse gekommen sind! Hast du vielleicht zufällig auch etwas von denen in der Post gehabt?«
»Wie bitte? Nein«, antwortete Marie zerstreut. »Nur unsere Wochenzeitschrift und ein paar Briefe.«
»Was denn für Briefe? Vielleicht sieht deine Post von denen ja anders aus als meine, guck doch mal nach!«, drängte Lisa. »Wir könnten die Sachen vergleichen, und dann haben wir was zu lachen. Lachen tut dir gut, Sorgen machen nicht!«
»Wenn du meinst.« Marie klang nicht gerade begeistert, aber offensichtlich griff sie nach den Briefen, denn Lisa hörte ein leises Rascheln. Wie spannend!
»Also, da ist nichts«, erklang wieder die Stimme der jungen Frau. »Nur zwei geschäftliche Sachen, wahrscheinlich Rechnungen, eine Werbung für Holzschutzmittel und ein kleiner, roter Brief, aber der sieht privat aus.«
»Das ist ja interessant!«, flötete Lisa. »Wie genau sieht er denn aus und an wen ist er adressiert?«
»Klein, rot, und er ist an Ben gerichtet. Ohne Absender«, informierte Marie sie.
»Spannend!« Lisa lachte. »Mach ihn doch auf.«
»Wieso? Er ist an Ben adressiert«, wiegelte Marie ab.
»Och, ihr seid verheiratet, da hat man doch keine Geheimnisse voreinander!«, tat Lisa ganz unbedarft.
»Nein, Geheimnisse nicht, aber eine gewisse Privatsphäre schon!«, erwiderte Marie bestimmt. »Ich öffne seine Briefe nicht unaufgefordert! Und bitte sei mir nicht böse, aber ich möchte jetzt auflegen. Vielleicht ruft Ben an und sagt, wo er gerade ist. Tschüss, Lisa, und danke für deinen Anruf.«
»Tschau, tschau«, konnte sie gerade noch flöten, dann war die Verbindung unterbrochen.
»So eine dreimal verfluchte Sch…!«, wütete Lisa. »Jetzt sitzt das blöde Schaf direkt vor dem Brief und will ihn nicht öffnen! Wie bescheuert ist das denn! Natürlich öffnet man die Briefe vom Ehemann, dafür braucht man doch keine Extra-Einladung! Das tut doch jede! Jede außer der ehrpusseligen Marie!«
Lisa schimpfte noch eine ganze Weile vor sich hin, ehe sie sich beim Pizzabringdienst eine große Pizza mit Salami, doppelt Käse und extra scharfer Peperoni bestellte. Sollte der Bote doch zusehen, wie er mit diesem Wetter klarkam, wieso machte er auch einen so bescheuerten Job!
*
In der Zwischenzeit befand sich Ben auf seiner stundenlangen Heimfahrt. Er hatte die Wettervorhersage gehört und sich gegen die Stimme der Vernunft entschieden, unterwegs zu übernachten. Zu groß war sein Wunsch, nach Hause zu seiner Frau zu kommen. Allerdings machte ihm nicht nur das Unwetter ein Strich durch die Rechnung, sondern auch sein alter Lieferwagen. Er gab unangenehm klopfende Geräusche von sich, die Ben zum Anhalten und Nachschauen gezwungen hatten. Obwohl der Mann auch etwas von Automechanik verstand, war er kein Fachmann, und konnte die Ursache für das beunruhigende Geräusch nicht ausmachen. Da ihn das Wetter ohnehin zum langsamen Fahren zwang, hoffte er, weder Motor noch Getriebe überzustrapazieren und zumindest noch Bergmoosbach zu erreichen.
Der Wind nahm weiter an Stärke zu und trieb die Wassermassen, die vom Himmel strömten, in wilden Wirbeln vor sich her. Beim Versuch, sich einen Überblick über den Schaden an seinem Wagen zu verschaffen, war Ben bis auf die Haut durchnässt worden, und nun saß er tropfend und frierend hinterm Steuer. Die Heizung lief immer schwächer und der erschöpfte Mann konnte sich ausrechnen, dass sie bald ausfallen würde.
Was sie dann auch am Ortseingang von Bergmoosbach tat! Und nicht nur die Heizung streikte, der Motor gab jetzt endgültig seinen Geist auf und tat keinen Mucks mehr. Ben konnte seinen Wagen gerade noch am Straßenrand ausrollen lassen, dann war er gestrandet. Mit einem müden Seufzer zog er sein Handy hervor, das zum Glück noch aufgeladen war und Empfang hatte! Er wählte Maries Nummer, und sofort war seine Frau am Handy.
»Ben? Ben, Liebling, ich bin so froh, dass du dich meldest! Wo bist du?«, schluchzte sie.
Alarmiert fuhr ihr Mann auf. »Marie? Was ist passiert? Geht es dir nicht gut, hast du frühzeitige Wehen?«, fragte er angstvoll.
»Aber nein, alles in Ordnung!«, beruhigte ihn seine Frau sofort. »Ich bin nur so froh, von dir zu hören, dass ich mal wieder weinen muss. Wo bist du? Wann kannst du hier sein?«
Ben seufzte. »Heute leider nicht, der Wagen ist hinüber. Im Augenblick geht nichts mehr! Ich stehe am nordöstlichen Ortsrand von Bergmoosbach und werde im Auto übernachten.« Er musste kräftig niesen. »Morgen früh rufe ich die Werkstatt an und lasse mich abschleppen. Bei diesem Wetter fährt jetzt niemand mehr raus.« Auch den nächsten Nieser konnte er nicht unterdrücken.
»Kommt ja überhaupt nicht infrage, dass du die ganze Nacht über im Auto bleibst!«, protestierte Marie. »Ich fahre gleich los und hole dich ab.«
»Nein, auf keinen Fall, das ist viel zu gefährlich!«, rief Ben sofort aus. »Du kannst keine zehn Meter weit gucken und es ist nicht sicher, ob Bäume umstürzen! Bleib, wo du bist, und kuschle dich in unser warmes Bett, morgen komme ich wieder nach Hause.«
Widerwillig fügte Marie sich seinen Argumenten wegen der Sicherheit, aber der Gedanke, den nassen, verfrorenen Ben die ganze Nacht im kalten Auto zu wissen, gefiel der jungen Frau gar nicht! Und dann hatte sie eine Idee.
»Ich rufe Lisa an und frage, ob du auf ihrem Sofa übernachten kannst. Sie wohnt doch nicht weit vom Ortsrand entfernt«, schlug Marie vor. »Bleib im Wagen, ich rufe gleich zurück!«
»Nein, warte! Ich …«, rief Ben, aber da hatte seine Frau das Gespräch schon beendet. Ihn beschlich ein leichtes Unbehagen bei dem Gedanken, ausgerechnet bei Lisa zu übernachten, so vertraut war er nicht mit der Freundin seiner Frau. Sie war ihm eher fremd, und ihren peinlichen Auftritt bei der Hochzeit hatte er auch noch nicht ganz vergessen.
Andererseits war sie in der letzten Zeit freundlich und zurückhaltend gewesen und hatte sich um Marie gekümmert. Vielleicht war sie doch ganz in Ordnung, und die Vorstellung, die ganze Nacht hier im eiskalten Wagen zu hocken, in den nassen Klamotten und mit einer beginnenden Erkältung in den Knochen, war nicht sehr schön. Wieder musste Ben niesen und schauderte in seinen nassen Sachen. Als Marie wenige Minuten später zurückrief und sagte, Lisa erwarte ihn, er solle sofort losrennen, da war er insgeheim erleichtert.
»Gute Nacht, mein Herz, schlaf schön! Ich ruf dich gleich morgen früh an und sage Bescheid, wann und wie ich nach Hause komme. Ich liebe dich!«, verabschiedete er sich von seiner Frau.
»Ich liebe dich auch!«, antwortete Marie zärtlich. »Gute Nacht, mein Liebster.«
Ben gab sich einen Ruck, verstaute sein Handy so gut es ging in seiner feuchten Jackentasche und rannte, so schnell die peitschenden Regenschauer es erlaubten, in den Ort und hinüber zu Lisas Haus.
Die junge Frau stand im hell erleuchteten Hausflur und hatte die Eingangstür weit geöffnet, damit der Lichtschein Ben den Weg wies. Triefend vor Nässe und durchgefroren bis auf die Knochen stolperte der Mann aus der Kälte und der Gewalt des Sturmes hinein in den schützenden Flur und schlug die Tür hinter sich ins Schloss. Plötzlich war es sehr still; das Heulen des Windes und das Rauschen des Regens klangen gedämpft durch die dicken Mauern des alten Hauses. Ben wischte sich das Wasser aus dem Gesicht und schaute die Frau an, die abwartend vor ihm stand.
»Guten Abend, Lisa«, sagte er mit einer Stimme, die heiser klang vor Erschöpfung.
»Guten Abend, Ben!«, antwortete sie freundlich. Sie hielt ein großes Handtuch in den Händen, das sie fürsorglich um seine Schultern legt und dann trat sie einen Schritt zurück . »Du brauchst Wärme und trockene Sachen zum Anziehen. Komm, wir gehen nach oben zu mir.«
»Danke!«, murmelte Ben und wickelte sich in das warme Tuch. »Es ist sehr nett von dir, dass du mich mitten in einer solchen Nacht bei dir aufnimmst.«
Lisa antwortete nicht, sondern lächelte hintergründig. Dann drehte sie sich um und ging voraus in ihre Wohnung.
*
Der Sturm peitschte den Regen gegen die Fenster des Doktorhauses. In der großen, gemütlichen Wohnstube mit der dunklen Balkendecke prasselte das Feuer im alten Kachelofen und verbreitete behagliche Wärme. Benedikt Seefeld und Traudel saßen in ihren Lieblingssesseln neben den hellen Leselampen und waren in ihre Lektüre vertieft. Auf dem Beistelltischchen neben ihnen dampfte aromatischer Tee.
Sebastian Seefeld stand an einem der Fenster und starrte in die feindliche Dunkelheit hinaus. Seine starre Körperhaltung und die angespannte Linie der Schulterpartie verrieten seine Gedanken.
In einer Sturmnacht wie dieser war seine Frau ums Leben gekommen.
Traudel schaute von ihrem Buch auf, griff nach ihrem Teebecher und meinte beiläufig: »Ich habe eben noch kurz bei Emilia vorbei geschaut, um nach den Fenstern zu sehen, das Madel mag ja nur schlafen, wenn’s Fenster offen steht. Die Sturmhaken sind eingeklinkt, und durch den tiefen Dachvorstand kann kein Regen ins Zimmer dringen. Es wirkte so gemütlich, von draußen Sturm und Regen zu hören und drinnen das friedlich schlafende Mädchen zu sehen. Übrigens mit Nolan am Fußende ihres Bettes, so viel zum Thema Hundeerziehung!« Sie schmunzelte. »Es ist ein schönes Gefühl, die beiden dort sicher und geborgen schlafen zu sehen und zu wissen, es kann ihnen nichts passieren.«
»Bis morgen früh hat sich das Unwetter sicher ausgetobt, und wenn nicht, dann fahre ich Emmchen mit dem Wagen zur Schule«, sagte Benedikt. Er beobachtete seinen Sohn und bemerkte, dass sich die Spannung in seinen Schultern zu lösen begann. Der alte Doktor legte sein Buch zur Seite und ging hinüber zu dem kleinen Tisch mit den beiden Stühlen, der vom hellen Schein einer Lampe beleuchtet war. Er schaute auf das Spielbrett, das dort aufgebaut war, und fragte mit einem warmherzigen Lächeln in der Stimme: »Lust auf eine Partie Schach, mein Sohn?«
Sebastian starrte noch einen Augenblick in die Abgründe der Nacht hinaus, dann schloss er die Vorhänge und wandte sich seiner Familie zu. »Danke, Vater, sehr gern!«, antwortete er. Die Gespenster der Vergangenheit, die ihm seine Liebe genommen hatte, waren ausgesperrt, nun blieben Wärme und Geborgenheit seines Zuhauses, in dem sein Kind schlief, und seine Nächsten bei ihm waren.
*
Wenige Straßen weiter verbreitete Lisa in ihrer Wohnung ebenfalls den Anschein von Gemütlichkeit. Gegen das Toben der Elemente hatte die junge Frau die Vorhänge fest geschlossen. Das Licht der Lampen war gedämpft, und auf dem niedrigen Tisch beim Sofa flackerte eine dicke Kerze in einem gläsernen Windlicht.
Die junge Frau musterte Benjamin, der sich mit dem Handtuch energisch Gesicht und Haare abrubbelte und wiederholt kräftig nieste. Lisa schüttelte den Kopf. »So wird das nichts!«, erklärte sie energisch. »Du bist nass und durchgekühlt bis auf die Knochen, und offensichtlich ist schon eine Erkältung im Anzug. Ich mache dir einen Vorschlag: Während ich auf dem Sofa dein Bett baue und für etwas Heißes zu trinken sorge, nimmst du eine lange, heiße Dusche. Du gibst mit deine nassen Klamotten und ich stecke sie in den Trockner, dann hast du morgen etwas Vernünftiges zum Anziehen und wirst nicht krank.«
Ben zögerte nur kurz. Die Vorstellung, jetzt heiß duschen zu können und morgen etwas Trocknes zum Anziehen zu haben, war sehr verlockend. »Wenn dir das nicht zu viel Mühe macht, nehme ich dein Angebot gerne an. Danke Lisa, das ist echt nett von dir!«
»Mühe? Schmarrn!«, lachte Lisa und schüttelte ihre blonde Haarmähne über die Schultern zurück. »Das tue ich doch gern!«
Und wie gern sie es tat!
Als Maries Anruf sie erreichte, hatte die junge Frau ihr Glück kaum fassen können: Ben, hier bei ihr, womöglich in ihrem eigenen Bett? Welche ungeahnten Möglichkeiten taten sich auf! Und ausgerechnet die eigenen Ehefrau, dieses naive, nichts ahnende Schäfchen, öffnete dafür Tür und Tor! Das nannte man wohl Ironie des Schicksals!
»So, hier ist das Bad, und hier sind genügend Handtücher«, sagte sie zu Ben und lächelte entschuldigend. »Ich habe leider nichts Passendes für dich zum Anziehen, selbst mein Bademantel wird zu klein sein. Du musst leider mit einem Duschhandtuch als Pyjamaersatz Vorlieb nehmen.«
»Macht nichts, Lisa, das ist heute Nacht mein geringstes Problem!«, antwortete Ben.
Du hast ja so recht!, dachte Lisa triumphierend. Laut sagte sie: »Leg deine nassen Klamotten einfach vor die Tür. Ich bringe sie dann gleich runter in den Trockner und stelle deine Schuhe auf die Heizung. Willst du vielleicht einen heißen Tee mit einem Schuss Rum haben? Das wärmt von innen.«
»Perfekt!«, antwortete Ben und verschwand im Bad.
Lisa setzte Teewasser auf, breitete Laken und Wolldecken auf ihrem Sofa aus und stopfte Bens tropfnasse Kleidung in den Trockner. Als der junge Mann aus dem Badezimmer kam, fand er sein Bett gemacht, und auf dem Tisch wartete ein Becher mit dampfenden Tee. Dankbar nahm er den ersten Schluck und lachte überrascht. »Meine Güte, das ist ja eher heißer Rum mit Tee als Tee mit einem Schuss Rum!«
»Gut gegen Erkältung«, erklärte Lisa. »Ich habe auch ordentlich Zucker mit hineingetan, damit er nicht so scharf schmeckt.«
»Das haut mich um!«, antwortete Ben. »Ich hab seit Stunden nichts mehr gegessen, und jetzt noch die Entspannung durch die heiße Dusche – ich werde schlafen wie ein Stein.«
»Dann will ich dich nicht weiter stören. Gute Nacht, Ben, und schlaf gut.« Lisa lächelte und verließ das Wohnzimmer.
Benjamin trank den letzten Schluck des stark alkoholisierten Tees und sank auf das Sofa zurück. Völlig erledigt und nur noch dankbar für die Wärme, die ihn umgab, wickelte er sich in die Decke, und innerhalb von Sekunden war er eingeschlafen.
Zwei Stunden später wurde die Tür geräuschlos geöffnet, und Lisa schlüpfte ins Zimmer. Auf Zehenspitzen und mit angehaltenem Atem schlich sie zum Sofa und musterte den ahnungslosen, abgrundtief schlafenden Mann.
Benjamin lag auf dem Rücken, einen Arm hatte er über seinen Kopf gelegt, der andere hing entspannt von der Couch herab. Er wirkte völlig gelöst und tiefenentspannt. Handtuch und Decke waren im Schlaf zur Seite geglitten, und der ahnungslose Ben lag nackt vor Lisas gierigen Blicken.
Wie verdammt gut er aussah! Und die ganze männliche Schönheit verschwendet an Marie, das Hausmütterchen! Lisa war kurz davor, sich zu dem Mann zu legen und ihn zu verführen, ihre Lust mit ihm zu genießen. Keinen Augenblick zweifelte sie daran, dass Ben, geschlagen mit einer schwangeren Ehefrau, den körperlichen Reizen einer anderen erliegen würde.
Aber wie konnte sie Marie am meisten quälen? Wie einen angeblichen Betrug glaubhaft darstellen? Nur Worte waren ihr nicht genug. Lisa hob das mitgebrachte Handy und begann, Fotos von Ben zu machen. Fotos von seinem friedlich schlafenden Gesicht, seinem entspannten Körper, von intimen Details, die sonst die Kleidung verdeckte.
Mit einem bösen Lächeln schoss sie das letzte Foto und verschwand ebenso geräuschlos, wie sie gekommen war, aus dem Zimmer.
*
Am nächsten Morgen hatten die wilden Sturmböen sich zu erträglichem Wind gemäßigt, und die Regengüsse verwandelten sich in sanften, stetigen Niederschlag. Während Ben mit der Werkstatt das Abschleppen und die Wagenreparatur besprach, kam Marie, um ihn abzuholen. Sie hatte Zutaten für ein leckeres Frühstück dabei, und die drei jungen Leute ließen sich Brötchen, hausgemachte Marmeladen und Wurstspezialitäten schmecken.
»Nochmals danke, Lisa, dass du mich aufgenommen und mit Dusche und Nachtlager verwöhnt hast!«, sagte Ben herzlich beim Abschied.
»Immer wieder gerne!«, flötete Lisa und verteilte ihre Luftküsschen an das Ehepaar. »Wir sind doch Freunde.«
Anschließend ging sie in ihren Salon hinunter, ein wenig stiller als sonst und sehr mit eigenen Gedanken beschäftigt. Lisa malte sich aus, wie sie die Fotos von Ben am besten einsetzen konnte, um den größten Schmerz zu verursachen…
*
Ben und Marie hatten kaum den Ebereschenhof erreicht, als der junge Mann den nächsten roten Brief entdeckte. Es war der bösartigste von allen.
Nach der ausführlichen Schilderung ausschweifender Sexszenen, die sich angeblich zwischen dem Mann und der Schreiberin abgespielt haben sollten, beschrieb die Frau Zukunftspläne für sich und Ben. Dabei verhöhnte und verspottete sie die ahnungslose Marie aufs Übelste.
Benjamin knirschte mit den Zähnen. Es zerriss ihm das Herz, seiner Frau diese Gemeinheiten zu lesen zu geben, aber ihm blieb keine andere Wahl. Er nahm allen Mut zusammen, ging zu Marie, die gerade dabei war, Gardinen für das Kinderzimmer mit weißer Baumwollspitze zu verzieren, und sagte mit zitternder Stimme: »Marie? Wir müssen miteinander reden.«
Beunruhigt von seinem Tonfall und seinem gequälten Gesichtsausdruck schaute Marie ihn an. »Ben, was ist denn passiert?«
»Ich …, es … sind Briefe gekommen«, antwortete er stockend. »Briefe mit so vielen Gemeinheiten und so viel Dreck. Ich wollte nicht, dass du sie liest, aber … so geht es nicht weiter. Niklas meinte auch, dass du Bescheid wissen musst. Es …, es tut mir leid, es tut mir so leid, mein Herz!«
Marie nahm die Briefe und begann zu lesen. Alles Blut wich aus ihrem Gesicht, und sie wurde kreidebleich. »Das ist unmöglich!«, stammelte sie. »Das …, wer …, aber warum?« Ihre Augen waren große, dunkle Löcher der Qual in ihrem weißen Gesicht.
»Ich weiß es nicht! Marie, ich schwöre, ich weiß nicht, wer diese Briefe schreibt!« Ben war vor seiner Frau auf die Knie gesunken und umfasste ihre eiskalten Hände. »Und ich habe auch keine Ahnung, warum diese Unbekannte es tut!«
»Sie sagt, du wirst mich verlassen«, flüsterte Marie beinahe tonlos.
»Keine Ahnung, wie irgendjemand auf diese Idee kommen kann!«, rief Ben verzweifelt. »Ich wollte dich vor diesem widerlichen Dreck bewahren, aber ich glaube, es ist besser, wenn du darüber informiert bist. Marie, Marie! Schau mich an! Bei allem, was mir heilig ist, schwöre ich, dass ich nichts von dem, was hier steht, getan habe oder zu tun beabsichtige!«
»Das weiß ich doch!« Trotz ihrer Tränen und ihres Schocks gelang Marie ein kleines Lächeln. »Das weiß ich! Es ist nur so furchtbar, es geschrieben zu sehen, das macht es so … wichtig.«
»Wichtig ist nur, dass du und ich zusammenstehen, und uns dieser Schund nichts antun kann!«, rief Ben leidenschaftlich aus. »Wir müssen entscheiden, was wir mit den Briefen tun. Sollen wir damit zur Polizei gehen und Anzeige erstatten?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Marie benommen. Ihr war übel, und ihr Herz raste. Es hatte so unfassbar wehgetan, das zu lesen, was ihre größte Angst in Worte fasste: Benjamin zu verlieren! Sie war schon einmal so betrogen worden, und das ein zweites Mal zu erleben, würde über ihre Kräfte gehen.
Die Kinder! Der Gedanke an die Zwillinge und daran, wie herzlos und grausam die Unbekannte über die Schwangerschaft geschrieben hatte, entfachte eine lodernde Wut in Marie. Wie konnte es jemand wagen, sich so in ihre Familie zu drängen!
»Wir gehen nicht zur Polizei!«, sagte sie entschieden. »Was kann sie denn bei Anzeige gegen Unbekannt schon tun? Dann beginnen hier Ermittlungen, und sofort weiß das ganze Dorf Bescheid. Die Leute haben ein langes Gedächtnis. Stell dir mal vor, später erzählt jemand den Kindern davon!
Nein, keine Polizei, hier geht es nicht um Erpressung. Hier will uns jemand beunruhigen und zutiefst verletzen. Und diese Genugtuung werden wir der Person nicht bieten!
Weißt du, was wir tun? Wir werden jeden neuen Brief, der kommen sollte, nicht beachten und ungelesen vernichten! Und diese hier werden wir jetzt gemeinsam im Ofen verbrennen! Irgendwann wird der Unbekannten ihr gemeines Spiel zu langweilig werden, wenn sie merkt, dass von uns gar keine Reaktion kommt!«
Hingerissen schaute Ben seine Frau an. Marie hatte sich erhoben und stand wie ein dunkler Racheengel in der Stube, mit flammenden Augen und buchstäblich gesträubten Haaren. So böse hatte er sie noch nie erlebt!
»Mach die Ofenklappe auf!«, befahl sie.
Ben öffnete die Tür des alten Kachelofens, in dem die Glut nur noch schwach glomm. Mit knappen, energischen Bewegungen schürte Marie das Feuer und wartete ungeduldig, bis es hell aufloderte. Dann warf sie die Briefe mitten hinein, nahm den Schürhaken und drückte das Papier tief in die Flammen. Mit grimmiger Befriedigung schaute das Paar zu, wie die Briefe Feuer fingen, sich krümmten, schwarz verfärbten und zu heißer Asche zerfielen.
Maries Wangen waren von der Hitze gerötet, und ihre Augen funkelten. Prüfend schaute sie ihren Mann an. »Waren das alle?«, fragte sie schneidend. »Oder gibt es noch etwas, das ich wissen sollte?«
»Himmel, nein!«, rief Ben erschrocken aus. »Es gibt keine anderen Briefe! Das heißt, es gab noch einen, den ersten. Aber den habe ich gleich vernichtet, weil ich an einen geschmacklosen Scherz glaubte. Ich dachte nicht, dass noch weitere kommen würden.«
»So, den ersten also …«, sagte Marie gedehnt. Ihre Augen waren immer noch viel zu dunkel. »Und wann wolltest du mir von dem erzählen?«
»Am liebsten gar nicht«, antwortete Ben unglücklich. »Du bist schwanger und hast selbst gesagt, wie verletzlich du dich fühlst. Ich wollte dich mit diesem Blödsinn nicht belästigen.«
»Genau! Und deshalb hast du wochenlang nichts zu mir gesagt!«, warf Marie ihm voller Bitterkeit vor. »Wo bleibt denn da das Vertrauen?«
»Das hatte nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun, das war Rücksichtnahme!«, verteidigte sich Ben.
»Rücksichtnahme oder … Feigheit?«, sagte Marie spitz.
Dieser Vorwurf machte Benjamin sprachlos.
Seine Frau bemerkte seine Reaktion und zuckte mit den Schultern. »Mit mir konntest du darüber nicht reden, aber mit Niklas schon. Der Freund erfährt vor der eigenen Frau von dieser Geschichte! Was meinst du, wie ich mich dabei fühle?«
»Marie!« Schockiert starrte Benjamin seine wütende Frau an. Dann atmete er ein paar Mal tief durch und zwang sich zur Ruhe. »Das kann doch wohl nicht wahr sein!«, sagte er. »Die Gemeinheit in den Briefen konnte uns nichts anhaben, aber jetzt streiten wir uns darüber, dass ich dir erst so spät davon erzählt habe?«
Marie begegnete seinem traurigen Blick, und ihre Wut löste sich langsam in Luft auf. Sie ließ sich in seine weit geöffneten Arme sinken und barg ihren Kopf an seiner Brust. »Wie recht du hast!«, murmelte sie irgendwo zwischen Lachen und Weinen. »Das ist ganz und gar unmöglich! Wie kommen wir nur darauf?«
Ben wiegte sie sacht in seinen Armen. »Unsere Nerven liegen blank, da ist es kein Wunder, dass wir zu streiten beginnen, obwohl es dafür keinen Grund gibt.«
Marie schauderte in seinen Armen. »Es ist ein bisschen so, als ob die Briefschreiberin doch Erfolg damit hatte, Zwietracht zwischen uns zu säen«, sagte sie leise.
»Nein, mein Herz, das ist ihr überhaupt nicht gelungen!«, widersprach Benjamin bestimmt. »Die Briefe und die ganze Gemeinheit sind zu Asche verbrannt, und unser Streit eben war ein ganz normales Geplänkel unter Eheleuten! Du weißt schon: Ich habe gesagt und dann hast du gesagt und so weiter und so fort.
Alles ist gut!
Und weil das Feuer im Kachelofen jetzt so schön brennt, mache ich uns Bratäpfel in der Ofenröhre. Dazu gibt es Vanillesauce, und du setzt dich jetzt gemütlich in den Sessel, legst die Beine hoch und erzählst den Kindern vom Rezept deiner Mama, damit sie sich später daran erinnern können und wissen, wie man richtig altmodische Bratäpfel macht.« Verschmitzt blinzelte er seiner Frau zu, platzierte einen Kuss auf ihrer Nasenspitze und verschwand nach nebenan in die Küche.
Marie lachte und kuschelte sich in ihren Lieblingssessel. Durch die geöffnete Tür sah sie Ben hin und her gehen, hörte laufendes Wasser und roch den Duft frischer Äpfel und den von Vanille und Zimt.
Wenn sie den Verlauf der letzten vierundzwanzig Stunden bedachte, konnte sie doch nur froh und dankbar sein. Ihr Mann hatte die gefährliche Fahrt bei dem Unwetter unbeschadet überstanden und bei einer guten Freundin Schutz für die Nacht gefunden. Die anonymen Briefe hatten ihren Schrecken verloren und sich in Rauch und Asche aufgelöst. Sie selbst war behütet und geborgen zu Hause und wurde von ihrem Mann mit ihrem Lieblingsessen verwöhnt. Es gab keine andere Frau, keinen Betrug, und Ben würde sie niemals verlassen.
Woher kam dann dieser flüchtige Schatten, der wie unsichtbarer Rauch von den verbrannten Briefen aufzusteigen schien und eine hauchfeine Trübung auf dem Glanz ihres Glücksgefühls hinterließ?
Woher kam die schwebende Ahnung, dass noch längst nicht alles gut war?
*
Von Niklas, der zur Zeit in Skandinavien lebte und arbeitete, war vor Wochen ein verlockendes Angebot an Ben gekommen. Weit oben im Norden Norwegens wurde ein Dorf mit historischen Bauten errichtet. Benjamin, der sich nicht nur als Bau- sondern auch als Möbeltischler einen Namen gemacht hatte, sollte bei dem Projekt hinzugezogen werden.
Als die Anfrage gekommen war, hatte er sofort abgesagt. Seine Frau wäre zu dem Zeitpunkt bereits hochschwanger, und er wollte sie nicht allein lassen. Marie wusste, wie sehr ihr Mann sich über dieses besondere Angebot gefreut hatte, und war gerührt von Bens Verzicht. Er hatte nur mit den Achseln gezuckt. »Du bist schwanger und brauchst mich, da kommt etwas anderes überhaupt nicht infrage!«
»Schatz, es muss doch nichts passieren. Zwillingsgeburten liegen bei uns in der Familie. Seit Ewigkeiten bekommen Frauen Kinder, und früher war die Arbeit körperlich viel härte als heute«, entgegnete Marie.
»Ja, und wie viele Frauen und Kinder sind deswegen gestorben?«, wandte Benjamin ein. »Du bist dann alleine hier auf dem Hof, und wir haben keine direkten Nachbarn. Was ist, wenn dir etwas passiert? Wenn es zu früh losgeht und du ganz allein bist? Du weißt, dass die Geburt in der Uniklinik stattfinden soll.«
Marie stimmte ihrem Mann zu, natürlich wollte sie nicht gerne alleine sein. Andererseits fühlte sie sich durch Doktor Seefeld und Anna sehr gut überwacht und von ihren Freunden liebevoll unterstützt. Sie hätte Ben diese besondere Arbeit von Herzen gegönnt, außerdem wurde sie ungewöhnlich gut bezahlt. Die junge Familie konnte, besonders nach dem Desaster mit dem verfaulten Gebälk, lohnende Aufträge für Ben dringend gebrauchen.
Deshalb hatte Marie nach ausführlichen Gesprächen mit ihren Ärzten und der Hebamme und mit der freundlichen Unterstützung ihrer Freunde im Rücken noch einmal vorgeschlagen, dass Ben doch nach Norwegen reisen solle. »Es sind doch nur vier Wochen, Liebling! Und ich lebe nicht auf einem angelegenen Einödhof, sondern in Sichtweite Bergmoosbachs. Wenn ich Hilfe brauche, genügt ein Anruf, und ich werde versorgt. Ich schaffe das!«, versuchte Marie, ihren Mann zu überzeugen.
Ben zögerte lange. Ihm gefiel der Gedanke, seine schwangere Frau sich selbst zu überlassen, überhaupt nicht. Vor allem nicht in der noch immer ungeklärten Situation mit den anonymen Briefen! Wer wusste denn, was vielleicht noch kommen würde? Aber schließlich überstimmten die Gespräche mit ihr und den Ärzten seine Bedenken. Es ging Marie sehr gut, und man rechnete nicht mit einem frühzeitigen Einsetzen der Wehen. Wenn sie sich schonte und in ständigem Kontakt mit der Hebamme und den Medizinern blieb, stand Bens Reise eigentlich nichts im Weg.
»Das Madl könnte doch auch bei uns im Gästezimmer wohnen, solange ihr Mann nicht da ist«, schlug Traudel im Namen der ganzen Familie Seefeld vor.
»Brauchst nur anzurufen und zu sagen, was du einkaufen willst. Ich stell dir den Korb zusammen und schicke ihn dir zum Ebereschenhof«, bot Fanny an, der das Lebensmittelgeschäft gehörte.
»Und wenn du was Neues zum Lesen brauchst, das bringe ich dir gerne!«, kam es von Kiosksbesitzerin Afra bereitwillig. Bei der Gelegenheit könnte man auf dem Hof gleich ein wenig hinter die Kulissen schauen!
»Haare, Maniküre, Pediküre – alles im Home Service! Für die Schönheit sorge ich«, prahlte Lisa, die falsche Schlange.
Durch soviel Unterstützung einigermaßen beruhigt, schob Benjamin schließlich seine Zweifel zur Seite und machte sich auf den Weg nach Norwegen. Es war ein langer, zärtlicher und wehmütiger Abschied der Liebenden. Nun, als es ernst wurde, sank Maries Mut, und insgeheim bereute sie ihren Vorschlag. Körperlich ging es ihr erstaunlich gut, und sie wusste, dass sie sich auf ihre Freunde verlassen konnte – aber sie vermisste Ben bereits, als er noch nicht einmal die Landstraße nach Bergmoosbach erreicht hatte.
Und in aller Liebe, in allem Vertrauen schwang der Hauch der Angst mit: Die Angst, Ben letztendlich doch zu verlieren. Wenn es Lisa auch noch nicht gelungen war, die Liebenden auseinander zu bringen, so hatte sie es doch geschafft, den Seelenfrieden des Paares zu erschüttern.
*
Die Reise schien unter keinem guten Stern zu stehen.
Der Zug, der Ben zum Flughafen nach München bringen sollte, hatte so große Verspätung, dass die Fahrt kaum rechtzeitig zu schaffen war. Als er den Flughafen erreichte, kam gerade die Nachricht, dass der gesamte Flugverkehr wegen gefährlicher Flugasche, verursacht durch einen Vulkanausbruch auf Island, lahmgelegt war!
Marie telefonierte mit Ben, und ihr ganzes Herz drängte zu ihm. »Ich setzte mich in den nächsten Zug und komme nach München! Dann haben wir noch etwas gemeinsame Zeit, bis du endgültig in den Flieger steigst«, schlug sie begeistert vor.
Ben zögerte. »Liebling, ich möchte nicht, dass du nur für einen Tag und eine Nacht die Fahrt auf dich nimmst, das ist zu anstrengend. Die Züge werden jetzt überfüllt sein, weil viele Reisende darauf ausweichen. Es ist mir lieber, dich sicher in Bergmoosbach zu wissen.«
Die junge Frau musste ihm zustimmen, denn seine Einwände waren nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem war sie enttäuscht, sie hatte sich das unverhoffte Treffen sehr schön und romantisch vorgestellt. Anstatt nach München zu reisen, fuhr sie nur bis Bergmoosbach und besuchte ihre Freunde im Doktorhaus. Es war ein schöner und vergnügter Nachmittag, der in eine gemütliche Runde am Abendbrottisch überging, aber das Alleinsein danach schmerzte dennoch. Das Zuhause, ihr gemeinsames Zimmer, das breite Bett – alles schien zu groß geworden zu sein ohne Bens freundliche, wärmende Gegenwart.
»Das wird schon! Du gewöhnst dich dran«, meinte Lisa unbekümmert, als sie wenige Tage später auf dem Ebereschenhof zu Besuch war. »Bald kommt er ja wieder zurück zu dir.«
Aber ich bezweifle, dass du ihn dann noch haben willst!, dachte sie boshaft.
»Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwer fallen wird«, seufzte Marie. »Wir telefonieren zwar übers Internet und dabei können wir uns auch sehen, aber es ist doch nicht dasselbe.«
»Ja, ja, die liebe Liebe hält uns alle ganz schön auf Trab!«, erwiderte Lisa. »Es wird Zeit, dass ich mal wieder mit einem richtigen Typen zusammen bin. Single war ich nun lange genug. das macht zwar auch Spaß, aber jetzt will ich mehr.«
»Gibt es denn jemanden, den du sozusagen im Auge hast?«, fragte die ahnungslose Marie.
»Sozusagen ja!«, antwortete Lisa mit einem geheimnisvollen Lächeln.
»Das ist ja interessant! Wie weit seid ihr denn auf dem Weg zueinander?«, erkundigte sich Marie voller Anteilnahme.
»Hmmm, darüber möchte ich noch nicht sprechen, es ist ein bissl früh. Wir sind offiziell kein Paar, das muss noch etwas warten«, sagte Lisa verträumt.
»Ich freu mich für dich!«, antwortete Marie herzlich. Sie hob ihr Glas mit dunkelroter, aromatischer Kirschschorle. »Komm, lass uns auf dein neues Glück anstoßen.«
»Auf mein neues Glück!«, entgegnete Lisa mit einem so strahlenden Aufschlag ihrer himmelblauen Augen, dass niemand auf den Gedanken gekommen wäre, dass sie etwas Böses plante. Sie heuchelte weiter Interesse an der Schwangerschaft, versorgte Marie mit harmlosen Klatsch aus dem Salon Glamour und kochte einen beruhigenden Kräutertee zum Einschlafen. »So, ich fahre jetzt, und du gehst ins Bett. Den Tee kannst du trinken, wenn du schon gemütlich eingekuschelt in den Federn liegst. Bleib du jetzt erst einmal ruhig sitzen! Ich gehe nur noch kurz ins Bad, und dann bin ich weg.«
Wenige Minuten später verabschiedete sich Marie von ihrer Freundin und winkte dem abfahrenden Auto freundlich hinterher, dann verriegelte sie die Haustür und ging hinauf in ihr gemütliches Zimmer. Es hatte zu regnen begonnen, und der Wind drückte gegen das ein wenig geöffnete Fenster des Zimmers. Die weißen Leinenvorhänge bauschten sich sacht, und Kälte und Duft des Herbstes fluteten den Raum. Es roch nach Wald, feuchtem Laub und dunkler Erde. Die junge Frau lag in ihrem Bett, neben sich den hellen Schein ihrer Leselampe, einen Stapel Bücher und den warmen Tee. Marie kuschelte sich in ihr und Bens Kissen, breitete die weiche Daunendecke über sich aus und begann zu lesen, bis sie in der Geborgenheit ihres Zuhauses in einen friedlichen Schlaf hinüberglitt.
Im Erdgeschoss des Hauses befand sich direkt neben dem Gäste-WC der Hauswirtschaftsraum mit der Waschmaschine und dem Korb mit getragener Wäsche. Nachdem Lisa gegangen war, wartete in der Hosentasche von Bens Jeans etwas Bitterböses, heimlich Platziertes in sündigem Rot darauf, entdeckt zu werden …
*
Die vergangene Nacht hatte den goldenen Herbst in nass-kaltes, trübes Grau verwandelt. Marie seufzte, als sie aus dem Fenster schaute. Heute hatte sie keine Lust auf einen der Spaziergänge, die sie sonst so gerne unternahm. Sie legte ihre Hände um den wärmenden Teebecher und überlegte, was heute noch zu erledigen war: Fanny einen Einkaufszettel durchgeben, die Kürbissuppe fürs Mittagessen aus dem Tiefkühler holen, Wäsche waschen und sich dann gemütlich in den Sessel setzen und an den Babydecken weiterstricken.
Langsam ging die junge Frau hinüber in den Hauswirtschaftsraum und begann, die Wäsche auszusortieren. Als erstes wollte sie Dunkles waschen, auch von Ben lagen noch Jeans und Sweatshirts im Korb. Routiniert drehte sie Pullover auf links und überprüfte, ob alle Taschen geleert waren. Ein einziges, vergessenes Papiertaschentuch kann sich in einer Ladung dunkler Wäsche auf bemerkenswerte Weise ausbreiten! In der Hosentasche von Bens Jeans spürte Marie ein Knäuel, das sie herauszog und in den Müll werfen wollte.
Ihre Hand erstarrte mitten in der Bewegung. Es war gar kein Papiertaschentuch. Es waren ein String, ein Nichts aus Spitzenbändern und Federn, und die leere Verpackung eines Kondoms, beides in einem bekannten Scharlachrot!
Wie betäubt starrte Marie auf ihren Fund. Das musste sie sich einbilden, es musste einfach eine Täuschung sein! Ein schlechter Traum, aus dem sie gleich erwachen würde! Die junge Frau kniff ganz fest die Augen zu, atmete tief durch und riskierte den nächsten Blick.
Nichts hatte sich verändert, sie hielt immer noch die Zeugen einer erotischen Begegnung in der Hand. Einer Begegnung, die ganz offensichtlich zwischen Benjamin und einer anderen Frau stattgefunden hatte.
Der Schmerz kam mit einer Wucht, der ihr Herz zu zerreißen drohte. »Ben!«, schluchzte sie auf, »Ben, was hast du getan!« Wie blind tastete sie sich hinüber in die Stube, wo sie auf dem Sofa zusammenbrach. Sie schlang die Arme um ihren Leib, in dem die beiden Ungeborenen unruhig auf die Verfassung ihrer Mutter reagierten. Schluchzend vergrub Marie den Kopf in den Kissen und ließ ihrem Kummer freien Lauf. Wie konnte Benjamin ihr das antun, wie konnte er nur! Galt sie denn in seinen Augen nicht mehr als Frau? War ihre Weiblichkeit als Schwangere so wenig anziehend, dass er sich einer anderen zugewandt hatte? Abgrundtiefe Verzweiflung hielt Marie gepackt und saugte jedes Fünkchen Lebenskraft aus ihr, bis nur noch eine erschöpfte Hülle übrig blieb.
Wie viele Stunden sie so auf dem Sofa gekauert hatte, wusste sie nicht, Marie hatte ihr Zeitgefühl verloren. Das hartnäckige Signal eines Weckers holte sie nach und nach aus ihrem qualvollen Dämmerzustand. Langsam kehrte die junge Frau in das Hier und Jetzt zurück. Sie erinnerte sich, dass sie den Wecker gestellt hatte, weil sie mit Ben zum Skypen, dem Telefonieren über das Internet, verabredet war.
Wie ein Automat klappte sie den Laptop auf und aktivierte das Programm, über das sie mit Ben in Verbindung treten konnte. Wie verabredet, war ihr Mann erreichbar und nahm sofort beim ersten Signal das Gespräch an. Sein Gesicht mit diesem schmerzlich vertrauten Lächeln, das allerdings sofort erlosch, erschien auf dem Bildschirm.
»Marie, Liebling! Du siehst ja furchtbar aus! Geht es dir nicht gut? Um Himmels willen, was ist passiert?«, rief er angstvoll.
Marie musste heftig schlucken, ehe sie antworten konnte. »Das ist passiert!«, antwortete sie tonlos und hielt ihren verräterischen Fund in die Kamera.
Im fernen Norwegen starrte Ben fassungslos und offensichtlich völlig verwirrt auf die beiden Teile in Maries Händen. »Was …, ich verstehe nicht, was … soll das? Wieso …, woher hast du das?«, stammelte er.
»Aus der Hosentasche deiner Jeans. Du hast vergessen, es herauszunehmen, ehe du sie in den Wäschekorb gelegt hast«, antwortete Marie dumpf.
»Ja, bist du denn verrückt geworden?«, schrie Ben. Er fuchtelte wie wild mit seinen Händen in der Luft herum, so als wollte am liebsten durch die Kamera greifen und diesem Spuk ein Ende bereiten. »Ich habe nichts vergessen! Und ich habe dieses verdammte Zeug nie zuvor gesehen! Ich weiß weder, wem es gehört, noch wie es in meine Hosentasche gelangt ist! Damit habe ich nichts zu tun!«
»Genauso wenig wie mit den anonymen Briefen«, sagte Marie mit brüchiger Stimme.
Trotz seines Entsetzens bemerkte Ben, dass seine Frau diesen letzten Satz nicht als Frage ausgesprochen hatte. »Marie? Marie, du …, du glaubst doch nicht etwa, dass ich damit etwas zu tun habe? Dass ich dich belüge und betrüge?«, stieß er atemlos hervor.
Marie hob ihren gesenkten Kopf und schaute ihm genau in die Augen. Der Mann schauderte unter der Dunkelheit und Leere dieses toten Blicks. »Ich weiß nicht mehr, was ich noch glaube!«, antwortete sie tonlos.
Bens Hände schossen nach vorn, auf die Kamera zu. Wie verzweifelt wünschte er sich, seine Frau in die Arme nehmen, sie halten und trösten zu können! »Liebling, bitte, hör mir zu! Ich habe damit nichts zu tun! Ich liebe nur dich und bin ganz und gar nur dein Mann! Niemals habe ich dich betrogen! Irgendjemand versucht, uns auseinander zu bringen, das darf nicht passieren! Ich liebe dich, und ich mache mir große Sorgen um dich! Du musst dich furchtbar aufgeregt und stundenlang geweint haben, das sehe ich dir an. Bitte, pass auf dich auf! Ich kann jetzt von hier aus so wenig tun, aber ich flehe dich an, geh gleich zum Arzt und lass dich untersuchen! Du darfst jetzt nicht allein sein. Rede mit Sebastian über die ganze Sache, erzähle ihm alles. Er versteht, welchen Stress das für dich und die Kinder bedeutet und wird dir helfen! Hörst du mich, Marie? Bitte geh sofort zu den Seefelds! Ich komme, so schnell ich kann, egal, was mein Vertrag hier sagt! Du darfst mit dieser Sache nicht allein sein! Ich …«,
»Leb wohl, Ben!«, unterbrach Marie sein leidenschaftliches Flehen und kappte die Verbindung. Das letzte, was sie von ihrem Mann sah und hörte, waren seine angstvoll geweiteten Augen und seine Stimme, die nach ihr rief.
»Marie! Ma …« Und dann war die Leitung tot.
Wie in Trance fuhr die junge Frau den Laptop ganz herunter, dann stellte sie das Telefon und auch ihr Handy aus. Sie musste für Benjamin unerreichbar bleiben, denn noch einmal seine geliebte Stimme zu hören, wäre über ihre Kräfte gegangen.
*
Während Benjamin im fernen Norwegen halb verrückt vor Angst wurde, weil er seine Frau nicht mehr erreichen konnte, verbrachte Marie die nächsten beiden Tage wie im Schockzustand. Sie igelte sich im Haus ein. Stundenlang lag sie im Bett und starrte blicklos ins Leere. Zum Essen musste sie sich zwingen, allein der Babys wegen, aber alles schmeckte nach Pappe. Marie hatte den Kontakt zur Welt verloren, und nur das Wissen, dass ihre Kinder von ihrem Verhalten abhängig waren, bewahrte sie davor, sich völlig aufzugeben.
Ben versuchte immer wieder, seine Frau telefonisch zu erreichen. – Vergeblich. Ihm ging es schon gar nicht mehr allein darum, das böse Missverständnis aufzuklären, inzwischen zitterte er um Maries Leben.
Was, wenn sie sich nicht nur ihm gegenüber so völlig zurückgezogen hatte, sondern auch von den Freunden? Von der Hebamme und den Ärzten? In seiner Panik malte sich der verängstigte Mann die schlimmsten Situationen aus. Es wurde unerträglich!
Zu allem entschlossen, stieg der junge Zimmermann vorzeitig aus dem Projekt aus. Es war ihm egal, welche finanziellen Schäden ihm dadurch entstanden, er musste nach Hause! Der norwegische Bauleiter war voller Verständnis und Mitgefühl und ließ Ben ohne weiteres ziehen. »Im Winter ruht die Arbeit hier sowieso«, sagte er freundlich. »Vielleicht magst du im Sommer wiederkommen, und deine Frau und die Kleinen kommen mit? Sie können Hüttenferien machen, während du hier am Dorf mitarbeitest.« Der Mann sah, wie groß Bens Ängste waren, und er klopfte ihm beruhigend auf die Schulter. »Schau dir unsere Wiese an, Ben aus dem Allgäu. Vielleicht versuchen deine Kinder hier ihre ersten Schritte, und du zeigst ihnen unsere Fjorde.«
Bei dieser Vorstellung schnürte sich Ben der Hals zu, und er konnte nichts mehr antworten. Wortlos drückte er seinem Kollegen die Hand und machte sich auf den langen, langen Weg nach Hause.
*
Ein Blick in den Kalender sagte Marie, dass sie heute das Haus verlassen musste, sie hatte einen Termin mit Hebamme Anna und Doktor Seefeld. Noch gestern hatte sie sich davor gefürchtet und gedacht, sie würde es nicht schaffen, ihre Zuflucht zu verlassen, aber heute war alles anders. Eine eigenartige Unruhe hatte die junge Frau ergriffen und trieb sie von einem Raum in den anderen, hinaus in Hof und Garten und wieder zurück. Obwohl ihr schwerer Körper ihre Beweglichkeit beeinträchtigte und ihre Fußknöchel angeschwollen waren, konnte sie einfach nicht still sitzen bleiben und sich ausruhen. Deshalb beschloss Marie, nach Bergmoosbach zu fahren, obwohl ihr Arzttermin noch längst nicht fällig war. Sie wollte vorher noch durch den Ort bummeln und ein wenig am Sternwolkensee spazieren gehen.
Aber als die junge Frau dann zu Fuß unterwegs war, merkte sie, wie anstrengend das Gehen wurde. Das Gewicht der Babys drückte aufs Becken, und trotz ihrer Rastlosigkeit fühlte Marie sich müde und erschöpft. Sie beschloss, sich in ein nahes Café zu setzen und so die Zeit bis zu ihrem Termin verstreichen zu lassen.
Als sie die gemütliche Konditorei Bernauer betrat, sah sie Emilia mit einigen Freunden dort sitzen. Die Jugendlichen tranken heiße Schokolade und waren in eine hitzige Debatte vertieft, bei der es um die Benotung des letzten Deutschaufsatzes ging. Offenbar gab es deswegen große Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen und ihrem Lehrer, dem anspruchsvollen Herrn Oberstudienrat Schmittle!
Marie nickte den jungen Leuten zu und setzte sich ein paar Tische entfernt in eine Nische ans Fenster. Auch sie bestellte eine heiße Schokolade, aber als der Becher mit dem verlockenden Sahnehäubchen kam, ließ sie ihn unberührt und starrte nur unbeweglich auf die Straße hinaus.
Aus den Augenwinkeln warf Emilia ihrer Freundin einen Blick zu. Sie konnte schon verstehen, dass Marie sich nicht zu ihnen an den Tisch mit laut schnatternden Jugendlichen gesetzt hatte, aber irgendetwas war komisch. Marie wirkte – anders. Emilia konnte nicht benennen, was es war. Ihre Aufmerksamkeit wurde schnell wieder auf die Diskussion um den unmöglichen Herrn Schmittle gelenkt, aber ein vages Gefühl der Beunruhigung blieb.
Auf der Straße stöckelte gerade Lisa vorbei, trotz des kalten Regenwetters in spitzen High Heels und ohne warme Jacke. Als sie Marie am Fenster erblickte, winkte sie, machte kehrt und betrat mit dem üblichen großen Hallo die Konditorei.
Mit einem dramatischen Schaudern zog sie ihr dünnes, figurbetontes Jäckchen aus und ließ sich auf den Stuhl gegenüber Marie fallen. »Du hast es ja gut, dass du hier im Warmen und Trocknen sitzen kannst, während andere draußen unterwegs sein müssen!«, sagte Lisa und schüttelte dekorativ ihre blonden Haarsträhnen über die Schulter zurück.
Marie starrte nach wie vor auf ihren unberührten Becher. »Ja, ich habe es gut«, antwortete sie dumpf.
»Und? Alles in Ordnung mit dir? Es ist bestimmt nicht leicht, so ganz ohne deinen geliebten Ben!«, trällerte Lisa und musterte ihr Gegenüber unter gesenkten Wimpern. Meine Güte, sah die Frau elend aus! Bestimmt hatte sie inzwischen den sexy String in Bens Hosentasche gefunden, und zwischen dem glücklichen Ehepaar herrschte Eiszeit! »Du siehst ein wenig … mitgenommen aus, wenn ich das als Freundin so sagen darf. Jetzt zum Ende hin wird die Schwangerschaft sicher sehr anstrengend, gell?«, heuchelte Lisa Mitgefühl.
»Ja«, flüsterte Marie. Sie spielte geistesabwesend mit ihrem Kaffeelöffel.
»Aber du hast doch Hilfe?«, bohrte Lisa weiter. »Du musst doch gar nicht alles allein machen!«
»Nein.« Wieder nur eine einsilbige Antwort.
Lisa konnte ihre Ungeduld kaum zügeln. Wann würde dieser zweibeinige Brutkasten endlich mit der skandalösen Geschichte herausrücken? Sie musste sie unbedingt aus der Reserve locken! »Ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Du bist so seltsam heute, ich mache mir allmählich Sorgen um dich, Marie!«
Endlich hob die junge Frau das Gesicht und schaute ihre Freundin an. Selbst die falsche Schlange Lisa zuckte zusammen, als sie bemerkte, wie verstört Marie aussah. »Äh, das …, du siehst ja furchtbar aus! Was ist denn passiert?«, fragte sie.
»Ben«, flüsterte die Schwangere, »Ben ist …, er … hat eine andere.«
»Nein!« Lisas spitzer und gellend lauter Aufschrei ließ die Köpfe aller Anwesenden zu ihrem Tisch herumfahren. »Das gibt’s doch nicht! Das ist ja der Wahnsinn!«
Marie hatte keine Kraft, sich gegen die Lautstärke ihrer Freundin zur Wehr zu setzen. Obwohl sie es hasste, derart im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, konnte sie es nicht verhindern.
»Was? Wieso? Woher willst du das denn wissen?«, trompete Lisa weiter.
»Es gab Briefe für Ben.« Maries Stimme zitterte und war so leise, dass Lisa sie kaum verstehen konnte. Die Blondine schoss einen wütenden Blick zu den Jugendlichen am Nachbartisch hinüber, wo man nach einer überraschten Pause das Gespräch wieder aufgenommen hatte. Konnten diese Gören sich nicht leiser unterhalten?
»Sie waren anonym. Ben hat …, Ben hat sie mir gezeigt.« Marie sprach in kurzen, abgehackten Sätzen, und jeden Augenblick drohte ihre Stimme zu brechen. »Sie waren so gemein. Die andere Frau hat …, Ben will … uns verlassen.«
»Das glaub ich doch im Leben nicht!«, tat Lisa empört. Sie wollte noch ein wenig mit der Hilflosen spielen, wie die Katze mit der Maus, und dann zum Todesstoß für diese lächerliche Liebe ausholen.
»Ich habe es auch nicht geglaubt«, fuhr Marie erschöpft fort. »Ben hat … geschworen, dass nichts dran ist an den heißen Liebesbriefen und allem anderen. Dass die unbekannte Frau lügt. Dass er mich niemals betrogen hat.«
»Dann ist doch alles gut!« Scheinbar mitfühlend legte Lisa ihre Hand auf die eiskalten Finger der anderen jungen Frau. »Oder … glaubst du ihm etwa nicht?«
»Doch, zuerst schon. Aber dann …«, Maries Finger zuckten unter Lisas Hand. »Dann habe ich beim Wäschewaschen in seiner Jeans einen roten String gefunden, der nicht mir gehört. Und eine leere Kondomverpackung.« Bleischwere Stille legte sich zwischen die beiden Frauen. Maries Gesicht war grau wie Asche. »Und nun sag mir: Egal, was Ben geschworen hat – sieht das nicht alles nach einer heimlichen Affäre aus?«
Ha! Ich hab sie! Das ist der richtige Moment!, triumphierte Lisa innerlich. Immer noch hatte sie ihre Hand auf der von Marie liegen. Jetzt drückte sie deren Finger; es hätte als liebevolle Trostgeste verstanden werden können.
»Ja, das sieht allerdings nach einer heimlichen Affäre aus!«, antwortete sie und nahm Marie mit dieser Bestätigung den widersinnigen, allerletzten Hoffnungsschimmer, es möge alles nur ein riesengroßes Missverständnis gewesen sein. »Und soll ich dir auch sagen, mit wem?«, fügte sie mit einem bösartigen Glitzern in den Augen hinzu.
In sprachlosem Staunen schaute Marie sie an.
Erst jetzt zog Lisa ihre Finger zurück und ließ Maries ausgestreckte Hand einsam auf dem Tisch liegen. »Mit mir!«, schleuderte sie der wehrlosen Frau ins Gesicht.
»Mit …« Das Wort blieb Marie im Hals stecken. Wie erstarrt saß sie auf ihrem Stuhl und war zu keiner Reaktion fähig. Zu gar keiner. Sie vergaß sogar das Atmen.
»Ja, da staunst du, gell?«, höhnte Lisa. Wie sehr sie die Situation genoss! Allem Neid und aller Bösartigkeit konnte sie jetzt ungebremst ihren Lauf lassen und Marie vernichten. »Sag, bist du so mit Brüten beschäftigt, dass du gar nicht gemerkt hast, wie sehr dein Mann sich im Bett mit dir gelangweilt hat? Sein biederes Frauchen! Ich möchte wetten, die Hälfte der Sachen, die Ben und ich getrieben haben, wären dir niemals in den Sinn gekommen. Und in deiner Wäscheschublade würde man vergeblich etwas suchen, was auch nur annähernd so heiß ist wie mein roter Spitzenstring mit den Federn, hab ich recht?«
Marie hob abwehrend die Hände, so als wolle sie Schläge von sich abwehren. »Ich …, ich glaube dir kein Wort!«, murmelte sie heiser.
Die andere Frau lachte und lehnte sich gemütlich in ihren Stuhl zurück. »Ach, nein?«, fragte sie gedehnt. Sie ließ Marie nicht aus den Augen. »Und woher kenne ich dann das Muttermal, das Ben ganz tief unten in der rechten Leistenbeuge hat? Es ist hellbraun und hat die Form eines Sterns.«
Marie zuckte zusammen, als hätt ihr jemand einen Dolch ins Herz gestoßen.
»Na, Mütterchen, dämmert dir jetzt die Wahrheit?«, trällerte Lisa. Sie holte ihr Handy aus der Tasche, suchte nach gewissen Fotos und zeigte sie der totenblassen Frau. »Was haben wir denn hier? Lass uns doch mal schauen. Ah, das hier ist doch besonders schön! Du hast, äh, du hattest wirklich einen aufregend attraktiven Mann«, sagte Lisa und zeigte Marie jene Fotos, die sie in der Unwetternacht von dem ahnungslos schlafenden Ben gemacht hatte.
Die Bilder verschwammen vor Maries Augen. Es war tatsächlich Ben, der nackt und völlig entspannt auf Lisas Sofa lag und schlief. Leintücher und Decken waren zur Seite gerutscht. Sein rechter Arm lag angewinkelt über seinem Kopf, das Gesicht hatte er leicht zur Seite geneigt. Der Anblick war seiner Frau so herzzerreißend vertraut, dass sie ein Schluchzen nicht unterdrücken konnte.
»Nein!«, wimmerte sie. »Nein!«
»Aber ja doch, Herzchen!«, verspottete die kaltherzherzige Blondine sie weiter. »Und du musst schon zugeben, dass ich mir wirklich Mühe gegeben habe! Das Rot vom Briefpapier ist dasselbe wie von meinem String; sexy, gell?«
»Nein, Ben hat nicht …«, keuchte Marie.
»Aber ja, er hat!« Lisas Augen glitzerten, und sie zog die Quittung über ein Hotelzimmer in München hervor. Zufällig war sie an demselben Wochenende, an dem Bens Flieger nicht starten konnte, auch dort gewesen. Sie hatte sich mit einem Bekannten getroffen, kräftig Party gemacht und sich mit ihm ein Doppelzimmer genommen. Diesen Beleg schwenkte sie jetzt vor Maries Augen hin und her. »Siehst du das hier? Warum wohl wollte Ben nicht, dass du nach München kommst? Weil ich zu ihm gefahren bin! Von wegen: Er hat am Flughafen geschlafen! Wir waren im Hotel, dein angebeteter Ehemann und ich!«
»Warum?«, stammelte Marie. »Warum … ausgerechnet Ben?«
»Na, warum wohl? Schau ihn dir doch an, deinen Prachtkerl! Hast du wirklich geglaubt, soviel männliche Schönheit gehört dir allein? Dir, dem kleinen Frauchen im Dirndl?«, fragte Lisa ätzend. »Du hast tatsächlich gar nichts aus deinem Leben gelernt! Aber eigentlich wundert mich das nicht, dich etwa? Wie solltest du Ben halten können, wenn es dir bei deinem ersten Mann auch nicht gelungen ist! Meine Güte, was hatten Fabian und ich damals für einen Spaß, hinter dem Rücken des ahnungslosen Mariechens in die Kiste zu steigen!«
Lisas Gemeinheiten vermischten sich zu einem Wortbrei, der irgendwie um die entsetze Marie herumwaberte. Sie konnte keine Einzelheiten mehr unterscheiden, nichts mehr klar erfassen. Ihr ganzes Denken und Fühlen war nur noch auf ein Ziel ausgerichtet: Diesem unerträglichen Schmerz, der in ihrer Brust wütete, zu entkommen. Für noch mehr Qual und Erniedrigung war kein Platz mehr in ihrem gepeinigten Herzen. Mit einem vollkommen leeren Blick stand sie vom Tisch auf und ging wie ein Automat zur Tür, die sie achtlos hinter sich geöffnet ließ. Ein eiskalter Windstoß fegte welkes Laub in das Café hinein.
»Hallo, Marie? Du hast deine Schokolade noch nicht bezahlt!«, rief Lisa ihr hinterher. Mit einem höhnischen Grinsen steckte sie ihr Handy und die Quittung ein und widmete sich ihrem doppelten Latte Macchiato.
Am anderen Tisch hatte Emilia die Szene mit wachsender Unruhe beobachtet. Bis auf Toni und Markus waren ihre Klassenkameraden inzwischen aufgebrochen. »Was war das denn eben?«, wandte sie sich an ihre Freunde. »Habt ihr gemerkt, wie seltsam Marie aussah und wie sie sich benommen hat? Da stimmt doch etwas nicht!«
Toni beobachtete Lisa, die gerade damit beschäftigt war, ihren Lippenstift nachzuziehen. »Die sieht aus wie ein Raubtier, das gerade seine Beute gerissen hat!«
»Ja! Gleichzeitig gefährlich und verdammt zufrieden«, stimmte Markus dem Mädchen zu.
Emilia wechselte einen Blick mit ihren Freunden, dann stand sie entschlossen auf und ging zu dem anderen Tisch hinüber. Ohne zu grüßen fragte sie streng: »Was hast du Marie eben auf dem Handy gezeigt? Sie war danach doch völlig durcheinander!«
Lisa schaute kaum auf und machte eine gelangweilte Handbewegung. »Das geht dich gar nichts an, Kleine! Verzieh dich!«
»Tut es sehr wohl! Marie ist meine Freundin, und ihr geht es gar nicht gut, das war deutlich zu sehen. Warum hast du dich nicht besser um sie gekümmert?«, protestierte Emilia.
»Kindchen, ich habe mich um sie gekümmert! Du hast ja keine Ahnung, wie sehr!«, lachte Lisa. Sie schüttelte ihre Haare über die Schultern und drehte gelangweilt ihr Gesicht zur Seite. »Und jetzt hau ab, du störst!«
Emilia funkelte sie böse an. »Marie hat ganz krank ausgesehen! Wenn ich rauskriege, dass du damit etwas zu tun hast, dann störe ich dich noch viel mehr, verlass dich drauf!«
»Wie redest du eigentlich mit mir?«, fuhr Lisa ihre Krallen aus.
»So wie du es offensichtlich verdienst!«, schoss Emilia zurück. Sie machte auf dem Absatz kehrt und ging zu ihren Freunden zurück, die am Ausgang auf sie warteten.
»Hast du gut gemacht!«, meinte ihr Freund Markus und pflanzte völlig überraschend einen Kuss auf ihre Wange! »Ich, äh, ich bin dann mal weg«, stammelte er, stieg auf sein Rad und war so schnell im Herbstwind verschwunden, als sei ihm ein Killermonster auf den Fersen.
»Jungs!«, meinte Toni kopfschüttelnd.
Emilia seufzte. In ihr stritten die Sorge um Maries seltsames Verhalten und die süße Wärme auf ihrer Wange, an der sie Markus‘ Lippen berührt hatten. Es war ja nun nicht »der« berühmte erste Kuss gewesen, aber sehr nahe dran …
Emilias Tagebuch wartete, um ihre Gedanken über das Leben im allgemeinen und Markus im besonderen aufzunehmen, und so rückte der unangenehme Auftritt in der Konditorei Bernauer vorerst in den Hintergrund.
*
Wie Marie auf den Ebereschenhof zurückgekommen war, konnte sie nicht sagen. Wie ein Automat hatte sie sich ins Auto gesetzt und war gefahren. Dass kein Unfall passiert war, grenzte an ein Wunder!
Irgendwann erwachte sie aus ihrer Erstarrung und bemerkte, dass sie offensichtlich schon eine ganze Zeit lang im Auto gesessen hatte. Der Regen hatte aufgehört, und es war sehr kalt geworden. Ohne einen klaren Gedanken zu fassen, stolperte Marie über den Hof, in die aufziehende Dämmerung hinein. Ihr war kalt, so unendlich kalt! Die Frau hatte das Gefühl, niemals im Leben könne ihr wieder warm werden. Mit klammen Fingern tastete sie nach dem Schlüssel und schlich durch den Hintereingang in die Küche.
Ben und Lisa. Lisa und Ben.
Unaufhörlich kreiste dieser Gedanke durch ihren Kopf und machte sie schwindelig. Es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis sie es geschafft hatte, sich einen Becher Tee zu kochen. Erschöpft ließ die junge Frau sich auf die Küchenbank fallen, aber kurze Zeit später stemmte sie sich ächzend wieder hoch. Die eigenartige Unruhe, die sie schon länger spürte, hatte sie wieder gepackt und trieb sie um.
Marie nahm eine Wolldecke und den Teebecher und ging schwerfällig zu der alten Laube am Ende des Gartens hinaus. Vielleicht würde es helfen, ein paar Schritte zu gehen und dann den Tee an ihrem Lieblingsplatz zu trinken. Sie stellte den Becher ab und entzündete mit zitternden Fingern ein Windlicht.
Ben und Lisa. Lisa und Ben.
Es machte sie verrückt! Die Vorstellung der beiden war etwas, was ihre Fantasie überstieg. Ben! Ihr Geliebter, ihr bester Freund und Ehemann. Der Vater zweier unschuldiger Kinder, die darauf warteten, auf die Welt zu kommen. Es war undenkbar! Es war so hinterhältig und gemein, so obszön – trotz allem, was Lisa als Beweise vorgelegt hatte, konnte es nicht wahr sein. Es durfte nicht wahr sein!
Hatte Ben überhaupt die Gelegenheit gehabt, sich zu dieser Ungeheuerlichkeit zu äußern? Was würde er sagen? Was, wenn er Lisas Enthüllungen bestätigte? Gab es nicht doch noch die Möglichkeit, dass alles nur ein bösartiges, abgekartetes Spiel war, das Lisa allein spielte?
»Ben, erlöse mich! Sag, dass das alles nicht wahr ist!«, flüsterte Marie heiser. Angstvoll umklammerte sie das Handy. Plötzlich kam es ihr wie eine Rettungsleine vor, die zwischen Ben und ihr gespannt war. War es falsch gewesen, sich in den vergangenen Tagen von ihm abzuschotten? Egal, was er jetzt zu ihr sagen würde, sie musste es von ihm erfahren, von ihm allein! Mit zitternden Fingern wählte sie seine Nummer und lauschte dem Rufzeichen. Ben mochte am äußersten Ende Norwegens sein, aber er war nicht aus der Welt! Gleich, gleich würde sie mit ihm reden, würde sie ihn alles fragen können …
… aber die für Marie lebenswichtige Verbindung konnte nicht hergestellt werden, Bens Handy war ausgestellt. Es antwortete nur eine mechanische Stimme, die der Anruferin mitteilte, dass der Teilnehmer nicht zu erreichen ist.
Die verzweifelte Frau versuchte es wieder und wieder, aber immer wies sie die Automatenstimme ab. Ben war unerreichbar.
Dämmerung breitete ihr dunkles Tuch über das Land, bald würde es ganz dunkel sein. Der Tee in Maries Becher war kalt geworden. Sie saß noch immer wie betäubt in der Laube und konnte es nicht fassen, dass Ben unerreichbar blieb. Nie schaltete er sein Handy aus, immer hatte sie zumindest eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen können!
Bedeutete das, dass Lisa doch die Wahrheit gesagt hatte? Dass Ben nichts mehr von ihr und ihren Kindern wissen wollte?
Nein, das bedeutete es ganz und gar nicht, aber das konnte die verängstigte Marie nicht wissen. Ben saß zu diesem Zeitpunkt bereits im Flieger von Oslo und befand sich im Landeanflug auf München. Sein langer Heimweg hatte ihn über verschneite Straßen, durch endlose Tunnel und per Fähren über mehrere Fjorde geführt, ehe er einen Inlandsflug nach Oslo erreichte. Übermüdet und gebeutelt von Angst und Hilflosigkeit, hatte Benjamin die norwegische Hauptstadt endlich erreicht und einen Flug nach Deutschland nehmen können.
Sowie er in München gelandet war und sein Handy wieder einschalten durfte, würde er bei Seefelds anrufen und sich nach Marie erkundigen. Die letzten beiden Tage ohne Kontakt zu ihr waren die Hölle gewesen! Er spürte, dass etwas nicht stimmte, und jede einzelne Faser seines Wesens trieb ihn heimwärts.
*
Marie starrte auf das stumme Handy. Was geschah mit ihr? Sie fühlte sich, als ob zwei gegensätzliche Kräfte an ihr zerrten. Da war einerseits die völlige Erschöpfung, die Seele und Körper lähmte und jede Bewegung unmöglich erscheinen ließ. Und andererseits eine nie gekannte Unruhe und Rastlosigkeit, die ihren Körper in Bewegung setzte, obwohl sie keinen einzigen Schritt tun mochte.
Fühlt es sich so an, wenn man verrückt wird?, dachte Marie verschwommen. Schwerfällig stand sie auf und wandte sich der Wiese zu, die an ihren Garten grenzte. Vielleicht half es, die Unruhe abzubauen, wenn sie ein paar Schritte ging? Nur einmal über die Wiese und wieder zurück, danach würde sie ins Haus gehen und sich an den warmen Ofen setzen.
Im Dämmerlicht machte Marie sich auf den Weg. Viel sehen konnte sie nicht mehr, aber das war auch nicht nötig, hier auf der dunklen Wiese gab es keine Hindernisse. Nur welke Grasbüschel – und Maulwurfshügel.
Und genau das wurde Marie zum Verhängnis.
Sie war bereits auf dem Rückweg, als sie über einen dunklen Erdhaufen stolperte, umknickte und zu Boden fiel! Den Sturz konnte sie mit den Händen einigermaßen auffangen, dennoch ging ein harter Stoß durch ihren Körper, und ein dumpfer, heißer Schmerz durchzuckte ihren rechten Knöchel. Mit einem verzweifelten Aufschrei tastete Marie nach dem schmerzenden Gelenk. Wenn sie sich nur nichts gebrochen hatte! Keuchend versuchte sie, in den Vierfüßlerstand zu kommen und dann langsam aufzustehen. Es ging nicht, sie konnte den Fuß einfach nicht belasten.
Panisch schaute die junge Frau um sich: Weit und breit gab es nichts, keinen Strauch, keinen Ast, keinen Zaun, an dem sie sich hätte festhalten und in die Höhe ziehen können. Aber sie musste hoch, sie musste weg hier, konnte doch nicht auf der kalten Erde liegen bleiben! Mit beiden Armen umspannte sie ihren Bauch, versuchte instinktiv, die Babys zu schützen. Niemand würde ihr Rufen hören, niemand sie in der Dunkelheit sehen, sie musste unbedingt ins Haus kommen!
Marie zwang sich zur Ruhe, so gut es ihr möglich war. Sie versuchte, den Schmerz in ihrem anschwellenden Knöchel auszublenden, und bemühte sich, ihren schweren Körper in die Höhe zu stemmen. So weit war sie doch gar nicht von der Laube entfernt, und da lag das Handy, mit dem sie Hilfe rufen konnte. Es musste ihr gelingen, dort hinzukommen!
Sie stöhnte vor Schmerz, als sie den verletzten Fuß bewegte. Und dann spürte sie noch etwas, was den ganzen Tag über schon dagewesen war, sie hatte es nur verzweifelt zu ignorieren versucht. Ein dumpfer Schmerz breitete sich in ihrem Kreuz aus, strahlte hinunter ins Becken und schloss einen eisernen Ring um ihren Leib. Marie schnappte nach Luft, und sie konnte nichts gegen die Tränen tun, welche ihr dieser Schmerz in die Augen trieb.
Sie wusste, dass die Geburt begonnen hatte. Vier Wochen zu früh machten ihre Babys sich auf den Weg ins Leben, und sie lag hilflos und unbeweglich auf einer dunklen Wiese und war ganz allein.
»Ben! Verlass mich nicht!«, wimmerte sie, und dann kam schon die nächste Wehe, und die Welt bestand nur noch aus Angst und Schmerz.
*
Im Doktorhaus verbreitete warmer Lichterschein eine gemütliche Atmosphäre. Sebastian war gerade von der Praxis hinüber in die Stube gekommen, in der sein Vater und Traudel über einem Schachspiel saßen. Emilia kam aus ihrem Zimmer und blätterte flüchtig durch eine Zeitschrift. Bald würden sie alle hinübergehen in die Küche und das Abendbrot vorbereiten.
Das Telefon klingelte. Emilia nahm ab und gab den Hörer an ihren Vater weiter. »Papa, für dich, es ist Ben«, sagte sie stirnrunzelnd. Bens Stimme hatte gehetzt geklungen, nicht so wie sonst. Das hatte Emilia trotz der schlechten Verbindung sofort herausgehört.
Sebastian übernahm und hörte konzentriert zu. Offensichtlich ging es um Marie, denn der Arzt sagte gerade: »Ja, das ist merkwürdig. Deine Frau hatte heute einen Termin bei mir und Anna, und sie ist nicht gekommen, hat auch nicht abgesagt. Das ist untypisch für sie.«
Emilia spitzte die Ohren.
»Wie unangenehm!«, sagte ihr Vater gerade. »Und ihr habt keine Ahnung, von wem die Briefe kommen?«
Sein besorgter Tonfall ließ jetzt alle Familienmitglieder aufhorchen. Was war bei Ben und Marie passiert?
»Natürlich, wir kümmern uns«, sagte Sebastian mit fester Stimme. »Ich fahre raus zu ihr und schaue nach dem Rechten. Wenn ich Näheres weiß, rufe ich dich sofort an. Bleib ruhig, Ben! Bisher war alles mit Marie in Ordnung. Ich melde mich!«
Er legte auf und sagte entschuldigend zu Traudel: »Können wir bitte das Essen verschieben? Ich muss zum Ebereschenhof raus und ein Gefühl sagt mir, es wäre gut, wenn Vater auch mitkommt.«
»Papa, was ist passiert?«, fragte Emilia angstvoll. Plötzlich stand ihr der Auftritt im Café wieder vor Augen. Wie entsetzlich Marie ausgesehen hatte!
»Ich weiß es noch nicht, Emmchen. Bitte, mach dir keine Sorgen. Ben ist durch den Wind, weil er Marie seit zwei Tagen nicht erreichen kann, und heute ist sie nicht zur Untersuchung gekommen und hat sich auch nicht gemeldet. Wir fahren jetzt raus zu ihr«, sagte ihr Vater.
Emilia sprang auf. »Ich fahre mit!«, erklärte sie entschlossen und ließ keinen Protest der anderen gelten. »Wenn wirklich etwas mit ihr passiert ist, dann bin ich schuld, dass sie erst jetzt Hilfe bekommt! Ich hätte viel früher etwas sagen müssen.« Das Mädchen war den Tränen nahe.
»Moment mal! Was meinst du denn damit?«, hakte ihr Großvater besorgt nach.
»Heute Mittag waren wir im Bernauer, und Marie und Lisa waren auch da. Ich habe nicht verstanden, was sie geredet haben, aber es muss ziemlich schlimm gewesen sein. Marie hat furchtbar elend ausgesehen. Dann hat Lisa ihr etwas auf ihrem Handy und auf einem Papier gezeigt. Danach hat Marie geweint und sie ist aus der Konditorei gegangen, als ob sie eine Marionette wäre. Sie hat gar nichts mehr gesagt und wohl auch nichts und niemanden mehr gesehen. Und die Lisa hat ganz gemein gelacht. Ich hab sie gefragt, was sie mit Marie gemacht hat, aber sie hat natürlich nichts gesagt. Wir haben uns deswegen gefetzt, die Lisa und ich. Wenn ich euch das nur schon früher erzählt hätte!«, schloss das Mädchen unglücklich.
»Mach dir deswegen keine Vorwürfe, mein Schatz!«, antwortete ihr Vater liebevoll. »Wir wissen nichts über die Hintergründe, das kann alles oder nichts bedeuten. Du hast gut und verantwortungsvoll reagiert, deshalb denke ich, du kannst mit uns fahren. Lauf schnell und hole deine Jacke.«
Die beiden Ärzte holten ihre Taschen und machten sich auf den Weg zum Auto.
Traudel hatte dem Wortwechsel mit gerunzelten Brauen zugehört. »So, also die Lisa …«, murmelte sie vor sich hin. Als der Geländewagen vom Hof gefahren war, griff sie zum Telefon und rief Lisa an. »Was war das heute in der Konditorei Bernauer?«, fragte sie ohne Umschweife.
»Was? Nichts!«, antwortete Lisa überrumpelt. »Und was geht dich das überhaupt an?«
»Viel!«, entgegnete Traudel erzürnt.
»Ach, nee, das darfst du mir gerne ,etwas genauer erklären!«, spottete Lisa.
»Später!«, fuhr Traudel sie an. »Jetzt gucken wir erstmal, welchen Scherbenhaufen du hinterlassen hast, Lisa! Und ich warne dich: Wenn es Marie oder einem der Babys deinetwegen schlecht geht, dann wirst du dein blaues Wunder erleben!« Grußlos beendete sie das Gespräch.
»He!«, rief Lisa in die tote Leitung. »Was willst du denn damit sagen, alte Gewitterziege?« Wütend knallte sie ihr Telefon auf die Station zurück. Was da aber auch mal wieder für ein Aufwand um die dämliche Marie gemacht wurde! Sollte sie doch ruhig rumheulen wegen ihres Liebeskummers, war ja nichts Neues bei der! »Dumme Nuss, geschieht dir ganz recht!«, knurrte Lisa und schenkte sich einen großen Drink ein, mit dem sie sich vors Internet verzog.
Aber so ganz wollte ihr die gewohnte Ablenkung heute nicht gelingen. War es denn möglich, dass tatsächlich irgendetwas mit Marie passiert sein sollte?
*
Als die Seefelds auf dem Ebereschenhof ankamen, sahen sie zu ihrer Erleichterung, dass Maries Auto vor dem Hof stand und in der Küche Licht brannte. »Also scheint sie zu Hause zu sein«, meinte Benedikt hoffnungsvoll.
Die beiden Ärzte und Emilia gingen durch die unverschlossene Tür in die Küche, die sie leer vorfanden. »Marie? Marie, wo bist du?«, rief Sebastian und ging zur Treppe, während sein Vater die Räume im Erdgeschoss durchsuchte. Emilia lief ums Haus herum und schaute nach Hinweisen, ob ihre Freundin sich vielleicht draußen oder in einem der Nebengebäude aufhielt. Dabei entdeckte sie einen schwachen Lichtschimmer, der fast schon erloschen war.
»Papa! Opa!«, rief sie. »Hinten in der Laube scheint eine Kerze zu brennen. Vielleicht ist Marie dort.«
»Schnell, hole unsere Taschenlampen aus dem Auto und komm damit zur Laube!«, befahl ihr Vater.
Emilia raste zum Wagen, während die beiden Ärzte mit ihren Taschen hinaus in den Garten gingen. Das Licht vom Haus erhellte ihnen den Weg, und sie fanden den Zugang zur Laube sofort.
Leider war sie leer. Auf dem Tisch stand ein Windlicht mit einer erlöschenden Kerze, daneben fanden sie den Teebecher und das Handy. Eine Wolldecke lag herabgeglitten neben einem Stuhl.
»Sie muss hier gewesen sein!«, sagte Sebastian und schaute sich suchend um. »Und weit wird sie nicht gegangen sein in der Dunkelheit.«
Emilia kam mit den Taschenlampen angerannt, und dann durchschnitten zwei helle Lichtkegel die Dunkelheit. »Marie? Marie, wo bist du?« Sie begannen, systematisch die angrenzende Wiese abzuleuchten. »Marie?«
Plötzlich hörten sie ein Wimmern in der Dunkelheit, dem ein Aufschluchzen folgte. »Ihr seid gekommen, ihr seid gekommen!«
Mit ein paar langen Sätzen war Sebastian bei der Stelle, von der die Stimme erklungen war. »Mein Gott!«, stieß er hervor. Zu seinen Füßen lag Marie auf der Seite, den Körper zusammengekrümmt, die Arme um den Leib geschlungen. Sie schluchzte haltlos immer wieder dieselben Worte: »Ihr seid gekommen, ihr seid gekommen …«
Sebastian kniete neben ihr und drehte sanft, aber nachdrücklich ihr Gesicht zu sich herum. »Marie, schau mich an! Sag uns, was passiert ist.«
Die junge Frau krümmte sich unter einer neuen Wehe. Benedikt und Sebastian wechselten einen besorgten Blick. »Ich bin … gestolpert und hingefallen, mein Fuß …, ich kann nicht auftreten«, stöhnte Marie. »Ich konnte nicht wieder aufstehen, und dann …, dann haben die Wehen begonnen.«
»Emilia, setzt dich hin und nimm Maries Kopf in deinen Schoß, damit sie etwas bequemer liegt«, ordnete Sebastian ruhig an.
»Ich hole den Wagen«, sagte sein Vater und sprintete zum Hof zurück.
»Marie, bitte, hör mir gut zu!«, bat Sebastian eindringlich. »Wir sind hier, um dir zu helfen, alles wird gut! Vater holt den Wagen, und wir bringen dich in die Praxis. Du brauchst dich gar nicht viel zu bewegen, wir helfen dir.« Routiniert überprüfte er den Puls und das Aussehen der Patientin. »Du musst als erstes vom kalten Boden hoch und in die Wärme! Wie lange liegst du schon hier?«
»Ich … weiß nicht, vielleicht eine Stunde?«, murmelte Marie benommen.
»Und du hattest die ganze Zeit Wehen?«, fragte Sebastian weiter.
Die junge Frau nickte mit zusammengebissenen Zähnen.
»Hast du Fruchtwasser verloren?«, fragte der Arzt besorgt weiter.
»Nein, ich glaube nicht«, murmelte Marie.
»Das ist sehr gut!« Für den Moment war Sebastian erleichtert. Die Babys waren also noch relativ geschützt. Wenn sie es schafften, Marie in die Wärme und Sicherheit der Praxis zu bringen, hatten sie ein großes Stück auf diesem gefahrvollen Weg zurückgelegt.
»Ben …«, murmelte sie.
»Ist schon fast hier!«, antwortete Sebastian.
»Was?« Seine Worte schienen den Nebel aus Schmerz und Benommenheit durchdrungen zu haben, in dem Marie trieb. »Was hast du gesagt?«
»Dass Ben schon fast zu Hause ist! Er sitzt im Zug nach Bergmoosbach und ist bald bei dir«, erklärte Sebastian.
»Aber … was …?«, stotterte Marie.
»Besprechen wir das später, jetzt musst du so schnell wie möglich ins Warme!«, unterbrach der Arzt sie bestimmt.
Benedikt hatte den Wagen so dicht wie möglich an die kleine Gruppe herangefahren und half jetzt seinem Sohn, die Verletzte so schonend wie möglich vom Boden auf die Rückbank des Autos in ein warmes Nest aus Decken zu befördern. Sebastian setzte sich zu ihr, Benedikt übernahm das Steuer, und Emilia setzte sich neben ihn. So schnell wie nötig und so behutsam wie möglich fuhren sie zur Praxis hinunter. Sebastian behielt Maries Zustand im Auge, während er per Telefon einige knappe Anweisungen an Traudel durchgab und die Uniklinik wegen der Brutkästen und der Kinderspezialisten verständigte. Sie Kollegen waren mit Blaulicht und Sirene auf dem Weg nach Bergmoosbach, während Benedikt den Wagen vorm Praxiseingang stoppte.
Die Türen flogen auf, und Anna und Traudel nahmen sie in Empfang. In der Praxis war der Behandlungsraum bereits hochgeheizt, die Liege in die Mitte des Zimmers geschoben und mit zusätzlichen Laken und Kissen ausgestattet. Alles, was Anna zur Geburt brauchte, lag bereit. Zwei Federkissen waren mit geübten Handgriffen in Taschen verwandelt worden, die für die beiden Frühchen in der ersten Not den wärmenden Brutkasten ersetzen mussten.
Während Traudel die junge Frau von ihrer klammen und schmutzigen Kleidung befreite und ihr auf die Liege half, tauschten die drei Mediziner besorgte Blicke. Ihre größte Sorge war, dass die Frühchen so unreif waren, dass sie beatmet werden mussten, und das konnte eine Landarztpraxis nicht bieten. Es würde dauern, bis die Kollegen von der Klinik mit den entsprechenden Geräten hier waren, bis dahin musste es eben so gehen.
»Es sind nur vier Wochen, die den Kleinen fehlen«, sagte Sebastian leise zu Anna, als sie sich die Hände wuschen und desinfizierten.
Die Hebamme nickte stumm. Wenn eine Geburt begonnen hatte, gab es kein Zurück. Sie mussten jetzt einfach alles tun, was in ihrer Macht stand, und auf das Beste hoffen.
Maries Knöchel schien nicht gebrochen zu sein, sondern nur verstaucht. Das würde man in der Klinik abklären. Jetzt konnten sie den Fuß nur hochlegen und kühlen; es war das geringste Problem, vor dem sie standen.
Anna untersuchte Marie. »Es sieht gut aus!«, sagte sie zuversichtlich. »Die Herztöne der Kinder sind kräftig und gleichmäßig, ihnen geht es gut. Dein Muttermund ist schon sieben Zentimeter weit geöffnet. Du machst das sehr gut, Marie. Es wird nicht mehr lange dauern, und du kannst dein erstes Baby im Arm halten.«
Marie stöhnte unter der Wehe und warf den Kopf von einer Seite zur anderen. »Ben!«, schluchzte sie. »Ben ist nicht hier. Ich muss ihm sagen …, muss ihm sagen …, liebe ihn so sehr!«
»Das weiß er!« Sebastians ruhige Stimme durchdrang die Schmerzen der jungen Frau. »Er weiß es, Marie.«
»Darf nicht … mit Lisa … gehen!«, keuchte Marie.
»Lisa hat hier nichts zu suchen!«, erklärte Sebastian energisch. »Wir sind hier ganz unter uns, hörst du, Marie? Nur du und die Kinder und wir drei Geburtshelfer. Hier haben falsche Blondinen nichts verloren!«
Trotz ihrer Verzweiflung und Schmerzen musste Marie beinahe lachen. »Ihr seid … so lieb«, murmelte sie.
»Na, wir müssen dich doch bei Laune halten«, meinte Sebastian. Mit einem Ohr hatte er die Türklingel und Stimmen draußen im Vorraum wahrgenommen. »Du willst doch nicht völlig verweint aussehen, wenn Ben hier hereinkommt, oder?«
»Er kommt doch nicht«, flüsterte Marie, und dann riss die nächste Wehe sie mit sich.
»Marie? Du musst die Augen aufmachen. Guck doch mal, wer hier ist!«, sagte auf einmal Annas sanfte Stimme direkt neben ihrem Ohr.
Marie wollte nicht. Die heftige Wehe war abgeklungen, und sie schwebte in einem herrlichen, unwirklichen Zustand der Schmerzlosigkeit, an dem sie nicht die kleinste Kleinigkeit verändern wollte, nicht einmal die Augen öffnen. Aber …
»Marie! Liebste! Bitte, bitte schau mich doch an!« Annas Stimme war verschwunden und durch eine tiefe, schmerzlich vertraute Männerstimme ausgetauscht. Das konnte nicht sein, das träumte sie. So ein schöner Traum, wenn er doch nie enden würde! »Marie, bitte, mach die Augen auf, bitte!«, flehte die Stimme weiter.
Hände legten sich um ihr Gesicht, warme Lippen streiften über ihren Mund, sie spürte vertraute, weiche Barthaare über ihre Wange streichen. Dieser Traum wurde immer schöner. Warum sollte sie aufwachen?
Marie spürte, wie sich die nächste gewaltige Schmerzwelle in ihr aufbaute. Sie tastete blindlings nach einem Halt, riss panisch die Augen auf – und schaute genau in Bens Gesicht, das ganz dicht über ihrem schwebte.
»Ben?« Ihr fassungsloses Staunen war so groß, dass der Schmerzensschrei auf ihren Lippen zu einem überraschten Schluchzen erstarb. »Ben? Du bist … zu mir gekommen? Du bist hier?«
»Natürlich! Wo sollte ich denn sonst sein!«, flüsterte Ben heiser. Tränen liefen über seine Wangen. Er sah schrecklich erschöpft und angstvoll und so wundervoll vertraut aus, dass Marie seine Gegenwart bis ins Innerste ihres Seins spürte. Er war an ihrer Seite, und er war ihr Mann! Erstarrung und Eiseskälte lösten sich von ihrem Herzen, und alles war plötzlich so leicht. »Ich liebe dich, nur dich! Es hat nie eine andre gegeben, egal, wer das behauptet! Das sind Lügen, nichts als Lügen, hörst du?«, schluchzte Ben.
Marie legte ihre Arme um seinen Nacken. »Ja!«, flüsterte sie. »Ja!« Und ihre Augen, die sie eben noch gegen den Schmerz der Welt geschlossen hatte, leuchteten wie ein ganzer Sternenhimmel.
Dann ging plötzlich alles ganz schnell.
Die Ärzte forderten Ben auf, sich mit gespreizten Beinen so hinter Marie auf das Bett zu setzen, dass sie sich mit ihrem Rücken fest gegen ihn lehnen konnte. Er legte seine Arme um sie, ihre Finger verschränkten sich, und Marie fand den unerschütterlichen Halt, den sie jetzt brauchte. Sie verschmolzen zu einer kraftvollen Einheit, und ihr erstes Kind wurde geboren.
Ein kleines Mädchen. Ganz winzig und zart und mit einem Schopf dunkler Haare. Atemlos sahen sie, wie die Ärzte mit geübten Bewegungen die Nabelschnur durchschnitten, das winzige Geschöpf sofort in vorgewärmte Tücher wickelten und die Atemwege absaugten. Eine Sekunde herrschte angespannte Stille, dann folgte ein leises Niesen, ein Maunzen wie von einem neugeborenen Kätzchen, und dann kam der erste, mit Bangen erwartete Schrei. Die Lungen der Kleinen füllten sich mit Luft, und sie atmete aus eigener Kraft!
Sebastian Seefeld lachte vor Glück und Erleichterung. »Siehst du, Marie? Siehst du sie, deine Kleine? Es geht ihr gut!« Er schob das winzige Bündel in das vorbereitete Kissen und legte Marie ihr Kind in die Arme. »Wie soll die junge Dame denn heißen?«
»Elise«, antwortete die junge Mutter zwischen Lachen und Weinen. »Sie heißt nach meiner Mutter.«
Dann spürte sie die nächste Wehe kommen. Elise fand Geborgenheit in den Armen Benedikt Seefelds, während Marie mit einer allerletzten Kraftanstrengung, unterstützt von ihrem Mann, der Hebamme und dem jungen Arzt, ihr zweites Kind zur Welt brachte. Es war wieder ein kleines Mädchen, ebenso zart wie ihre Schwester und ebenso dunkelhaarig. Und genau wie das erste Baby konnte auch dieses aus eigener Kraft atmen und sich zum Leben entfalten!
Freude und Glück waren kaum mit Worten zu beschreiben, als beide Kinder gesund in den Armen ihrer Eltern lagen! Das zweite kleine Mädchen hieß Helene, nach Benjamins Mutter. Sebastian lächelte leise, als er den Namen hörte, so hatte auch seine Frau geheißen.
Als wenig später die Krankenwagen von der Uniklinik eintrafen, fanden sie statt einer dramatischen Notsituation eine glückliche Familie und ein nicht weniger glückliches Ärzteteam vor. »Na, Kollegen, da habt ihr aber ganze Arbeit geleistet!«, meinte der eine der beiden Kinderärzte, die mit den Inkubatoren gekommen waren, zufrieden. Sie führten die ersten Untersuchungen durch. Es gab keine Auffälligkeiten, aber vorsichtshalber wurden die Kleinen in die Brutkästen gelegt, um sie sicher überwacht ins Klinikum zu fahren. Im nächsten Krankenwagen fanden eine strahlende Marie und ihr Ehemann Platz. Es gab einen kurzen, aber herzlichen Abschied von den Seefelds und von Anna, und dann wurde die junge Familie zur Nachsorge ins Uniklinikum gefahren.
*
»Jesses! Was ist denn drüben bei Doktors los? Da sind zwei Krankenwagen und jede Menge anderer Ärzte gekommen!« Afra, die gegenüber der Praxis wohnte, klebte am Fenster. »Und was für Dinger schieben die in die Praxis? Ich kann’s grad nicht genau erkennen, aber es schaut wie zwei Brutkästen aus. Ob die Marie ihre Kinder kriegt? Aber das ist doch viel zu früh! Die armen Würmer, wenn das nur gut geht!«
»Was soll denn schon nicht gut gehen?«, maulte Lisa, die von Afra per Telefon mit diesen Neuigkeiten versorgt wurde. »Was ist das immer für eine blöde Aufregung um diese Marie und ihre Bälger.«
»Na, na! Jetzt red mal nicht so hässlich daher!«, mahnte Afra. »Du weißt schon, dass die Babys sterben können, wenn sie zu früh geboren werden?«
»Schmarrn!«, knurrte Lisa und beendete das Gespräch.
*
Daheim im Doktorhaus hatten Sebastian und Anna inzwischen das Geburtszimmer aufgeräumt und wieder in ein normales Behandlungszimmer umgewandelt. Die notwendigen Berichte waren geschrieben worden, und nun gingen die beiden Kollegen hinüber in die Küche, wo eine sehr glückliche und erleichterte Emilia das Abendessen vorbereitet hatte. Um den Anlass gebührend zu feiern, hatte das Mädchen den Tisch besonders schön mit Hagebutten, letzten Rosen und leuchtenden Kerzen gedeckt.
Sie und ihr Vater, Anna, ihr Großvater und Traudel saßen noch bis in die Nacht hinein zusammen und feierten den glücklichen Ausgang des dramatischen Geschehens. Es wäre so anders ausgegangen, hätten sie Marie nicht rechtzeitig gefunden!
»Auf eine starke, tapfere Mutter und auf Helene und Elise!«, lächelte Benedikt und hob sein Glas.
»Auf drei tolle Geburtshelfer, ohne die es nicht gegangen wäre!«, rief Emilia stolz.
»Auf das Leben!«, schloss Sebastian, und ihre Gläser stießen mit einem feinen Klang aneinander.
*
Die Sterne, welche über dem Dorf im Tal funkelten, leuchteten auch vor den Fenstern des Familienzimmers in der Uniklinik, in der die kleine Familie lag. Trotz der widrigen Umstände ging es allen sehr gut. Helene und Elise hatten die Brutkästen verlassen können und lagen zusammengekuschelt in einem Wärmebettchen bei ihren Eltern. Marie hatte die Zwillingsgeburt erstaunlich gut überstanden, und auch der Sturz und die Zeit auf dem kalten Untergrund hatten ihr keinen dauerhaften Schaden zugefügt. Ihr verstauchter Fuß würde abschwellen. Sie vergaß den Schmerz über dem zweifachen Wunder, das in seinem Bettchen neben ihr schlief.
Und Ben – Ben war bei ihr! Er hatte sein Bett ganz nahe an ihres geschoben, sodass sie in seinen Armen liegen konnte. Marie schmiegte ihren Kopf an seine Schulter und lauschte seinen Atemzügen.
Vorhin hatten sie mit einander gesprochen, und alle Bosheit und Abgefeimtheiten waren ans Licht gekommen. Ben war außer sich vor Zorn gewesen! »Wie kann ein Mensch so etwas nur tun! Wie kann man sich nur solche Gemeinheiten ausdenken!«, knurrte er. »Wenn dir etwas passiert wäre, Marie, dir oder den Kindern …« Er konnte nicht weitersprechen, Entsetzen und Ekel schnürte ihm die Kehle zu.
»Es ist aber nichts passiert, alles ist gut!«, hatte sie geantwortet und sein Gesicht sanft zu sich herunter gezogen. »Es ist vorbei! Jetzt beginnt unser gemeinsames Leben als Familie.«
Und Ben hatte seinen Kopf geneigt vor ihrer Liebe, ihrer Geduld und der Fähigkeit, das Böse hinter sich zu lassen.
Nun schlief er tief und friedlich, erschöpft von dem langen, beschwerlichen Weg über Fjorde und Berge, durch Missverständnisse und Intrigen. Er schlief an der Seite seiner Frau und seiner kleinen Töchter. Das ruhige Heben und Senken seiner Brust nahm Marie in den Rhythmus seines Atmens mit hinein, und während noch ein Lächeln um ihre Lippen spielte, glitt auch sie in einen heilsamen Schlaf hinüber.