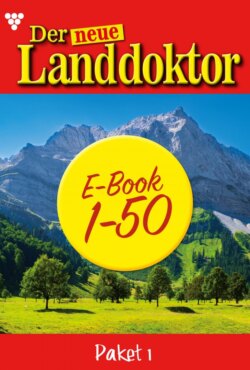Читать книгу Der neue Landdoktor Paket 1 – Arztroman - Tessa Hofreiter - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»… bye …«, der englische Abschiedsgruß wurde mehr genuschelt als ausgesprochen. Emilias verschlossenes Gesicht verschwand fast ganz hinter dem Vorhang ihrer seidigen Haare. Das sehr junge Mädchen gönnte den beiden Erwachsenen am Tisch in der gemütlichen Küche des Doktorhauses nur einen flüchtigen Blick. Mit knappen Bewegungen setzte sie die Kopfhörer ihres iPhones auf, griff nach dem Rucksack mit ihren Schulsachen und verließ den Raum. Alles an ihrem Benehmen signalisierte: Lasst mich bloß in Ruhe!
Mit einem Seufzer stellte die Haushälterin Traudel Bruckner ihren Kaffeebecher zurück auf den Tisch. »Sie ist halt noch ein rechtes Kind«, sagte sie ein wenig hilflos. »Wir müssen Geduld mit ihr haben.«
Doktor Benedikt Seefeld nickte ernst. »Das weiß ich, und dennoch wird mir das Herz schwer, wenn ich meine Enkelin so verschlossen und abwehrend erlebe. Traudel, manchmal frage ich mich …« Er verstummte und schaute gedankenverloren durch die weit geöffnete Tür in den herrlichen Sommermorgen hinaus.
»Du fragst dich manchmal, ob es richtig war, deinen Sohn und deine Enkeltochter zu bitten, wieder heim zu kommen?« Behutsam streckte die Frau ihre Hand aus und legte sie auf den Arm des älteren Mannes. Es war eine kleine Geste des Trostes, ein Zeichen langer Verbundenheit. »Wir müssen ihnen nur Zeit geben. Uns allen, Benedikt. So ein Neubeginn ist niemals einfach; schon gar nicht einer, der vorher so viel Schmerz und Abschied bedeutete. Aber mit der Zeit gewöhnt das Kind sich hier ein und findet sein Zuhause, wirst schon sehen!« Voller Zuversicht und Wärme schauten ihre dunklen Augen den Doktor an.
Traudel Bruckner war mehr als nur die Haushälterin in der Familie Seefeld, sie war die Seele des Hauses. Auch jetzt verfehlte ihre zuversichtliche, warmherzige Art nicht die Wirkung auf den älteren Mann. Es fühlte sich an, als Wäre ein wenig der Schwere, die auf seinem Herzen lastete, angehoben worden. Er lächelte. »Was wäre ich nur ohne dich, Traudel!« Seine Hand legte sich kurz über die der älteren Frau.
»Ein Mannsbild, das mit seinem Terminkalender zu kämpfen hat!«, antwortete Traudel munter. »Drüben in der Praxis bereitet die Sprechstundenhilfe schon die Unterlagen für die ersten Patienten vor, ich höre den Lieferwagen der Wäscherei im Hof, und wenn mich nicht alles täuscht, höre ich auch den Husten des alten Ederer, der schon mal auf der Bank vorm Praxiseingang Stellung bezieht. Also höchste Zeit für die Sprechstunde, die du heute in Vertretung für deinen Sohn übernimmst, mein lieber Doktor Seefeld. Von Ruhestand kann hier keine Rede sein!«
Der alte Landarzt lachte. »Wenn du es sagst …«, meinte er augenzwinkernd. Er erhob sich und ging sichtlich guter Stimmung hinüber in die Praxisräume, in denen sich bis vor kurzem sein Berufsleben abgespielt hatte. Ja, dachte er voller Zuversicht, es ist richtig gewesen, sich aus dem täglichen Geschehen zurückzuziehen und dem Sohn als Nachfolger die Praxis zu übergeben! Nur in bestimmten Situationen werde ich wieder in den weißen Kittel schlüpfen.
Freundlich grüßend betrat der Landarzt die altvertrauten Räume und wandte sich seinem ersten Patienten zu. »Grüß Gott, Ederer, wie geht’s denn heute Morgen?«
»Ja, mei, der Husten, der wird ja schon besser. Der Saft, den die Schwiegertochter aus der Apotheke geholt hat, hilft. Aber das Rheuma in den Knien, da musst du noch was tun, Doktor, das wird immer schlimmer!« Streng schaute der alte Mann unter gerunzelten Augenbrauen zu dem Arzt hinüber. »Da muss eine andere Salbe her.«
Der Landarzt behielt seine Freundlichkeit bei, obwohl er einen kleinen, innerlichen Seufzer unterdrücken musste. Auch eine neue Salbe würde die Beschwerde des alten Mannes nicht beheben. Es war kein Rheuma, das den Greis in seinen Knien plagte, es war eine Verschleißerscheinung, wie sie im Laufe eines langen Lebens leider häufig auftritt. Benedikt Seefeld zögerte mit der Antwort. Er hatte durchaus Respekt vor bewährten Hausmitteln und altem Wissen. Und wenn den Ederer eine neue Salbe zufrieden stellte – des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Nachdem sich der Arzt vergewissert hatte, dass bei seinem Patienten keine Allergie vorlag, legte er eine Probe des Medikaments auf den Schreibtisch. »Du kannst es mal mit dieser Salbe probieren. Aber ich sag dir gleich: erwarte nicht zuviel davon! Es ist kein Wundermittel, und was dir wirklich helfen kann, das weißt du. Wir haben oft davon gesprochen!«
»Keine Ersatzteile!«, konterte Gotthilf Ederer störrisch. »Bei mir wechselst du nichts aus!«
»Aber abhorchen und mich um deine Bronchien kümmern, das darf ich schon!«, brachte ihn der Arzt freundlich, aber bestimmt wieder auf Kurs und griff zu seinem Stethoskop.
»Ja, freilich, deswegen bin ich doch hier«, schnaufte der alte Mann. Bereitwillig ließ er sich vom Doktor aus dem Janker helfen und knöpfte sein Hemd auf. Seine buschigen Augenbrauen waren jetzt nicht mehr missbilligend gerunzelt, Gotthilf Ederer war zufrieden, er hatte eine neue Salbe bekommen. Man musste die Menschen halt zu nehmen wissen.
*
Im großen Klinikum, das gleichzeitig das Lehrkrankenhaus der nächst gelegenen Unistadt war, neigte sich der Gastvortrag Sebastian Seefelds dem Ende entgegen. Man hatte ihn gebeten, vor Medizinstudenten, die bald ihr Examen ablegen würden, über den Beruf des Landarztes zu sprechen.
Doktor Sebastian Seefeld, Anfang Vierzig, war groß und schlank, mit dunklen Haaren und bemerkenswerten grauen Augen. Sein Blick war beim Sprechen auf die Gruppe angehender Mediziner gerichtet, er wirkte hoch konzentriert und gleichzeitig freundlich.
»Sollten Sie sich entscheiden, als klassischer Landarzt zu arbeiten, so wird Ihnen vielleicht die Frage gestellt: ist das nicht langweilig? Ein langes, hartes Studium über sechs Jahre, anschließend noch die fünfjährige Ausbildung zum Facharzt – und wofür? Um Erkältungen zu kurieren, eine Nagelbettentzündung zu heilen und Kompressionsstrümpfe gegen Krampfadern zu verschreiben? Stundenlang über abgelegene Straßen zu kurven, um Hausbesuche zu machen? Und das alles auf dem Land, ohne die attraktiven Freizeitangebote und Ablenkungen einer städtischen Umgebung!«
»Genau das frage ich mich auch!«, raunte einer der jungen Studenten seiner Nachbarin zu.
Diese zuckte mit den Achseln. »Es wird schon was dran sein«, flüsterte sie zurück, leicht genervt von der Ablenkung. »Oder glaubst du, jemand, der an diesem berühmten Klinikum in Toronto gearbeitet hat, gibt das auf für nichts und wieder nichts?«
»Keine Ahnung; für mich ist das jedenfalls nichts!«, kam die geflüsterte Antwort. Es klang ein wenig geringschätzig.
Die junge Frau warf ihm einen kurzen Blick zu. Funkelte da eine Prise Spott in ihren klaren grau-grünen Augen? »Das glaube ich dir gern!«, sagte sie trocken und richtete dann wieder ihre volle Aufmerksamkeit auf Doktor Seefeld.
»Unser Beruf hat so viele unterschiedliche Seiten«, sagte er gerade. »Und bitte, glauben Sie mir: das, was davon in diesen amerikanischen Arztserien gezeigt wird, entspricht in den seltensten Fällen der Wirklichkeit. Obwohl es schon Spaß macht, sich anzuschauen, wie Ärzte die Wohnung eines Patienten, der mit unklaren Symptomen im Krankenhaus liegt, stürmen, alles auf den Kopf stellen und unter den Füßen des Bettes genau den Erreger nachweisen, der eigentlich gar nicht existieren dürfte.«
Die Studenten grinsten. Sie wussten genau, wovon der Doktor sprach.
Freundlicher Applaus der Studenten begleitete Sebastians Abgang aus dem Seminarraum. Neben ihm ging Susanna, eine leitende Oberärztin hier im Haus, die ihn zu diesem Vortrag eingeladen hatten. Als kleine Kinder hatten Sebastian und Susanna gemeinsam die Schule in Bergmoosbach besucht.
»Hast du Lust, noch auf einen Kaffee mit in mein Büro zu kommen?«, lud Susanna ihn ein. Im Stillen fragte auch sie sich, weshalb ein so erfahrener und vielseitiger Mediziner (und nebenbei bemerkt, ein äußerst charmanter Mann) wie Sebastian Seefeld diesen Weg einschlug. Susanna hatte sich für den Vortrag ein wenig freie Zeit organisiert, und es wäre doch nett, das mit einem kleinen privaten Zusammentreffen abzuschließen.
»Tut mir leid, Susanna, danke für die Einladung, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss gleich zurück nach Bergmoosbach fahren«, antwortete Sebastian.
Susanna bemühte sich, ihre Enttäuschung zu verbergen. »So schnell schon? Ich dachte, dein Vater übernimmt am Donnerstag die Praxis für dich.«
»Das schon«, erwiderte der Mann, schon halb auf dem Absprung. »Aber da ist vieles, worum ich mich kümmern muss. Bye, Susanna.« Der fremdsprachige Abschiedsgruß war herausgerutscht, ehe Sebastian es verhindern konnte. Entschuldigend zuckte er die Achseln. »Macht der Gewohnheit! Ich wollte natürlich sagen: pfiat di, Sannerl.« Er verabschiedete sich mit einem Augenzwinkern und verschwand um die Biegung des Ganges.
Aha, er musste sich also kümmern, der Sebastian … Am liebsten hätte Susanna jetzt ein Gesicht gezogen, aber sie besann sich gerade noch rechtzeitig darauf, wo sie war und wer sie war. Auf gar keinen Fall das kleine Schulmädel, das zornig wurde und Sebastians Ranzen aus dem Fenster pfefferte, weil der Bub nicht mit ihr zum Schwimmen an die Sternwolkenseen gehen wollte!
Und was das betraf, worum er sich in seinem neuen Leben kümmern wollte – nun, das ließe sich herausfinden. Susanna beschloss, Bergmoosbach beizeiten einen Besuch abzustatten und das Leben im Doktorhaus ein wenig unter die Lupe zu nehmen.
*
Die Heimfahrt konnte Sebastian trotz der sorgenvollen Gedanken, die um seine Tochter Emilia kreisten, genießen. Er liebte den Anblick der sattgrünen Wiesen und Weiden, die Berge im Hintergrund, welche wie blau verschleiert wirkten, und die Ruhe, welche über der Landschaft lag. Er fuhr bewusst langsam, mit geöffnetem Fenster, um den unvergleichlichen Duft der Heumahd tief in sich aufzunehmen. Glockenblumen leuchteten blau neben dem Gelb von Arnika und Gämswurz, Kamille und leuchtender Klatschmohn wiegten sich im Sommerwind. Hinter den Zäunen jenseits des Weges weideten Milchkühe oder lagen dösend in der Sonne. Von den Hügeln grüßten vereinzelt alte Höfe zu ihm herab, er konnte den tiefroten Geranienschmuck an den hölzernen Balkonen erkennen. Obwohl Sebastian gut zwei Jahrzehnte lang im Ausland gelebt hatte, spürte er, dass seine Wurzeln hier lagen. Zwar liebte er nach wie vor die Großartigkeit der kanadischen Natur und auch das pulsierende Leben in der Millionenstadt Toronto am Ontariosee, aber hier war er geboren und aufgewachsen. Die Landschaft, das Brauchtum, die Wesensart der Menschen hier lagen ihm im Blut. All das begrüßte ihn wie ein alter Freund.
Aber Emilia kann es nicht so empfinden, dachte der besorgte Vater, für sie ist Kanada die Heimat. Das Einleben hier fällt ihr sichtlich schwer; was ist nur aus dem fröhlichen, strahlenden Mädchen geworden! Und nun schmeckte auch das Essen nicht mehr.
American Pancakes, das ist es! Diese kleinen amerikanischen Pfannkuchen mit Blaubeeren und Ahornsirup, dazu hauchdünn geschnittenen und kross gebratenen Speck, überlegte Sebastian. Wann hat sie das zum letzten Mal gegessen? Bis auf den Ahornsirup hat Traudel die Zutaten bestimmt im Haus, und um den Rest kümmere ich mich.
Voller Vorfreude auf das Essen hielt Sebastian vor einem kleinen Supermarkt, griff sich einen der Einkaufskörbe und machte sich schwungvoll auf die Suche nach dem Ahornsirup.
Vielleicht ein wenig zu schwungvoll, denn als er um das Regal mit dem Zwieback und anderen Backwaren bog, rannte er eine Frau buchstäblich um! Und weil Sebastian Seefeld ziemlich groß und breitschultrig war und die Frau klein und zart, verlor sie das Gleichgewicht und landete unsanft auf einem Podest mit gestapelten Konservendosen, welche mit beachtlichem Getöse zu Boden gingen und durch den Laden kullerten.
»Um Himmels willen, haben Sie sich verletzt?« Besorgt kniete Sebastian sich vor die junge Frau.
Sie saß leicht benommen auf dem Podest, auf dem sich eben noch jede Menge Ananas- und Pfirsichdosen befunden hatten, und schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube nicht«, murmelte sie. »Das mag ein paar blaue Flecken geben, die Ränder der Konservendosen sind nicht gerade weich, aber das ist nicht wirklich schlimm.«
»Und ob!«, widersprach Sebastian. »Es können Prellungen dabei sein, die sehr unangenehm sind. Lassen Sie sich vorsichtshalber untersuchen. Ich bin Arzt, meine Praxis ist gleich die Straße hinauf.«
»Kommt nicht infrage!«, antwortete die junge Frau energisch. Das Aufsehen, das sie mit dem lauten Gepolter erregt hatte, war ihr schon mehr als peinlich. Wie neugierig schon wieder alle herschauten! »Wer wird denn wegen einiger blauer Flecken zum Arzt gehen.« Sie war schon wieder auf den Beinen und sammelte ihre Lebensmittel ein, die aus dem Einkaufskorb gefallen waren. »Ich möchte jetzt nur nach Hause!«
»Bitte, nehmen Sie diesen Zusammenstoß nicht auf die leichte Schulter!«, warnte Sebastian. »Vielleicht sind …«
»Marie? Marie Legrand? Bist du das wirklich?« Eine hohe und etwas atemlose Klein-Mädchen-Stimme unterbrach den Satz des Arztes. Die Stimme gehörte zu einer jungen Frau mit langen superblonden Haaren, unter denen goldene Creolen schaukelten. Himmelblaue Augen, die von unnatürlich langen und tiefschwarzen Wimpern umrahmt waren, schauten mit einer Mischung aus Dramatik und überraschter Wiedersehensfreude auf die andere Frau. »Ja, da schau her! Die Marie Legrand ist wieder daheim!«
»Grüß dich, Lisa!«, konnte sie gerade noch antworten, ehe sie in einer heftigen Umarmung der Blondine verschwand. Unter allerhand Gekreisch und Begeisterungsrufen wurde sie von ihrer aufgeregten Freundin willkommen geheißen.
»Ja, grüß dich auch, Marie, grüß dich! Ja, ist das eine Überraschung, dich hier zu sehen, damit hab ich gar nicht gerechnet! Wir dachten alle, du bleibst in Frankreich mit deinem Fabian. Und schon bist du wieder hier, so kurz nach der Beerdigung vom Vater. Es ist doch wohl nicht schon wieder ein trauriger Anlass, der dich herführt, gell? So ein Kummer, erst stirbt die Mutter und kein Jahr später der Vater, und du bist so weit weg in Frankreich. Aber sag, was führt dich her? Bist du zu Besuch, willst du bleiben, was machst denn du mit dem Ebereschenhof?«
Die Fragen prasselten nur so auf die junge Frau ein, die von Minute zu Minute erschöpfter aussah. Endlich gelang es ihr, auch zu Wort zu kommen. »Lisa, ich freu mich auch, dich zu sehen, aber lass uns ein anderes Mal weiterreden. Ich bin gerade erst angekommen und will jetzt zum Hof hinauf. Ich ruf dich an, ja?«
»Sehr vernünftig!«, mischte sich jetzt Sebastian ins Gespräch. »Wenn Sie schon keine ärztliche Untersuchung wünschen, dann werde ich wenigstens dafür sorgen, dass Sie sicher nach Hause kommen und sich ausruhen. Ich fahre Sie, und ich untersage Ihnen jegliche Widerrede! Das ist eine ärztliche Anordnung!«
»Und sogar rezeptfrei«, antwortete Marie. Sie hatte ihre Fassung wiedergewonnen und auch ihren Humor, aber trotzdem wollte sie jetzt nichts wie weg hier. Die Ankunft in ihrem Heimatort hatte sie sich wesentlich ruhiger und unauffälliger vorgestellt! So schnell wie möglich bezahlte sie ihre Einkäufe und verließ in Begleitung des Doktors das Geschäft.
Lisa schaute ihr mit einem seltsamen Gesichtsausdruck hinterher. Das Lächeln war aus ihrem Gesicht verschwunden, und auch der Ausdruck ihrer blauen Strahleaugen hatte sich merklich verändert.
So, so, die Marie Höfer, verheiratete Madame Legrand, war also wieder im Ort.
Und auffallend allein, ohne ihren Ehemann, einen gewissen Franzosen namens Fabian Legrand. Und wenn man’s recht bedachte, war Marie auch schon zu den Beerdigungen ihrer Eltern ohne Begleitung erschienen. Tat man so etwas, wenn man glücklich verheiratet war? Mit einem hinreißenden Mann, charmant, reich, großzügig … der es zwar mit der Treue nicht so genau nahm, aber schließlich konnte man nicht alles haben, nicht wahr?
»Marie, du schaust so aus, als ob deine glücklichen Tage ziemlich rar geworden sind«, murmelte Lisa, und endlich kehrte das Lächeln auf ihre roten Lippen zurück. Es war ein Lächeln, das einem aufmerksamen Beobachter einen Schauer über den Rücken hätte rieseln lassen.
»Hast was gesagt?« Eine weitere junge Frau tauchte neben der Blondine auf. Es war Fanny Lechner, die Besitzerin des Lebensmittelgeschäfts. Sie, Marie und Lisa waren gemeinsam hier zur Schule gegangen, und Fanny war Kundin in Lisas Schönheits- und Friseursalon Glamour. »Anstatt herumzustehen und Löcher in die Luft zu starren, könntest du schon helfen, die Dosen wieder einzusammeln!«, meinte sie resolut.
Ungläubig schaute Lisa zu ihr hinunter, die bereits am Boden kniete. »Etwa mit diesen Fingernägeln?«, fragte sie. Ihre Hände mit den sorgsam geformten Gelnägeln und den glitzernden Verzierungen wedelten vor Fannys Gesicht herum. »Wohl eher nicht! Tschau, tschau, Fanny.« Damit stöckelte Lisa aus dem Laden.
»Pfiat di, Lisa«, grummelte Fanny und widmete sich dem Wiederaufbau ihrer Konservendosen.
*
Inzwischen hatten Sebastian Seefeld und die junge Frau den Ebereschenhof erreicht. Er lag außerhalb des Ortes auf einem sanften Hügel und bot einen herrlichen Ausblick auf die Sternwolkenseen. Seinen Namen hatte der Hof von zwei mächtigen Ebereschen, die sich rechts und links des Wohnhauses in den Himmel reckten. Im Herbst, wenn die roten Beeren reiften, musste es ein beindruckendes Bild sein. Der Hof selbst war ein kleineres Anwesen, nicht modern, aber gut in Schuss gehalten. Nur vereinzelt zeigten sich Spuren davon, dass hier in den letzten Jahren Menschen gelebt hatten, die nicht mehr zu anstrengender körperlicher Arbeit in der Lage gewesen waren.
Sebastian hatte auf der kurzen Autofahrt geschwiegen, um der jungen Frau Gelegenheit zu geben, etwas zur Ruhe zu kommen. Als er den Korb mit den Lebensmitteln auf die alte Hausbank gestellt hatte, meinte er entschuldigend: »Ich glaube, inmitten des Durcheinanders habe ich mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Sebastian Seefeld.«
»Und Sie sind Arzt. Dann müssen Sie der Sohn vom alten Doktor sein«, antwortete Marie. »Ich habe schon gehört, dass er seine Praxis abgegeben hat. Es freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Ganz meinerseits«, lächelte Sebastian, »obwohl mir eine weniger schmerzhafte Art besser gefallen hätte. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als ob ich so für neue Patienten sorgen wolle!«
»Kein Problem, das denke ich nicht von Ihnen«, entgegnete Marie. »Und nun vergessen Sie’s endlich, es sind nur ein paar blaue Flecken.«
»Nun gut, dann bin ich fürs erste beruhigt. Aber wenn noch irgendetwas sein sollte, dann melden Sie sich sofort, versprochen, Frau Legrand?«
Marie nickte zerstreut. Sie nestelte ein Schlüsselbund aus ihrer Tasche und öffnete umständlich die Haustür, die alt und verzogen war.
»Gut, wenn ich im Augenblick nichts mehr für Sie tun kann, dann fahre ich jetzt zurück. Auf Wiedersehen, Frau Legrand.«
»Auf Wiedersehen!«, grüßte Marie zurück. Sie wich dem Blick des Doktors aus und fuhr stattdessen gedankenverloren mit der Hand über die verzogene Haustür. Plötzlich hob sie den Kopf und rief zum Auto hinüber. »Vielleicht können Sie doch noch etwas für mich tun? Sie kennen doch hier jedermann, ich bin gestern erst nach über zehnjähriger Abwesenheit nach Hause gekommen. Ich suche einen guten Zimmermann, hier gibt es allerhand Holzarbeiten zu verrichten. Können Sie mir jemanden empfehlen?«
»Das kann ich«, antwortete Sebastian prompt und ging zum Haus zurück. Aus der Brieftasche holte er seine Visitenkarte und notierte auf der Rückseite einen Namen und eine Telefonnummer. »Benjamin Lauterbach«, sagte er. »Bei uns drüben im Doktorhaus hat er einige Umbauten vorgenommen, als meine Tochter und ich zum Vater gezogen sind. Dieser Lauterbach arbeitet gut und zuverlässig, ich kann ihn wirklich wärmstens empfehlen.«
»So, Benjamin Lauterbach«, wiederholte Marie. »Einen fähigen Handwerker kann ich hier wirklich gut gebrauchen.« Zum ersten Mal schien etwas von ihrer Anspannung abzufallen.
»Den bekommen Sie in ihm!«, versicherte Sebastian. »Also dann, bis demnächst unter anderen Umständen.«
»Danke«, sagte Marie, »sowohl fürs Heimbringen als auch für den Tipp mit dem Zimmermann.« Sie winkte leicht mit der Visitenkarte. Dann holte sie tief Luft und fügte hinzu: »Und übrigens, ich heiße nicht mehr Legrand. Ich trage wieder meinen Mädchennamen, Marie Höfer.«
Sebastian wirkte weder besonders erstaunt noch besonders interessiert wegen dieser Information. Er winkte kurz zum Abschied und fuhr vom Hof.
Marie Höfer, geschiedene Legrand, setzte sich auf die ausgetretene Türschwelle und schaute hinüber in den Ort. Dir mag es ja egal sein, wie mein Name lautet und was das bedeutet, dachte sie. Aber ich kenne einige Leute hier, für die diese Nachricht der reinste Leckerbissen sein wird. Mir werden die Ohren klingen von all dem Gerede! Das wird kein leichter Neubeginn. Wie gut, dass es ein paar Menschen gibt, auf die ich zählen kann. Da sind zum Beispiel die Leute aus dem Doktorhaus, die Fanny kenne ich auch noch von früher und natürlich meine stürmische Lisa. Sie ist zwar manchmal ziemlich laut und vielleicht auch etwas aufdringlich, aber das macht nichts, es ist halt ihre Art. Ich freue mich, dass ich hier noch eine alte Freundin habe!
Von diesem Gedanken getröstet, sammelte Marie ihre Sachen zusammen und betrat ihr stummes Elternhaus.
*
»Grüß Gott!«
Im Friseursalon Glamour drehten sich ausnahmslos alle Köpfe um, als diese Worte von einer unglaublich tiefen und volltönenden männlichen Stimme ausgesprochen wurden. Begonnen bei der alten Frau Ederer mit ihrem schlohweißen Haar bis hin zu Jeanette, der neuen Auszubildenden, erschien strahlendes Lächeln auf allen Gesichtern. Der Mann, der diese gebündelte weibliche Aufmerksamkeit auf sich zog, war in der Tat eine Augenweide!
An die zwei Meter groß, breitschultrig, mit einem kräftigen Körperbau und dennoch schlank. Man sah diesem Mann an, dass er harte, körperliche Arbeit gewohnt war, und dennoch wirkte er nicht schwerfällig. Seine Art, sich zu bewegen, erinnerte an die kraftvolle Anmut eines schreitenden Löwen. Seine Haarpracht war dicht und üppig und leuchtete in einem satten Dunkelblond, durchzogen von einigen braunen Strähnen. Ein gepflegter Bart bedeckte Wangen und Kinn. Seine Augen unter den dichten Brauen leuchteten in einem intensiven Blau-Grün, das an klare Bergseen denken ließ. Bekleidet war er mit derben Arbeitsschuhen, perfekt sitzenden Jeans und einem weißen T-Shirt. Er brachte den Geruch von frischem Holz, unterlegt von einer herben, fruchtigen Note, mit sich.
»Sag, Lisa, wo soll ich deine Bank denn aufstellen?«, fragte er.
»Grüß dich, Ben!«, schnurrte Lisa und schlängelte sich katzengleich zwischen der Säule mit den Waschbecken und einem Wagen mit Friseurbedarf hindurch. Ihre himmelblauen Augen hatte sie noch weiter aufgerissen als sonst, und ihre Lippen formten mehr denn je einen atemlosen Kussmund.
»Wie schön, dich zu sehen!« Sie reckte sich auf die Zehenspitzen, legte ihre manikürten Hände auf die breiten Schultern des Mannes und hauchte gefühlvolle Küsschen auf seine Wangen.
Gutmütig ließ der Mann die Begrüßung über sich ergehen, ohne sie seinerseits mit Küsschen zu erwidern. Er trat einen Schritt zurück, bedachte die junge Frau mit einem freundlichen Nicken und wiederholte seine Frage.
»Komm mit, ich zeig’s dir«, flötete Lisa. Mit sorgsam eingesetztem Hüftschwung ging sie vor dem Mann hinaus auf die Straße und wies auf den Platz direkt unter ihrem Schaufenster. »Genau hier, bitte! Zwischen die beiden Blumenschalen.«
Der Mann nickte und öffnete die Ladefläche seines Transporters. Von dort zog er eine Holzbank herab, die er auf den von Lisa bestimmten Platz stellte. Es handelte sich um eine zierliche Holzbank mit geschwungener Lehne, glatt und seidig, eine gelungene Zimmermannsarbeit. Und sie war leuchtend Pink lackiert.
Ergriffen schaute Lisa das neue Prunkstück vor ihrem Salon an. »Wahnsinn! Sieht es nicht einfach toll aus, Ben?«
»Ja, und dann dieses farbliche Zusammenspiel mit den roten Geranien rechts und links …«, antwortete er trocken. Es hatte ihn unglaubliche Überwindung gekostet, die Bank in diesem fürchterlichen Farbton zu streichen ,und er war kurz davor gewesen, Lisa den Auftrag zurückzugeben.
Aber der junge Zimmermann Benjamin Lauterbach war gerade dabei, sich eine eigene Firma aufzubauen, und konnte es sich nicht leisten, persönlichen Geschmack und Schönheitssinn über den der Kundschaft zu stellen. Nur als Lisa auch noch vorgeschlagen hatte, mit Glitzerschrift ›Glamour‹ auf die Rückenlehne zu schreiben, hatte Ben es mit dem Hinweis abgelehnt, dass das nun wirklich keine Tischlerarbeit mehr sei.
»Ben, das hast du so toll gemacht! Genau so hab ich mir die Bank vorgestellt, ich bin begeistert!« Lisa klatschte entzückt in die Hände und machte Anstalten, den Mann mit weiteren Küsschen zu bedenken.
»Schön, dass dir meine Arbeit so gut gefällt«, antwortete er ruhig. Aus sicherer Entfernung überreichte er der jungen Frau einen Briefumschlag. »Hier ist die Rechnung.«
»Dank dir, ich kümmere mich gleich drum«, sagte Lisa. Sie genoss das Zusammensein mit diesem attraktiven Mann und hätte es gern ein wenig ausgedehnt. Es war eine willkommene Abwechslung zum Flechten der weißen Haare der alten Ederin und der schlichten Maniküre bei Doktors Traudel. Außerdem wusste Lisa sehr genau, dass sie durch das Schaufenster beobachtet wurde! Sie war es sich und ihren weiblichen Reizen geradezu schuldig, jetzt ein wenig Charme zu versprühen. Betont sexy lehnte sie sich auf der Bank zurück, schüttelte ihre blonde Mähne und produzierte einen tiefen Augenaufschlag. »Ben, sag‘, magst du dich nicht ein bisschen zu mir setzen? Du kannst mich doch die Bank nicht ganz allein einweihen lassen, wo sie doch sozusagen ein Teil von dir und ein Teil von mir ist. Komm, setzt dich her zu mir, und wir trinken einen Kaffee zusammen. Ich brauch der Jeanette nur zu winken, und wir haben unseren Cappuccino.«
Ben winkte nicht unfreundlich ab. »Nein, danke. Ich habe keine Zeit. Ich muss noch drüben beim Doktor eine Schranktür nachziehen und dann zum Ebereschenhof.«
Zum Ebereschenhof, so, so …
»Dann vielleicht ein anderes Mal, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben«, schnurrte Lisa. Sie winkte dem abfahrenden Mann hinterher und ging zurück in ihren Salon. Während sie dort mit halbem Ohr den üblichen Gesprächen folgte, hing sie ihren eigenen Gedanken nach.
Man brauchte auf dem Ebereschenhof also einen Zimmermann. Ging es nur um eine kleine Reparatur, um den Hof besser verkaufen zu können? Miriam Holzer hatte da neulich beim Madelstammtisch eine Andeutung fallen lassen, dass der Gemeinderat eventuell Interesse haben könnte. Und warum auch nicht? Was sollte Marie denn mit dem Hof anfangen? Sie wohnte seit Jahren in Frankreich, und ihr windiger Ehemann hatte nie hier leben wollen.
Es war wirklich an der Zeit, der lieben, gutgläubigen Marie einen Besuch abzustatten und zu erfahren, welche Pläne sie hatte. Vielleicht würde dort auch dieser überaus attraktive Zimmermann anzutreffen sein? Man könnte ein wenig plaudern, vielleicht gemeinsam nach Bergmoosbach hinein fahren und ein Weißbier trinken, während die gute Marie ihre Sachen packte und nach Frankreich abreiste.
*
Als Ben den Ebereschenhof betrat, empfing ihn tiefe Stille. Schweigend lag der Hof im Sonnenlicht, das sich in den geschlossenen Fensterscheiben widerspiegelte. Kein Hund meldete seine Ankunft mit wachsamen Bellen, keine Katze strich neugierig um die Hausecke. In den Blumenkübeln neben den Eingangsstufen fehlte die Blütenpracht. Der Hofplatz war sauber gefegt, und es gab keine Spuren großen Verfalls, aber trotzt seiner schlichten Schönheit herrschte auf dem Anwesen eine seltsam trostlose und bedrückende Atmosphäre. Das einzig Lebendige schienen die beiden großen Ebereschen zu sein, deren grüne Blätter im Sommerwind raschelten.
Der Mann musste mehrmals kräftig gegen die alte Haustür klopfen, ehe im oberen Stockwerk ein Fenster geöffnet wurde und eine Frauenstimme rief: »Entschuldigung, ich habe Sie nicht gehört! Bin sofort unten.«
Gleich darauf wurde die Tür geöffnet, und Ben stand einer Frau gegenüber, die offensichtlich mit Aufräumarbeiten beschäftigt war. Sie trug alte, abgeschnittene Jeans, abgetragene Segeltuchschuhe und ein formloses T-Shirt in einem ausgewaschenen Grün. Hände und Beine der jungen Frau wirkten wie mit Staub gepudert, und feine Schmutzstreifen zogen sich über ihre Wangen. Sollten das getrocknete Tränenspuren sein? Aber ihr Gesichtsausdruck war ruhig und gefasst und ihr verhaltenes Lächeln freundlich. Seidige Wimpern umrahmten dunkelbraunen Augen unter fein geschwungenen Brauen. Ihr lockiges Haar war von einem samtigen Schokoladenbraun und mit einem türkisfarbenen Tuch aus der Stirn gebunden. Sie ging dem hünenhaften Benjamin noch nicht einmal bis zur Schulter. Ihre zarte Gestalt und die Verlorenheit, die sie ausstrahlte, weckten Bens Beschützerinstinkte auf den ersten Blick.
»Grüß Gott«, sagte die junge Frau, »entschuldigen Sie, dass ich Sie vor der Tür stehen ließ. Ich war oben auf dem Dachboden und habe Ihr Klopfen zu spät bemerkt.« Nach einem Blick auf die Aufschrift des Transporters im Hof fuhr sie fort: »Ich nehme an, Sie kommen von der Zimmerei Lauterbach?«
Ben lachte leise. »Ich bin die Zimmerei Lauterbach«, antwortete er verschmitzt. Dann hob er die Hand zum Kopf der jungen Frau. »Darf ich?« fragte er leise und entfernte ein graues Gebilde aus Staub und Spinnweben, das sich in den dunklen Locken verfangen hatte und seitlich am Hals herabhing. »Du hast einen schöneren Ohrring verdient, Aschenputtel«, sagte er neckend.
»Was? Oh, …« Die junge Frau trat hastig einen Schritt zurück. »Ich krieche gerade auf dem Dachboden herum und sehe wohl ziemlich unmöglich aus.« Sie verschränkte ihre schmutzigen Hände auf dem Rücken und schaute starr geradeaus.
Ben bemerkte ihre Verlegenheit und Abwehrhaltung und bemühte sich, seinen Fehler wieder gutzumachen. »Das passt schon!«, sagte er munter. »Wer richtig arbeitet, muss auch richtig angezogen sein.« Er deutete auf seine eigene Bekleidung und die Sägespäne, die darüber verteilt waren. »Wie Sie sehen, passen wir sehr gut zusammen.«
Bei diesen Worten entspannte sich die junge Frau ein wenig. »Das hoffe ich, denn ohne Übereinstimmung wird das Arbeiten hier schwierig.« Sie streckte ihm eine schmale Hand zu einem überraschend festen Händedruck entgegen. »Ich bin Marie Höfer, und es geht um den Umbau des Ebereschenhofs.«
»Benjamin Lauterbach«, stellte er sich vor. »Dann lassen Sie uns die Gebäude doch einmal zusammen anschauen.«
Marie führte den Zimmermann zunächst in die große Küche des Hofes. Sie war alt und im Laufe der Jahre an manchen Stellen modernisiert worden, hatte aber nichts von ihrer Ursprünglichkeit verloren. Den Fußboden bildeten alte Steinfliesen, und die niedrige Balkendecke war dunkel vom Rauch. Inzwischen gab es längst einen modernen E-Herd und Kühlschrank, aber geheizt wurde immer noch mit einem mächtigen, alten Holzofen, und das Wasser floss nicht in eine Edelstahlspüle, sondern in ein steinernes Becken. Es gab auch keine Einbaumöbel mit spiegelnder Oberfläche, sondern alte Schränke und Borde aus Holz, das die Zeit dunkel und seidig poliert hatte. Den Mittelpunkt bildete ein alter Eichentisch, der unter den Fenstern stand.
»Bitte setzen Sie sich«, forderte Marie den Zimmermann auf. »Kann ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten?«
Ben nahm das freundliche Angebot dankend an, und kurze Zeit später saßen er und die junge Frau vor Bechern mit aromatisch duftenden Inhalt und einer dicken Mappe mit Unterlagen am Tisch.
Marie holte tief Atem und sagte: »Der Tod meiner Eltern hat in jeder Hinsicht zu großen Veränderungen geführt. Ich werde den Hof nicht weiter wie bisher bewirtschaften, sondern in eine Pension umbauen. Ich biete Übernachtungsmöglichkeit mit Frühstück an. Dafür sind größere Umbaumaßnahmen nötig, denn ich möchte den Gästebereich vom Privaten trennen. Für mich selbst möchte ich hier im Erdgeschoss eine kleine Wohneinheit einrichten, während das obere Stockwerk den Gästen gehört. Außerdem brauche ich einen Anbau für das Frühstückszimmer. Ich dachte an einen schönen Wintergarten aus Holz und Glas in süd-östliche Richtung, damit meine Gäste die Morgensonne genießen können. Ich habe einige Entwürfe gezeichnet …«, hier stockte sie und wurde ein bisschen rot. »Natürlich sind das laienhafte Zeichnungen, die nicht für Ihre Baupläne taugen. Aber vielleicht bekommen Sie so einen kleinen Einblick in das, was ich mir vorstelle.«
Aufmerksam begutachtete Ben die großen Papierbögen, welche Marie ihm reichte. Schnell erkannte er, was diese Auftraggeberin von ihm erwartete, und nickte zufrieden. Als er die letzte Seite umgeblättert hatte, schaute er die junge Frau mit einem leisen Lächeln an. »Das, was Sie vorhaben, ist schön«, sagte er schlicht.
In Maries dunklen Augen erwachte ein vorsichtiges Leuchten. »Sie verstehen, was ich meine?«
Der Zimmermann nickte. »Ja! Sie lieben dieses Haus und wollen seine Seele erhalten. Der Wintergarten, zum Beispiel, könnte ein kaltes Ding aus Metall und Beton sein, das überhaupt nicht zu dem alten Hof und in die Landschaft passt. Sie werden hier etwas verändern, aber Sie tun es behutsam und so, dass es sich richtig für Sie anfühlen wird.«
Marie wandte den Kopf ab und tat so, als gäbe es draußen vor dem Fenster etwas ungeheuer Interessantes zu sehen. Das war nur ein Vorwand, denn sie wollte nicht, dass der Mann die Tränen sah, die in ihren Augen glitzerten. Seine Worte hatten sie mitten ins Herz getroffen. Noch nie hatte ein Mann sie so verstanden. Es waren doch nur Striche auf dem Papier, und er hatte darin ihre Seele erkannt.
Sie blinzelte die Tränen weg, räusperte sich und sagte: »Es freut mich, dass Sie es ebenso sehen. Der Umbau eines alten Hauses ist nicht einfach und oft kommen wahre Scheußlichkeiten dabei heraus. Sie sind der Fachmann, und ich bin auf Ihre Ratschläge angewiesen. Wenn wir in ein und dieselbe Richtung denken, werden wir sicherlich gut zusammenarbeiten.«
Das waren nüchterne und sachliche Worte, und sie passten zu einem Arbeitsgespräch. Warum fühlte es sich dann gleichzeitig so an, als sei Maries Herz kein harter Klumpen mehr, sondern etwas Weiches, Warmes, das ihre Brust mit Leichtigkeit erfüllte? Das ein Gefühl von Hoffnung und leise aufkeimender Freude hervorrufen konnte?
Ben blätterte noch einmal durch die Zeichnungen, schaute sich prüfend in der Küche um und warf Marie einen fragenden Blick zu. In seinen klaren blau-grünen Augen funkelte ein Ausdruck, der sich in seinem verschmitzten Lächeln fortsetzte. »Für die Küche haben Sie keine Pläne gezeichnet?«, fragte er.
»Nein, die bleibt, wie sie ist!«, antwortete Marie nachdrücklich. »Sie ist das Zentrum meines Hauses und wird nicht verändert.«
Ben lachte leise. »Genau das habe ich erwartet«, sagte er.
»Ich muss einiges umorganisieren, weil ich wegen der Gäste mehr Geschirr benutze, und ich brauche auch einen größeren Kühlschrank, aber das war’s dann auch«, erklärte Marie.
Ben schaute sie interessiert an. Wie sehr sie sich im Laufe des Gesprächs verändert hat, dachte er. Die Traurigkeit, die ich zuerst gespürt habe, ist in den Hintergrund getreten. Jetzt ahnt man viel mehr von der Lebensfreude und Energie, die in diesem Persönchen stecken.
»Darf ich Sie etwas Persönliches fragen?«, wagte er sich vor. »Ich habe gehört, dass Sie erst vor kurzer Zeit nach Bergmoosbach zurückgekehrt sind. Eigentlich leben Sie in Frankreich? Diese Pläne, die Sie mir gezeigt haben, sind sehr ausgereift. Haben Sie sich schon länger damit beschäftigt? Und bleiben Sie jetzt gleich hier oder kehren Sie erst wieder nach Frankreich zurück?«
Über Maries Gesicht huschte ein schmerzerfüllter Schatten, und ihre Augen wurden dunkel. »Meine Eltern und ich hatten schon vor längerem von der Zukunft des Ebereschenhofs gesprochen und beschlossen, ihn eines Tages in eine Pension umzuwandeln. Sie wollten hier aufs Altenteil gehen, und ich würde den Betrieb bewirtschaften. Dass es dann so schnell ging, erst mit Mutters Tod und dann dem des Vaters, damit hatten wir nicht gerechnet.« Maries Stimme, die eben noch voller Lebensfreude geklungen hatte, war jetzt sehr leise und füllte sich bei den nächsten Worten mit Bitterkeit. »Und ich war in Frankreich gebunden und musste warten, bis … ich bestimmte Dinge erledigt hatte.«
Ben spürte den Schmerz hinter diesen Worten und hätte gern tröstend nach Maries Hand gegriffen, aber er wusste auch, dass man mit fremden Schmerz sehr behutsam umgehen muss. So blieb es bei seinem Blick, klar und anteilnehmend, der Marie über diese Hürde hinweghalf.
»Aber das liegt nun hinter mir, und ich kann hier in meinem Heimatort neu beginnen«, sagte sie ruhig. »Ein erster Schritt in die Zukunft sind die Gespräche mit Ihnen und Ihr Kostenvoranschlag.«
Ben überlegte. »Die Begehung der Gebäude und das genaue Aufmaß werden mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ich für heute eingerechnet habe. Ist es Ihnen recht, wenn ich morgen früh wiederkomme und wir den ganzen Vormittag für die Einzelheiten einplanen?«
»Sehr gern!« Marie wusste es nicht, aber ihr Gesicht leuchtete bei diesen Worten.
»Gut, dann bin ich also morgen in der Früh wieder hier; sagen wir, um acht Uhr?«, fragte Ben.
»Ich freu‘ mich drauf und …«, Maries Antwort wurde von einem Paar unterbrochen, das durch die Hintertür in die Küche trat und freundlich grüßte. Die beiden Besucher waren der junge Doktor Seefeld und Hebamme Anna Bergmann.
»Wir kommen von unserer Runde mit den Hausbesuchen, und ich dachte, auf dem Heimweg möchte ich auch nach meiner Patientin auf dem Ebereschenhof schauen«, erklärte Doktor Seefeld.
Ben horchte auf. Patientin? War Marie denn krank?
Die junge Frau seufzte leicht. »Hatten wir uns nicht gestern darauf geeinigt, dass ich nicht Ihre Patientin bin, Herr Doktor? Es geht mir gut, und außer ein paar blauen Flecken erinnert nichts an meinen Sturz.«
»Sie sind gestürzt?«, erkundigte sich Ben besorgt. »Wie kam es denn dazu?«
Marie wurde rot. »Doktor Seefeld hat mich übersehen, ich bin mit einem Stapel Konservendosen zu Boden gegangen, dabei hat es ein paar blaue Flecken gegeben und Ende der Geschichte. Reden wir bitte von etwas anderem! Möchte noch jemand einen Kaffee haben?« Sie schaute auffordernd in die Runde.
Die Hebamme und der Arzt wechselten einen fragenden Blick. Doch, für eine kleine Pause vor den nächsten Terminen reichte die Zeit. »Danke, einen Kaffee nehmen wir gern an«, antwortete Sebastian Seefeld, und Anna nickte mit einem freudigen Lächeln.
Im Handumdrehen stellte Marie zwei weitere Becher auf den Tisch und zauberte einen herrlichen Allgäuer Apfelkuchen hervor, den sie gegen das Gefühl der Einsamkeit im stillen Elternhaus gebacken hatte. Er schmeckte genauso herrlich, wie er duftete und aussah. Die Einsamkeit löste sich in Nichts auf, als Marie in der alten Küche saß, die endlich wieder von lebhaften Gesprächen und Gelächter erfüllt war. »Klopf, klopf!«, mischte sich plötzlich eine weibliche Stimme in das Gelächter der gut gelaunten Runde. »Na, ich muss schon sagen, ihr habt’s aber gut hier!« Mit diesen Worten betrat Lisa die Küche. Flink liefen ihre Augen über die Anwesenden und kehrten dann wieder zu dem gut aussehenden Zimmermann zurück. »Schön, dich zu sehen, Ben!«, strahlte sie und beugte sich über den Sitzenden. Küsschen wurden auf die bärtigen Wangen verteilt und erst danach begrüßte Lisa den Arzt, die Hebamme und mit einer etwas übertriebenen Umarmung ihre alte Freundin. »Das schaut ja so gemütlich aus bei euch!«, flötete sie.
»Komm, setz dich zu uns, Lisa. Ich freu mich, dass du da bist! Jetzt haben wir endlich Zeit für einander«, antwortete Marie freundlich.
»Ich freu mich auch!« Mit einem strahlenden Lächeln nahm Lisa den Stuhl an Bens anderer Seite in Besitz und legte zutraulich ihre Hand auf seinen Arm. Begleitet von einem schmachtenden Augenaufschlag fragte sie: »Und du, mein lieber Ben, was hat dich denn hier hergeführt? Müssen noch ein paar Reparaturen gemacht werden?«
Wie unbeabsichtigt zog Ben seinen Arm zur Seite, ihm war Lisas übertrieben vertrauliche Art unangenehm.
»Was meinst du damit, dass noch ein paar Reparaturen gemacht werden müssen?«, erkundigte sich Marie, während sie Becher und Kuchenteller vor ihre Freundin stellte.
Lisa bediente sich ausgiebig mit Apfelkuchen und Sahne und antwortete dann: »Na ja, ich dachte, vielleicht ist noch dieses oder jenes zu richten vor dem Verkauf.«
Überrascht schaute Marie ihre Freundin an. »Verkauf?«, fragte sie. »Von welchem Verkauf sprichst du denn?«
»Vom Ebereschenhof natürlich«, antwortete Lisa mit vollem Mund. Es hatte etwas undeutlich geklungen, trotzdem waren ihre Worte von allen gut verstanden worden.
Erstaunte Blicke wurden getauscht, und Maries Kuchengabel klirrte auf ihren Teller. »Was …, wieso …, wer sollte denn den Ebereschenhof verkaufen wollen?«, stotterte sie.
»Du natürlich«, entgegnete Lisa kauend.
Marie schüttelte verständnislos den Kopf. »Warum sollte ich das denn tun? Wie kommst du nur darauf?«
Alle schauten Lisa erwartungsvoll an. Die junge Frau schien nichts von der Spannung zu bemerken, die in der Luft lag. »Na, das ist doch ganz einfach«, erklärte sie und nahm das nächste Stück Kuchen in Angriff. »Was willst du mit dem Hof denn anfangen? Ihn allein bewirtschaften? Das lohnt sich doch vorn und hinten nicht in der heutigen Zeit; außerdem lebst du in Frankreich. Das einzig Vernünftige ist, den Hof zu verkaufen. Er wird schon ein gutes Stück Geld einbringen, mit dem du fein leben kannst, das sagt auch die Miriam Holzer.«
»So, sagt das die Miriam Holzer!«, warf Doktor Seefeld trocken ein. Er kannte die Leute im Ort und wusste, wie viel geredet, gemutmaßt und getuschelt wurde. Welche Spekulationen und Gerüchte bezüglich des Hofes mochten schon im Umlauf sein? Er tauschte einen halb amüsierten, halb resignierten Blick mit Anna, der mit einem verständnisinnigen Augenzwinkern beantwortet wurde.
Marie war blass geworden. »Und was hat Miriam Holzer damit zu tun?«, fragte sie.
»Na, ihr Papa sitzt doch im Gemeinderat, und es kommen viele Touristen nach Bergmoosbach, und eigentlich könnten wir hier noch ein Hotel brauchen und das könnte die Gemeinde aus dem alten Hof machen. So richtig supermodern, mit Wellness und allem, und wo du doch sowieso nach Frankreich zurückgehst …«, plauderte Lisa munter drauflos.
Nachdenklich musterte Marie ihre alte Schulfreundin. »Ist schon interessant, welche Gedanken man sich hier um meine Zukunft macht«, sagte sie trocken. »Ich bin gerührt!«
»Echt jetzt?« Himmelblaue Babyaugen richteten sich auf die junge Frau und versuchten, ihren Gesichtsausdruck zu ergründen. So richtig gerührt sah Marie eigentlich nicht aus, eher … verärgert? »Äh, ja, das ist doch nett, dass wir hier so mitdenken, gell? Weil, du hast ja sonst niemanden mehr«, stotterte Lisa. »Außer Fabian natürlich!«, fügte sie schnell hinzu.
Ben bemerkte, dass Marie unter dem Tisch ihre Hände zu Fäusten ballte. In einer unbewussten Geste legte er seinen Arm auf die Rückenlehne von Maries Stuhl, es war so etwas wie eine zusätzliche kleine Stütze.
»Ich glaube, ich muss einiges klarstellen«, begann Marie. Sie richtete ihren Blick fest auf alle Anwesenden. »Fabian Legrand und ich sind geschieden, seit einer ganzen Weile schon. Ab jetzt ist mein Name wieder Marie Höfer.«
»Waaas? Wieso denn das?«, quietschte Lisa überrascht. Das waren ja höchst interessante Neuigkeiten, mit denen sie nachher im Ort aufwarten konnte!
Marie überging den spitzen Aufschrei. »Mehr gibt es dazu nicht zu sagen! Und was das Gerücht um meinen Hof betrifft: das ist völlig aus der Luft gegriffen! Der Ebereschenhof wird nicht verkauft! Ich bleibe für immer hier und bewirtschafte ihn selbst und zwar als Frühstückspension für Feriengäste.«
»Oh!«, entfuhr es Lisa. Das würde Miriam, ihrem Vater und vor allem dem Gemeinderat aber gar nicht passen! Man hatte sich schon auf einen einträglichen Handel gefreut, und Miriam sah sich (neben der Bürotätigkeit in Papas Sägewerk) bereits als fesche Geschäftsführerin von Bergmoosbachs mondänsten Hotel. »Du willst also nicht verkaufen? Und machst hier eine eigene Pension auf? Das sind ja mal Neuigkeiten, Marie« Lisa hob ihren Kaffeebecher wie ein Glas und prostete damit ihrer alten Schulfreundin zu. »Auf dich und deine Pläne, Marie, viel Glück!«
»Auch von uns, Frau Höfer!«, sagte Anna herzlich. Sie und der Doktor erhoben ebenfalls ihre Kaffeebecher zu einem fröhlichen Salut.
»Dann haben Sie also sehr viel vor«, fügte Sebastian Seefeld hinzu. »Wenn wir Ihnen mit Rat oder Tat zur Seite stehen können, melden Sie sich. Herr Lauterbach hat vor kurzem im Doktorhaus Umbauten vorgenommen, die Sie sich gern anschauen können. Vielleicht ergibt sich die eine oder andere Anregung für Sie.«
»Danke, darauf komme ich gern zurück«, freute sich Marie. »Ich glaube, es wird eine harte, aber aufregende und wundervolle Zeit!«
»Das ist es immer, wenn man aus etwas Altem etwas Neues macht«, sagte Ben bedächtig. Das leise Lächeln, das seine Mundwinkel umspielte, war warmherzig und voller Vorfreude. »Es kommt halt immer darauf an, wie man es angeht.«
Sein Blick suchte und fand den von Marie: Wir wissen, was wir damit meinen!, sagte dieser stumme Austausch.
»Ach, ja, da ist sicherlich ganz viel zu tun!«, stimmte Lisa eifrig ein. Ihre Augen glitten abschätzig durch den Raum. »Dann willst du bestimmt auch eine neue Küche haben? Das musst du doch sogar, wenn du hier Gäste bewirten willst. Ich hab da neulich im Katalog eine ganz tolle gesehen, alles Schwarz und Edelstahl, einfach supertoll, sage ich dir! Und dann eine Esstheke mit roten Barhockern, direkt hier unter den Fenstern. Die lässt du doch bestimmt vergrößern, so richtig tolle Panoramafenster müssen her, und die grausligen Steinplatten fliegen raus, und die altmodische Balkendecke auch!« Mit wenigen, atemlosen Sätzen verwandelte Lisa die charaktervolle alte Küche in Dutzendware aus dem Katalog.
Marie und Ben wechselten einen beredten Blick, Anna verkniff sich das Lachen, und Doktor Seefeld räusperte sich vernehmlich.
»Meinst du nicht, wir sollten die Marie fragen, was sie dazu zu sagen hat?«, wandte Ben sich belustigt an Lisa.
»Was soll sie dazu schon sagen?«, fragte die junge Frau erstaunt. »Genauso eine Küche hat man halt, wenn man in ist. Ich hab auch so eine.«
»Aha!«, machte Ben.
»Das mag schon sein, Lisa, aber ich habe nun einmal einen anderen Geschmack«, antworte Marie freundlich, aber bestimmt. »Meine Küche bleibt genauso, wie sie ist.«
Das konnte Lisa nun überhaupt nicht begreifen, und sie hätte sich noch weiter mit dem Thema beschäftigt, wenn nicht der Landdoktor in Aufbruchstimmung gewesen wäre. Er und die Hebamme verabschiedeten sich, und auch Ben musste, zu seinem stillen Bedauern, weiterfahren, weil der nächste Termin wartete. Die beiden jungen Frauen begleiteten die Besucher hinaus in den Hof und verabschiedeten sie bei ihren Autos.
»Dann bis morgen früh!«, sagte Ben mit einem herzhaften Händedruck. Wie klein und zart sich Maries Hand in seiner anfühlte und gleichzeitig wie warm und zuverlässig! Nur zögernd beendete er diesen kurzen, intensiven Kontakt.
»Bis morgen!«, antwortete Marie, und ihre dunklen Augen lächelten.
Lisa schüttelte ihre blondierte Haarpracht über die Schulter zurück. »So, und nun will ich alles über dich und Fabian hören! Das gibt’s ja nicht, dass ihr geschieden seid! Ihr wart doch das perfekte Paar?« Sie legte angemessene Bestürzung in ihren Blick. »Was ist denn da nur passiert?«
Wie selbstverständlich hatte sie den Arm um Marie gelegt und führte die junge Frau in die Küche zurück. Sie setzte sich auf die Bank unter den Fenstern und klopfte einladend mit der Hand auf den Platz neben sich. »Komm, setzt dich zu mir. Du siehst ganz mitgenommen aus. War es denn so schlimm?«
»Schlimmer«, antwortete Marie leise. Sie hatte den Kopf gesenkt und starrte auf ihre Hände, die gedankenverloren an ihrem T-Shirt herum zupften. »Du hast ja keine Ahnung.«
Und ob ich die habe!, dachte Lisa. Du hast keinen blassen Schimmer, mein dummes, naives Mariechen! Und wenn ich es dir erzählte, dann würdest du es nicht glauben wollen. Dein geliebter Fabian und ich waren das heißeste Paar, das du dir nur vorstellen kannst, Herzchen! Und während du dein Hochzeitskleid ausgesucht und vom Kranzbinden geredet hast, waren dein Kerl und ich im Bett, im Heu, haben es nachts im Sternwolkensee miteinander getrieben und noch an ein paar anderen Orten, die dir kleinem Frauchen nicht mal im Traum einfallen würden!
Bei diesem Gedanken hätte Lisa fast laut aufgelacht, aber gerade noch rechtzeitig fiel ihr ein, dass sie keinen Grund hatte, sich überlegen zu fühlen. Sicher, sie und Fabian hatten ihr schmutziges Spiel getrieben, und für Lisa war einiges dabei herausgesprungen aber in allen Ehren geheiratet hatte der reiche Windhund die Marie. In weißer Seide und Spitze, mit einem rauschenden Fest und anschließenden Luxusflitterwochen in der Karibik. Während sie, Lisa, als Friseurin in Bergmoosbach blieb.
Aber dafür besaß sie jetzt ihren eigenen Salon, und Marie stand vor den Trümmern ihrer Ehe, von einer gesicherten beruflichen Existenz ganz zu schweigen. Dieser Umbau zur Pension musste doch ein Vermögen kosten, auf Marie würden drückende Kreditraten zukommen. Und sie war so gar nicht der Typ starke Geschäftsfrau! Maries Lebensglück hatte immer in einer Familie mit Mann und Kindern bestanden. Dieses Ziel war jetzt in äußerst weite Ferne gerückt, und das Führen einer Pension konnte wohl kaum als Ersatz herhalten. Alles in allem betrachtet, sah die Zukunft der jungen Frau nicht gerade rosig aus.
Betont fürsorglich legte Lisa den Arm um die Schultern ihrer alten Freundin. »Was war denn los«, fragte sie leise. »Magst du es erzählen? Gab es vielleicht – andere Frauen?«
»Ja«, nickte Marie. »Sogar zwei Kinder. Und da waren auch geschäftliche Dinge …« Sie verstummte. Dann lehnte sie ihren Kopf an Lisas Schulter, arglos und Beistand suchend. »Weißt du, ich mag jetzt nicht drüber reden, nicht hier.« Mit einer müden Handbewegung deutete sie auf die alte Küche, in der sie alle vor kurzem noch so gemütlich zusammen gesessen hatten. »Ich will nicht, dass das alles durchs Erzählen wieder lebendig wird und mein Zuhause beschmutzt. Ich habe gerade das Gefühl, hier zur Ruhe zu kommen und mir eine Zukunft aufbauen zu können. Die Erinnerungen an Fabian haben hier nichts zu suchen! Jetzt sichte ich die Hinterlassenschaft der Eltern, das ist schon schwer genug. Lass uns einfach hier sitzen, und du erzählst mir ein bisschen davon, wie es in der letzten Zeit in der Heimat war. Die beiden letzten Male, als ich hier war, musste ich mich um die Beerdigungen der Eltern kümmern, und vor lauter Trauer hatte ich für nichts anderes Zeit und Kraft. Aber jetzt würden mir ein paar nette Neuigkeiten gut tun. Sag, wie war das letzte Klassentreffen? Hat die Moni den Bernhard immer noch so angeschmachtet wie damals zur Schulzeit?«
»Unser guter Bernhard trägt inzwischen Bauch und ist mit Sybille aus der 10b verheiratet«, erzählte Lisa, »und unser alter Klassenlehrer Leitner lässt sich die Haare färben, viel zu dunkel für sein Alter, kann ich dir als Fachfrau sagen! Dafür fährt er immer in die Kreisstadt, damit man es hier nicht mitbekommt. Andi und Merle sind immer noch ein Paar, und Karla und ihr Mann haben ein Kind adoptiert. Ach, und neulich haben sich zwei Touristen im Biergarten in die Haare gekriegt, weil einer …«, munter plätscherte Lisas Stimme vor sich hin, und die Schilderungen der kleinen Neuigkeiten waren Balsam für Maries müde Seele. Es waren nur harmlose Begebenheiten, über die Lisa plauderte, nichts Verletzendes oder Hinterhältiges.
Das, so beschloss die hübsche Blondine, würde sie sich für später aufheben.
*
Während die beiden vermeintlichen Freundinnen auf dem Ebereschenhof zurück blieben, fuhren Doktor Seefeld und die Hebamme hinunter in den Ort. Wie vereinbart setzte Sebastian seine Kollegin am Kirchplatz ab. Auf die junge Hebamme wartete gleich der Kursus zur Geburtsvorbereitung in ihrer Praxis, und Sebastian wollte versuchen, mit seiner unglücklichen Tochter zu sprechen. Vielleicht bahnte das Zubereiten ihres Lieblingsessens einen kleinen Weg durch den Ring der Einsamkeit und Abwehr, den Emilia um sich gezogen hatte.
»Diese gemeinsame Runde war eine gute Idee von dir«, sagte Sebastian zufrieden. »Das sollten wir öfter machen, wenn wir dieselben Patientinnen betreuen.«
Anna spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss. »Danke!«, antwortete sie. Ein warmherziges Lächeln tanzte in ihren grünen Augen. »Das würde ich sehr gern. Wir geben ein gutes Team ab, wie wir in den Stunden auf dem Aussiedlerhof bewiesen haben.«
»Und nicht nur dort«, fuhr Sebastian fort. »Dass alle so zusammengehalten und Antons Familie in dieser Notlage beigestanden haben, war nicht nur mein Werk. Ohne dich wäre es nicht möglich gewesen! Du sprichst die Herzen der Menschen an, Anna.«
Wie schön das klang! Aber die junge Hebamme wusste auch, dass es eher aus kollegialer Sicht gemeint war. »Lass gut sein, Sebastian, das haben wir beide uns auf die Fahne zu schreiben«, antwortete sie verlegen.
»Sag ich doch: Wir beide!«, lächelte er, und Annas Herz machte einen Satz.
»Ich, äh, ich muss jetzt los«, stotterte sie. »Mein Kurs, beginnt gleich, und ich muss den Raum noch vorbereiten.«
Sebastian dachte an die hübschen, lichtdurchfluteten Räume mit dem hellen Mobiliar und den sanften Farben. »Die Mütter haben es gut bei dir, Anna«, sagte er.
»Das, hm, das will ich hoffen«, räusperte sich die junge Frau. Was war nur mit ihrer Stimme los? Sie klang genauso seltsam, wie sich ihr Herz benahm. Sie griff nach ihrer großen Tasche und öffnete die Wagentür. »Dann also bis übermorgen, wenn der Besuch bei der Huber Bäuerin ansteht.«
»Ja, bis übermorgen«, antwortete Sebastian. Die Autotür wurde geschlossen, und der Wagen setzte sich in Bewegung, Richtung Doktorhaus.
»Ja, da schau her! Machst du deine Besuche jetzt immer mit dem jungen Doktor zusammen?« Wie aus dem Boden gewachsen stand plötzlich Miriam Holzer neben Anna und schaute die junge Hebamme aus schmalen Augen an.
Anna spürte beinahe körperlich die Woge aus Neid und Missgunst, die sie regelrecht überrollte. Doch davon würde sich die Erinnerung an den schönen Nachmittag mit Doktor Seefeld nicht verderben lassen! Anna antwortete mit einem zuckersüßen Lächeln und dem Spruch: »Nicht immer, aber immer öfter! Ich wünsch dir einen schönen Abend, Miriam.« Mit diesen Worten schwebte sie davon.
Der Landdoktor, der keine Ahnung davon hatte, welche der Dorfbewohnerinnen sich mit welchen Plänen beschäftigte, war inzwischen zu Hause angelangt. Er ging um das schöne, alte Haus herum in den Garten und wollte von dort aus gleich die Küche betreten, um das geplante Lieblingsessen für seine Tochter zuzubereiten. Wie lange war es her, dass sie Mal diese kleinen Pfannkuchen, triefend von Butter und Ahornsirup, gegessen hatten! Vielleicht würde Emilia sich darüber freuen und mehr noch hoffentlich über die Zeit des gemeinsamen Arbeitens und Redens mit ihrem vielbeschäftigten Vater.
Aber anstelle abwehrenden Schweigens und einer finsteren Miene überraschten ihn fröhliches, ausgelassenes Rufen und Lachen im Garten! Er blieb stehen und schaute voller Freude auf Emilia und ihre beste Freundin Antonia. Die Mädels tobten mit ihren Hunden über den Rasen. Toni hatte ihre Colliehündin Hazel dabei, und diese war sehr damit beschäftigt, dem Welpen der Familie Seefeld Manieren beizubringen! Mädchen und Hunde sprangen wild durcheinander, es wurde gerufen und gequietscht und sehr viel gelacht. Als Emilia ihren Vater bemerkte, rannte sie auf ihn zu und warf ihm mit Schwung die Arme um den Hals.
»Hallo, Papa! Wie schön, dass du wieder da bist! Hattest du einen guten Tag? Musstest du weit fahren? Warst du auch droben auf dem Aussiedlerhof? Wie geht’s dem Baby? Kann Toni zum Abendbrot bleiben? Guck‘ mal, was Nolan schon kann!«
Alles in einem einzigen, atemlosen Satz, mit fröhlich blitzenden Augen und platzend vor Energie und Übermut. Ehe Sebastian überhaupt den Mund aufmachen und antworten konnte, wirbelte seine Tochter herum und warf sich wieder mitten ins Getümmel.
Ein wenig verdattert, aber sehr erleichtert und glücklich stand Sebastian auf der Terrasse und schaute zu seinem Vater und Traudel hinüber, die lesend in ihren bequemen Korbsesseln lagen. Traudel bemerkte seinen Blick und lächelte ihn über den Rand ihres Buches an. Sie zuckte leicht mit den Achseln und sagte wissend: »Pubertät …«.
*
Sonnenstrahlen tanzten auf Maries Nase und weckten die junge Frau. Mit einem Blick auf die Uhr stellte sie erstaunt fest, wie lange sie geschlafen hatte. Kein Grübeln bis tief in die Nacht hinein, kein schlafloses Herumwälzen lange vorm Morgenrot – das war ihr seit Ewigkeiten nicht mehr passiert.
Voller Energie und Vorfreude auf den neuen Tag sprang Marie aus dem Bett und begann, in ihren halb ausgepackten Koffern und Kisten nach passender Kleidung zu suchen. Tja, was trug man, wenn ein arbeitsreicher Tag und eine Besprechung mit einem Handwerker vor einem lagen?
Sicherlich keines der hauchdünnen, kurzen Sommerkleidchen, von denen Marie etliche aus Frankreich mitgebracht hatte.
Jeans? Nicht bei diesen hochsommerlichen Temperaturen.
Die Arbeitsklamotten von gestern hingen gewaschen und bereits getrocknet auf der Leine. Sie waren zwar zweckmäßig, aber alles andere als hübsch.
Marie begegnete ihrem Blick im Spiegel und zog überrascht die Augenbrauen hoch. »Hab ich das eben wirklich gedacht?«, fragte sie laut ins leere Zimmer hinein. »Dass ich hübsch aussehen möchte? Wie komme ich denn nur darauf?«
Kritisch musterte sie ihr Spiegelbild. Klein und zierlich war sie schon immer gewesen, aber durch den Kummer der letzten Jahre hatte sie an Gewicht verloren. Jetzt wirkte sie beinahe zerbrechlich. Aber Arme und Beine waren wohlgeformt und verrieten, dass sie auch körperliche Arbeit gewohnt war. Ihre Haut hatte einen sanften Goldton, und ihre dunklen Locken schwebten wie eine seidige Wolke über Schultern und Rücken. Und auf zauberhafte Weise war ein Leuchten in ihre Augen zurückgekehrt, das für immer erloschen schien.
»Nun, das bedeutet gar nichts!«, erklärte Marie ihrem Spiegelbild. »Ich freu mich halt nur, dass endlich etwas Neues beginnt.«
Sie griff energisch nach Shorts aus heller Baumwolle und einem Top mit schmalen Trägern in einem zarten Türkis. Die langen Haare fasste sie zu einem nachlässigen Knoten zusammen, und sie entdeckte in der Schale mit ihren Schmuckstücken zarte Ohrringe, die farblich genau zu ihrem Oberteil passten. Jetzt nur noch die Schuhe. In eleganten Riemchensandalen konnte sie nicht den ganzen Tag arbeiten, aber etwas, was ihre frisch lackierten Fußnägel zeigte, durfte es schon sein.
»Und das alles hat nichts mit einem gewissen Zimmermann zu tun, der gleich zum Aufmaß herauskommt!«, erklärte Marie ihrem Spiegelbild. »Rein gar nichts! Er sieht schließlich nur eine Kundin in mir!«
Benjamin Lauterbach teilte sich eine Wohnung mit seinem Freund Niklas, der ebenfalls Zimmermann war. Zwei Zimmer, Küche, Bad und ein kleiner Hof bildeten den äußeren Rahmen für die Männer-WG, in der es erstaunlich ordentlich, manchmal feucht-fröhlich und meistens harmonisch zuging.
Heute Morgen allerdings klopfte Niklas mit hörbarer Ungeduld an die verschlossene Badezimmertür. »Jetzt beeil dich mal, andere Leute müssen auch zur Arbeit!«, rief er ungeduldig.
»Sofort! Nur noch einen Augenblick!«, tönte es zurück.
»Das sagst du seit zehn Minuten!«, beschwerte sich Niklas. »Mach hin jetzt!«
»Ja-ha!«
Ehe Niklas noch lauter werden konnte, wurde die Tür geöffnet, und Sebastian trat in den kleinen Flur. Mit frisch gestutztem Bart, schimmernden Haaren und begleitet von einem Hauch Sandelholz und Zitronengras.
Niklas grinste. »Neues Duftwasser? Riecht männlich, edel und verdammt teuer. Wohin willst du denn heute Morgen?«
»Arbeiten!«, antwortete Ben und verschwand in seinem Zimmer.
»Verstehe!«, rief Niklas und verschwand immer noch grinsend unter der Dusche.
Vor seinem Schrank stehend hatte Ben jetzt die Qual der Wahl. Die klassische Zimmermannskluft aus schwarzem Cord? Zu angeberisch für ein Aufmaß.
Jeans? Wenn ja, welche?
Weißes T-Shirt oder ein buntes? Oder ein Polo-Shirt?
Schließlich erschien Ben in seiner dunklen Lieblingsjeans und einem weißen T-Shirt mit Rundhalsausschnitt in der Küche und griff nach Kaffeebecher und Tageszeitung. Kurze Zeit später ging er in sein Zimmer und kam in hellen Jeans mit abgeschnittenen Beinen und einem blauen Polo-Shirt zurück. Weitere fünf Minuten später trug er wieder seine Lieblingsjeans und ein weißes T-Shirt, dieses Mal eines mit V-Ausschnitt.
Niklas legte seinen Teil der Zeitung zur Seite und musterte seinen Freund interessiert. »Wohin gehst du heute Morgen noch mal? Zur Königin von Saba?«
»Quatschkopf!«, knurrte Ben. »Ich mach ein Aufmaß, draußen auf dem Ebereschenhof.«
»So, so, und dafür musst du dich dreimal umziehen?« Niklas’ Grinsen wuchs in die Breite.
»Man achtet eben auf sich!«, antwortete Ben so würdevoll wie möglich. »Es ist halt ein großer Auftrag, da muss man schon solide und vertrauenerweckend daherkommen!«
»Solide und vertrauenerweckend«, wiederholte Niklas schmunzelnd, »was du nicht sagst!«
»Hey, es ist nicht jeder so geschmacksblind wie du!«, konterte Ben und wies anklagend auf die Kleidung seines Freundes. Niklas saß dort sehr gemütlich in seiner uralten Zimmermannshose, die deutlich bessere Tage gesehen hatte, und einem schreiend bunt gemusterten Hawaiihemd.
»Ich nehme an, besagter Auftrag wird von einer Sie erteil?«, erkundigte sich Niklas.
»Genau.« Jetzt wurde Ben wieder ernsthaft. »Der Ebereschenhof gehört Marie Höfer.«
»Die Frau kenne ich nicht«, erwiderte Niklas. »Sie muss ja sehr besonders sein, dass du dir so viel Mühe mit deinem Aussehen gibst.«
»Das ist reine Höflichkeit!«, antwortete sein Freund. Er stand auf, faltete umständlich die Zeitung zusammen und suchte nach seinen Schlüsseln. Unter der Tür drehte Ben sich noch einmal um. »Aber du hast recht, sie ist wirklich eine ganz besondere Frau!«
Wenige Zeit später stand der junge Zimmermann auf dem Ebereschenhof und schaute sich prüfend um. Nichts Auffälliges hatte sich verändert, und dennoch schien eine andere Stimmung als am Vortag über dem Hof zu liegen. Lag es allein daran, dass heute Fenster und Türen einladend geöffnet waren? Dass die Spatzen in den Bäumen so fröhlich lärmten? Dass der Sonnenschein sich im steinernen Wassertrog spiegelte und die Oberfläche zum Glitzern brachte? Auf zauberhafte Weise schien der alte Hof neu belebt zu sein.
Leichte Schritte knirschten auf dem Kiesweg, als Marie um die Hausecke bog. Sie trug eine kleine Schale in der Hand, aus der sie im Gehen reife Brombeeren naschte. Als sie den Zimmermann sah, leuchtete ihr Gesicht auf. »Oh, Sie sind schon da?«, rief sie. »Guten Morgen!«
Ben starrte sie einen Augenblick lang schweigend an. Was für ein Unterschied zu der abgekämpften jungen Frau von gestern! »Auch Ihnen einen guten Morgen«, grüßte er zurück. »Dann sind wir also beide bereit für unser Tagwerk?«
»Ja!« Marie führte Ben wieder in die alte Küche, griff nach ihren Aufzeichnungen und bat den Mann dann weiter ins Haus hinein. Die nächsten Stunden waren arbeitsintensiv und auf eine angenehme Weise anstrengend. Für Maries Wohnung im Erdgeschoss wurden die nötigen Veränderungen festgelegt, dann begann das Planen der oberen Etage für die Gästezimmer. Im Handumdrehen drang das Mittagsläuten aus dem Ort zum Hof hinüber.
»Was denn, ist es schon so spät? Wir hatten uns den Vormittag zum Planen vorgenommen und haben gerade mal die Hälfte geschafft!« Marie strich sich eine lose Haarsträhne, die ihr immer wieder in die Augen fiel, hinter das Ohr zurück. »Dann müssen wir wohl einen neuen Termin ausmachen«, fügte sie enttäuscht hinzu.
Ben lächelte. »Wieso? Haben Sie denn für den Rest des Tages etwas Wichtiges vor?«
»Ich? Nein! Ich bin sowieso hier, aber was ist mit Ihnen? Müssen Sie nicht weiter zur nächsten Baustelle?«, antwortete Marie überrascht.
»Tja, ich hab mir gestern Abend schon einige Gedanken zu diesem Auftrag gemacht, und da wurde mir klar, dass wir mehr Zeit für das Aufmaß brauchen werden. Wenn es Ihnen also recht ist, machen wir einfach so lange weiter, bis alles geklärt ist«, schlug Ben vor. »Und wenn es bis in die Nacht hinein dauert.«
»Das will ich nicht hoffen!«, entgegnete Marie spontan. Kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, wäre sie vor Verlegenheit am liebsten im Erdboden versunken. Wie hatte das denn geklungen! Abwehrend und unfreundlich und so, als wollte sie den Zimmermann so schnell wie möglich wieder vom Hof haben.
Marie wich zurück. »Ich wollte nicht unhöflich klingen«, erklärte sie steif. »Und ich danke Ihnen, dass Sie sich spontan so viel Zeit nehmen.«
»Hm«, machte Ben, »das sagen Sie vielleicht nicht mehr, wenn Sie meine Rechnung gesehen haben.«
Darauf fehlten Marie die Worte, sie starrte ihn einfach nur erschrocken an. Plötzlich tat sie Ben leid. Was musste diese Frau in der Vergangenheit durchgemacht, wie hart musste sie gekämpft haben, dass sie sich so leicht verunsichern ließ?
»Hören Sie, bitte«, sagte er sanft, und seine tiefe Stimme wurde zu etwas Warmen, Beschützenden, das über Maries verkrampfte Schultern glitt. »Das mit der Rechnung war nur ein Scherz, und ich weiß, dass Sie nicht unhöflich klingen wollten. Das können Sie gar nicht! Wir wissen doch schon, dass wir gut zusammenarbeiten werden, nicht wahr? Aber dann dürfen Sie auch nicht so leicht erschrecken und sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen und mich mit so großen, traurigen Rehaugen anschauen, dann bekomme ich nämlich gar nichts mehr richtig auf die Reihe.« Er streckte ihr behutsam seine Hand entgegen. »Wollen wir es nicht ein bisschen weniger förmlich mit einander versuchen? Ich bin Benjamin, für meine Freunde einfach Ben.«
Zögernd legte die junge Frau ihre Hand in die des Mannes. Ihr Blick war ernst und gleichzeitig erfüllt von einem feinen Leuchten. »Marie!«, sagte sie schlicht.
Für einen Moment stand sich das Paar so gegenüber, Hand in Hand, und verbunden durch einen Blick, in dem unauslotbare Tiefe mitschwang.
Was tue ich hier?, dachte Marie verschwommen. Das klingt ja fast wie ein Versprechen, das wir uns geben. Es fühlt sich so gut an, so seltsam vertraut – aber was soll das? Ich weiß doch, dass ich niemandem mehr vertrauen kann.
Langsam zog sie ihre Hand zurück, aber ihre Augen suchten immer noch den intensiven Blick des Mannes. »Dann werden wir wohl den ganzen Tag mit einander verbringen«, sagte sie endlich.
»So ist es, Marie«, antwortete Ben sanft und trat einen Schritt zurück, um den geheimnisvollen Kreis zu verlassen, der sich eben um sie geschlossen hatte. Wäre er länger so nah bei ihr geblieben, berührt vom Bann ihrer dunklen Augen und der widerstreitenden Gefühle, die er darin erkannte –, dann hätte er sie geküsst. Und das wäre im Augenblick so ziemlich das Verkehrteste, was er tun konnte, dessen war Ben sich sicher! Also konzentrierte er sich auf die nächsten Schritte seiner Arbeit und folgte der jungen Frau durch ihre Pläne, maß, berechnete und füllte Seite um Seite seines Notizbuches.
Bis auf eine Pause für Kaffee und einen kleinen Imbiss arbeiteten sie wirklich so lange durch, bis das Abendläuten aus dem Dorf verstummt war. Dann hatten sie alles erfasst, und mit hörbarer Genugtuung klatschte Ben sein Buch auf den Küchentisch neben Maries Pläne. »So, genug getan für heute! Jetzt haben wir uns den Feierabend redlich verdient.«
»Recht hast du!«, stimmte Marie ihm bei. In Gedanken überschlug sie den Inhalt ihrer Speisekammer und stellte fest, dass es nicht für zwei Hungrige reichen würde. Zu einem größeren Einkauf war ihr nicht die Zeit geblieben. »Ich kann dir leider nur Brezen und Bier anbieten, und das ist nun nicht wirklich toll nach einem langen Arbeitstag«, sagte sie betrübt.
Ben lachte. »Hast du denn auch so großen Hunger wie ich?«
»Leider ja«, antwortete die junge Frau, »und noch nicht einmal eine Pizza im Kühlschrank.«
»Hm, das wirft aber kein gutes Licht auf dich als angehende Pensionswirtin!«, neckte er Marie.
»Ich werde eine Frühstückspension führen, und zum Frühstück gibt’s bei mir keine Pizza!«, erinnerte ihn die junge Frau resolut.
»Recht so«, schmunzelte Ben. »Was hältst du denn davon, wenn du hier jetzt Fenster und Türen schließt, wir beide fahren runter ins Dorf, setzen uns in den Biergarten und haben einfach ein gemütliches Abendessen zusammen?«
»Gute Idee! Während ich meine Autoschlüssel hole, setzt du dich auf die Hausbank und isst als kleine Vorspeise die restlichen Brombeeren.« Marie reichte ihm die Schüssel hinüber und lief dann durchs Haus, um Fenster und Türen zu schließen. Mit einer leichten Strickjacke und ihrer Tasche in der Hand trat sie schließlich hinaus zu dem Mann, der gemütlich an der Hauswand lehnte, den Kopf in den Nacken gelegt, die Augen halb geschlossen.
»Schön hast du’s hier, Marie«, sagte er bedächtig. Sein Blick glitt über das sanfte Grün des Hügels unterhalb des Hofes, umfasste die beiden Sternwolkenseen und das Dorf, das sich dazwischen erstreckte. Abgesehen vom leisen Geräusch des Windes in den Ebereschen und den hellen Vogelstimmen war es absolut still hier oben. Das Blau des unendlichen Himmels spiegelte sich im Blau der Seen und dem schmalen Fußverlauf am Rand des Dorfes. »Wirklich schön«, wiederholte er und fügte dann behutsam hinzu: »Und auch – ein wenig einsam, so ganz allein abseits des Dorfes?«
Marie setzte sich neben ihn. Sie zog die Beine auf die Bank, umschlang sie mit ihren Armen und wiegte sich gedankenverloren vor und zurück. »Weißt du, einsam kann man auf so viele verschiedene Arten sein«, begann sie tastend. »Als ich jetzt zum ersten Mal in mein Elternhaus zurück kam und niemand war mehr hier, das war schon schlimm. Ich stand abends auf dem Hofplatz, sah unten im Dorf die erleuchteten Fenster, und hinter mir war alles totenstill und dunkel. Da hab ich mich schon sehr einsam und verloren gefühlt.
Aber in Frankreich, wo wir eine eigene Firma hatten und ich ein sogenanntes großes Haus mit vielen Einladungen führte, da war ich immer von vielen Menschen umgeben und habe mich dennoch einsam gefühlt. Man kann mit vielen Menschen reden, essen, vielleicht tanzen und lachen, und dennoch begegnet man ihnen nicht wirklich. Da ist es mir lieber, ich bin lebe hier alleine, und wenn ich Menschen treffe, dann begegne ich ihnen wahrhaftig.«
Ben suchte Maries dunklen Blick. »So wie wir uns begegnen?«, fragte er behutsam.
Marie nickte, und wieder war ihre Antwort Ernst und Lächeln zugleich. »Ja, so wie wir uns begegnen«, wiederholte sie seine Worte.
Dann schüttelte sie den Kopf, als wolle sie etwas Bestimmtes vertreiben, und lachte leise auf. »Vielleicht sollte ich nicht so schwärmerisch vom Alleinsein sprechen«, meinte sie leichthin. »Bald wird eine Menge Handwerker für eine Menge Unruhe auf dem Hof sorgen, und über zu wenig Gesellschaft kann ich mich dann nicht beklagen. Und übrigens werde ich einen Hund und mindestens eine Katze haben!«
»Recht so!«, lächelte Ben. »Und bis es so weit ist, nimmst du da mit meiner Gesellschaft vorlieb?«
»Sehr gern!«, rief Marie und sprang auf die Beine. »Und jetzt lass uns bitte fahren, sonst übertönt noch das Knurren meines Magens unsere tiefsinnigen Gespräche!«
*
Im Biergarten waren schon etliche Plätze belegt. Schmale Tische und Bänke wechselten sich ab mit anderen Sitzgruppen, Lampionketten schaukelten in den alten Bäumen, und zwischen Küche und Garten herrschte reger Betrieb. Lisa und Ben entschieden sich für den Tisch, an dem schon die beiden Seefelds und Traudel mit ihrer Freundin Regina, der Haushälterin des Pfarrers, saßen.
»Grüß Gott! Schön, dass Sie sich zu uns setzen«, wurden sie freundlich begrüßt.
Marie lächelte schüchtern. Sie kannte vor allem Benedikt Seefeld gut, seit ihrer Kindheit war er der Arzt der Familie Höfer gewesen. Es war schön, nach so vielen Jahren der Abwesenheit wieder Aufnahme in den vertrauten Personenkreis zu finden, und gleichzeitig machte es sie befangen. Was, wenn sie nach ihren Jahren in Frankreich gefragt wurde? Sie mochte nicht über ihr so unglücklich verlaufenes Leben sprechen, das war nichts für die Öffentlichkeit.
Zu ihrer Erleichterung drehte sich das Gespräch um ganz andere Themen. Doktor Sebastian Seefeld erzählte von seiner Zeit in Toronto, als er viel auf dem Rettungswagen unterwegs gewesen war. Seine farbigen Schilderungen nahm die Runde mit durch Schneesturm und Eis zu einem abseits gelegenen Haus, wo ein Farmer wegen eines komplizierten Beinbruchs höllische Schmerzen litt. Der Schneesturm hatte sich im Laufe der Erstversorgung zu einem Blizzard entwickelt, der die Straßen unpassierbar machte. Der Einsatz endete mit einer Nacht vor dem Kaminfeuer, deftigem Eintopf und Kaffee mit einem ordentlichen Schuss Whisky, während die Mannschaft des Notarztwagens mit der Frau des Farmers und seinen Töchtern Square Dance tanzte. Die Musik dazu lieferte der bis zum Stehkragen mit Medikamenten vollgepumpte, sehr aufgekratzte Patient auf seiner Mundharmonika.
»Ich kann mir gut vorstellen, dass die Arbeit unter diesen Umständen eine Menge Spaß macht«, lachte Ben.
»Schon«, stimmte Sebastian schmunzelnd zu. »Nur war es am anderen Tag, als die Straßen wieder befahrbar waren, ein hartes Stück Arbeit, den guten Mann zur Verlegung ins Krankenhaus und zur dringend nötigen OP zu bewegen. Durch die starken Medikamente war er praktisch wie im Vollrausch und er meinte, es ginge ihm ja so gut!«
Gerade wurden für Marie die bestellten Alpenmakrönli und für Ben Allgäuer Kässpatzen serviert. Der junge Zimmermann griff nach der Gabel und drehte sie nachdenklich in der Hand.
»Das mit dem Rausch unter Schmerzmitteln kann ich gut verstehen«, sagte er. »Wie jeder in meiner Zunft habe auch ich einmal einen etwas zu intensiven Kontakt mit der Kreissäge gehabt.«
Marie stockte der Atem.
Ben bemerkte ihr Erschrecken und lächelte sie beruhigend an. »So schlimm war es dann doch nicht«, erklärte er. »Es handelte sich zwar um einen sehr tiefen Schnitt, aber alle Finger waren noch dort, wo sie hingehörten. Trotzdem kam mir die Zeit, bis der Notarzt da war, wie eine Ewigkeit vor. Und nach der ersten Spritze hab ich erst vor Erleichterung geheult und dann jede Menge Blödsinn erzählt.« Er runzelte nachdenklich die Stirn. »Der Notarzt war eine Notärztin, und ich glaube, ich habe ihr erst einen unsittlichen Antrag und dann einen Heiratsantrag gemacht. Darauf hat sie mir noch eine Spritze gegeben, und ich war weg.«
Marie stimmte in das Lachen der Runde mit ein und sie spürte, wie ihr Herz sich Stück für Stück immer weiter öffnete: dem Leben, der Unbeschwertheit und auch diesem Mann. Sie bewunderte, wie offen Benjamin von seinen Gefühlen sprechen konnte. Er schämte sich seiner Schmerzen nicht, nicht seiner Tränen und auch nicht wegen seines Verhaltens, als er offenbar nicht ganz zurechnungsfähig gewesen war. Das beeindruckte Marie, und insgeheim wünschte sie sich auch etwas von dieser Selbstsicherheit.
Unbewusst streckte sie ihre Finger und berührte Bens Hand an der Stelle, an der eine breite Narbe von der alten Verletzung erzählte. Marie spürte Bens Lächeln mehr, als dass sie es sah, und sie wusste, dass es ihr und der flüchtigen Zärtlichkeit ihrer Berührung galt.
Mit Schwung wurden neu gefüllte Maßkrüge auf den Tisch gestellt, und der kleine, intime Augenblick flog davon. »Ja, wen seh‘ ich denn da? Die Marie ist wieder im Lande!« Offenbar hatte das Personal Schichtwechsel gehabt, und die neue Kellnerin musterte Marie mit überdeutlicher Neugier. Die Frau war jünger als Traudel und ihre Freundin und längst nicht so freundlich. Sie hieß Afra, betrieb seit Jahren den Zeitungskiosk von Bergmoosbach und hörte das Gras wachsen, ehe sich überhaupt eine Halmspitze aus dem Boden hervorwagte. Offensichtlich arbeitete sie jetzt auch als Kellnerin für die Brauerei Schwartz. »Ich mochte es ja kaum glauben, was mir die Lisa vorhin im Salon erzählt hat! Daheim bleiben willst du, den Hof umbauen und eine Pension betreiben? Und das alles ohne deinen Mann, den Fabian?«
Marie zuckte zusammen, aber dann erinnerte sie sich an das, was Ben über sie und ihr Schneckenhaus gesagt hatte. Sie reckte das Kinn in die Luft und schaute Afra genau in die Augen. »Ja, genau!«, sagte sie fest.
»Aber übernimmst du dich damit nicht? Soviel Arbeit und soviel Verantwortung und das ganz allein, das kann doch nicht gut gehen!« Missbilligend kniff die Frau ihre Lippen zusammen.
»Afra, eure Kässpatzen haben mir nicht gereicht. Bring mir bitte noch den Wurstsalat mit dem Sauerteigbrot!«, meldete Ben sich zu Wort.
Die Kellnerin nickte, richtete ihre Aufmerksamkeit aber weiterhin auf Marie. »Selbstständig machen willst du dich also?«, fuhr sie ungerührt fort. »Wenn daraus man was wird! Und dabei könntest du doch ein gutes Stück Geld verdienen, wenn du den Hof verkaufst.«
»Ich verkaufe nicht und damit Schluss der Diskussion!«, sagte Marie energisch. »Und übrigens kannst du uns zwei Portionen Wurstsalat bringen, ich bin auch nicht satt geworden.«
Afra sammelte die leeren Bierkrüge ein und hielt immer noch an ihrem Thema fest. »Du solltest dir das mit dem Hof gut überlegen, Madel! Eine falsche Entscheidung hast du ja bereits getroffen, und Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall!«
Ben räusperte sich bedrohlich, und Benedikt Seefeld setzte seinen Maßkrug mit einem deutlichen Knall auf den Tisch. »Überleg‘ dir, was du redest, Afra!«, sagte er streng. »Wann ist Marie jemals hochmütig gewesen?«
»Ich mein‘ ja nur, es musste ja unbedingt dieser Franzose sein, mit all seinem Geld und dem Schloss bei Paris und …«,
»Es war kein Schloss!«, unterbrach sie Marie genervt. »Und wenn du dich jetzt nicht sofort um unsere Bestellung kümmerst, gehe ich rüber zum Wirt und beschwere mich über die schwatzhafte Bedienung!«
»Pah! Ich und schwatzhaft! Keinen Respekt hast du, Madl!« Wütend rauschte Afra davon.
Sebastian Seefeld hob seine Maß. »Na, dann auf einen gemütlichen Abend im Biergarten!«, sagte er ironisch.
Zu ihrem eigenen Erstaunen hörte Marie sich lachen. »Was kümmert mich das Gerede? Wir haben doch wirklich einen schönen und gemütlichen Abend miteinander!«
»Haben wir!«, bestätigte die tiefe, warme Bassstimme neben ihr, und der peinliche Auftritt Afras geriet in Vergessenheit.
Die Dämmerung war in das sanfte Blau der Nacht übergegangen, und im Laub der alten Lindenbäume leuchteten die Lampionketten, welche den Biergarten umspannten. Der fast vollständig gerundete Mond wanderte über das Dorf, schien die Kirchturmspitze zu berühren und überzog die Dächer mit seinem blau-silbernen Licht.
Erfüllt von ihrem erfolgreichen Tag und diesem schönen Abend, reckte Marie ihre Arme weit über den Kopf und sagte in die Runde: »Wisst ihr, was? Es ist eine so wunderschöne Nacht, ich habe große Lust, zu Fuß nach Hause zu gehen.«
»Da haben Sie sich aber einiges vorgenommen«, meinte Sebastian Seefeld. »Das dauert doch sicher gut eine Stunde von hier bis zum Ebereschenhof.«
»Und es gibt keine Straßenlaternen außerhalb des Ortes«, erinnerte sein Vater. Die beiden Männer hatten bezahlt und waren im Aufbruch, Traudel und ihre Freundin hatten sich schon früher verabschiedet.
»Ich brauche keine Laternen«, meinte Marie verträumt. »Der Mond scheint doch ganz hell. Ich gehe einfach immer die Landstraße entlang, und dann bei mir den Hügel hinauf.«
Ben musterte sie interessiert. »Ein Mondscheinspaziergang? Das klingt gut. Wenn es dir recht ist, begleite ich dich nach Hause.«
»Und wie kommst du dann wieder zurück ins Dorf?«, überlegte Marie. »Du könntest meinen Wagen nehmen.«
»Das klärt ihr jungen Leute unter euch, ich jedenfalls muss jetzt ins Bett. Gute Nacht, alle miteinander!«, sagte Benedikt Seefeld. Er und sein Sohn verabschiedeten sich und gingen gemeinsam hinüber zum Doktorhaus.
Marie und Ben schlenderten zum Ausgang des Biergartens. Rechts musste man abbiegen, um zum Ebereschenhof zu gelangen, links ging es zu Benjamins Wohnung. Der Mann stand so nahe bei Marie, dass sie seine Wärme spüren konnte.
»Willst du wirklich den ganzen Weg laufen?«, fragte er leise. »Die zeitliche Einschätzung des Doktors stimmt sicher, zumal jetzt in der Dunkelheit. Soll ich dich nicht lieber fahren?«
»Wie viel haben wir getrunken? Jeder eine Maß und danach noch Federweißer!«, erinnerte ihn Marie. »Jetzt Auto zu fahren ist keine gute Idee.«
»Hm, da hast du recht«, stimmte Ben ihr zu. »Also laufen wir?«
»Wir laufen!« Übermütig und ohne eine Spur von Müdigkeit drehte Marie sich mit weit ausgebreiteten Armen ein paar Mal um sich selbst und kam dann schwankend zum Stehen. Instinktiv streckte sie die Hand aus und suchte Halt. »Ups, jetzt ist mir etwas schwindelig«, meinte sie entschuldigend.
»Macht doch nichts«, lächelte Ben. Seine Hand hielt immer noch Maries und ließ sie auch nicht los, nachdem der kleine Schwindelanfall vorbei war und das Paar sich auf den Weg zum Ebereschenhof machte.
Zunächst gingen sie an der Brauerei Schwartz entlang, die den Biergarten betrieb. Hinter den hell erleuchteten Fenstern der Küche war Afra mit einer letzten Bestellung beschäftigt, als sie Marie und Ben einträchtig die Straße entlang gehen sah. Sie verfolgte sie mit einem Blick aus zusammengekniffenen Augen, dann griff sie zum Telefon. Nach mehrmaligen Läuten meldete sich eine verschlafene Frauenstimme.
»…!«
»Hallo, Lisa? Hier ist Afra.«
»…!«
»Ja, ich weiß, wie spät es ist! Es ist kurz vor Mitternacht.«
»…!«
»Nein, ich spinne nicht, so spät noch anzurufen!«
»…!«
»Jetzt hör auf zu mosern und rate mal, wer hier stundenlang gesessen hat und eben Händchen haltend Richtung Ebereschenhof gegangen ist!«
*
Während Benjamin und Marie nichtsahnend und fröhlich durchs nächtliche Dorf gingen, begann dort bereits die Gerüchteküche zu brodeln. Der Anruf der klatschsüchtigen Afra hatte einen neuen Stachel der Bosheit in Lisas Herz getrieben. Noch Stunden später konnte die junge Frau keinen Schlaf finden.
Was war das nur mit dieser Marie? Erst flog dieser reiche Franzose auf sie und nun der attraktive Benjamin. Kaum war diese Frau im Ort, wurden die tollsten Männer auf sie aufmerksam. Und dabei hatte Marie, gemessen an Lisas Schönheitsvorstellungen, gar nichts Anziehendes an sich. Während sie, die aufregend blonde Lisa, doch alle körperlichen Attribute besaß, die Männer toll fanden. Das war ganz einfach schreiend ungerecht!
Wütend sprang Lisa aus dem Bett, stapfte hinüber in ihr kleines Wohnzimmer und holte aus dem untersten Regal eine Schachtel hervor, in der sie Erinnerungsstücke an ihre Affaire mit Fabian Legrand aufbewahrte. Na bitte, da hatte sie es doch Schwarz auf Weiß, beziehungsweise bunt: Zettel mit heißen Liebesschwüren, die in Lisas Augen als Liebesbriefe durchgingen, und Fotos von ihnen beiden in äußerst anzüglichen Situationen.
Alles aus der Zeit, als Fabian sich um Marie Höfer bemühte, sich mit ihr verlobte, sie heiratete und mit ihr in ein aufregendes Leben nach Paris verschwand.
Damit musste sich doch etwas anfangen lassen?
Dumm nur, dass die Ehe auseinander gegangen war und Lisa mit irgendwelchen Enthüllungen keinen großen Schaden mehr bei Marie anrichten konnte. Andererseits – wer wusste denn, wozu es noch einmal gut sein würde? Vielleicht könnte es irgendwie eingesetzt werden, um Marie und diesen Zimmermann zu stoppen?
Wütend kaute Lisa auf ihrer Unterlippe. Bei der Vorstellung, was Marie und der attraktive Benjamin jetzt wahrscheinlich miteinander trieben, hätte Lisa vor Neid und Missgunst am liebsten laut aufgeschrien. Es war ihr völlig egal, was diese beiden Menschen verband: sie wollte Benjamin Lauterbach haben, genauso, wie ein verzogenes, trotziges Kind ein neues Spielzeug haben will. Und sie würde ihn bekommen, koste es, was es wolle! Ihr würde schon etwas einfallen, womit sie ihr Ziel erreichte.
*
Hätte Lisa tatsächlich gesehen, was Marie und Ben in dieser Nacht miteinander trieben, sie hätte laut und verächtlich gelacht.
Manchmal Hand in Hand, manchmal einfach so schlenderten die beiden jungen Leute durch das Dorf und dann auf die einsame Landstraße hinaus. Nachdem sich die Augen an die Nacht und das Mondlicht gewöhnt hatten, wurde das Gehen sicherer, und manchmal, wenn es zu ihren Erzählungen passte, legten sie sogar ein paar improvisierte Tanzschritte ein.
Sie verstanden sich blendend. Benjamin sprach voller Begeisterung von seinem Beruf und den Plänen, die er hatte. Als Geselle war er auf der traditionellen Walz auch in Österreich und Ungarn gewesen, und er konnte von vielen Erlebnissen berichten, die Marie zum Lachen brachten oder nachdenklich machten. Ben war kein oberflächlicher Mann; er sah das Leben in seiner ganzen Vielgestalt und teilte freimütig seine Gedanken mit Marie.
Ben wusste, dass Marie geschieden war, sie hatte es bei dem ersten Treffen auf ihrem Hof erwähnt. Feinfühlig vermied er jede Wendung des Gesprächs, das in diese Richtung ging. Wenn die junge Frau sehr Persönliches aus ihrem Leben erzählen wollte, dann würde sie es tun, da war Ben sich sicher. Bisher erzählte sie Unverfängliches aus ihrem Leben in Frankreich, der stetigen geheimen Sehnsucht nach dem Allgäu und der Freude, jetzt wieder zu Hause zu sein.
»Weißt du, eigentlich bin ich nicht der Typ, der gern umherzieht«, vertraute sie ihm an. »Ich verreise schon gern, aber ich komme auch immer wieder gerne nach Hause zurück.« Marie war stehen geblieben und umfasste die Weiden jenseits der Landstraße, das schlafende Dorf hinter ihnen, die sanften Hügel und das beeindruckende Bergmassiv, das in der fernen Dunkelheit schlummerte, mit einer weit ausholenden Bewegung ihrer Hände. Dann ließ sie die Arme sinken. »Es war wegen Fabian, dass ich von hier fortgezogen bin«, sagte sie plötzlich.
Benjamin schwieg einen Moment lang; er versuchte, im Schatten der Nacht Maries Gesichtsausdruck zu lesen. Schmerz konnte er nicht erkennen, eher eine gewisse Nachdenklichkeit. Behutsam strich er eine seidige Haarsträhne hinter Maries Ohr zurück, flüchtig streifte die Wärme seiner Fingerspitzen ihre Wange. »Habt ihr euch lange gekannt, du und dieser Fabian?«, fragte er vorsichtig.
Sie schüttelte leicht den Kopf. »Nein, wir haben sehr schnell geheiratet.« Ben konnte den Ausdruck des Unbehagens auf ihrem Gesicht sehen. Wieder schüttelte Marie den Kopf. »Lassen wir die Gespenster ruhen! Jetzt ist es viel zu schön für trübe Gedanken.« Sie deutete auf den Bach, der sich zwischen den weichen Moospolstern seines Ufers entlang schlängelte. »Sieh nur, der Mond spiegelt sich im Wasser, und die Schatten der Farnwedel sehen wie verzaubert aus.«
Ben lächelte und konnte gar nicht anders, als ihr behutsam den Arm um die Schultern zu legen. Einträchtig schauten sie in den dunklen, gemächlich dahin fließenden Bach, in dem sich an einer Stelle das Mondlicht brach, was zitternde Lichtreflexe auf die Wasseroberfläche malte. Zwischen den weichen, bemoosten Stellen waren auch größere Steine und Kiesel sichtbar, welche das Ufer säumten.
»Als Kinder sind wir oft hier am Bach gewesen, haben kleine Staudämme gebaut, nach schönen Steinen Ausschau gehalten und Feennester oder einen Schatz in der Uferböschung gesucht«, erzählte Marie lächelnd. Sie seufzte leicht. »Seltsam, warum macht man so etwas Schönes eigentlich nicht mehr, wenn man erwachsen ist?«
Ben lachte und streifte in einer fließenden Bewegung Schuhe und Strümpfe von den Füßen. Schnell waren die Hosenbeine hochgekrempelt, und er watete vorsichtig in den Bach. Seine Hände streckten sich der jungen Frau entgegen. »Worauf wartest du? Wir sind nicht einen Tag älter als sechs Jahre!«, rief er übermütig.
Marie lachte entzückt. Rasch hatte sie ihre Sandalen abgestreift, griff nach Bens Händen und stieg über den Uferrand. »Uuuuh, kalt!«, quietschte sie. »So kalt hab ich den guten, alten Moosbach gar nicht in Erinnerung!«
»Liegt vielleicht daran, dass die kleine Marie im Sommersonnenschein hier gespielt hat und nicht zu nachtschlafender Zeit?«, neckte sie Ben.
Maries leises Lachen klang sehr glücklich. Sie gewöhnte sich schnell an die Kälte des Wassers, ebenso an die Wärme, die von den Händen des Mannes ausging, der sie immer noch umsichtig stützte. Sie spürte die vom Wasser gerundeten Steine unter ihren Füßen, eine kleine Stelle mit weichem Ufersand, die sanfte Bewegung der Strömung an ihren Waden. Sie fühlte die Gegenwart des Mannes, dem sie sich vertrauensvoll zugewandt hatte, mit jeder Faser ihres Körpers. Der Glanz seiner Augen, blau-grün und schimmernd wie ein Bergsee, das zärtliche Lächeln, welches seine Lippen öffnete, schwebten wie ein stummes Versprechen über ihr, als Marie den Kopf hob und ihn anschaute. Bezaubernd, fragend, verlockend – und viel zu gefährlich.
»Ich, äh, ich kann ganz gut allein stehen«, stotterte Marie und zog ihre Hände zurück.
»Davon bin ich überzeugt«, antwortete Benjamin und trat einen Schritt zur Seite. Falls er von ihrer Reaktion enttäuscht war, ließ er es sich nicht anmerken. »Siehst du diese Ansammlung von Kieseln dort drüben? Vielleicht finden wir einen schönen, der dich an deine Kindheitsabenteuer erinnert.«
Erleichterung darüber, dass die große Nähe und ihr Zurückschrecken davor nicht in eine peinliche Situation umgeschlagen waren, breitete sich in Marie aus. Dankbar nickte sie Benjamin zu und watete zu der Stelle hinüber, wo sich Kiesel unterschiedlicher Größe angesammelt hatten. Sie lagen knapp unter der Wasseroberfläche, und trotz der Kälte war es angenehm, die seidige, vom Wasser glatt geschliffene Oberfläche der Steine zu berühren.
Während Marie noch spielerisch den einen oder anderen Kiesel in die Hand nahm und mit einem leisen Plumpsen wieder ins Wasser fallen ließ, hatte Ben einen gefunden, den er längere Zeit aufmerksam betrachtete. Dann reichte er ihn der jungen Frau. »Schau mal, Marie, woran erinnert dich dieser Stein?«, fragte er.
»An ein Haus«, antwortete Marie sofort. Sie legte den eigenwillig geformten Kiesel in ihre Handfläche und betrachtete ihn eingehend. Der Stein war verhältnismäßig flach und hatte eine rechteckige Grundform. Die Seiten seines oberen Drittels liefen aufeinander zu und trafen sich in einer vom Wasser abgerundeten Spitze. Der Kiesel erinnerte tatsächlich stark an die schlichte Vorderansicht eines Hauses mit einem spitzen Dachgiebel.
»Du hast ein Haus gefunden«, sagte Marie und strahlte Ben an. »Und das genau jetzt, wo ich wieder hier bin, und wir den Ebereschenhof umbauen wollen! Mein Zimmermann steigt um Mitternacht in einen Bach und kommt mit einem Haus zurück; wenn das kein gutes Zeichen ist!«
Sie hat mein Zimmermann gesagt, dachte Benjamin erfreut. Er war gerührt von Maries kindlicher Freude an dem überraschenden Fund und mehr noch von ihren Worten mein und wir. Sie vibrierten in ihm wie die leisen Anklänge einer wunderschönen Zukunftsmusik.
Er räusperte sich und deutete erst auf den Kiesel und dann in den Himmel hinauf. »Ich finde es schön, dass du diesen Stein als gutes Zeichen für die Zukunft nimmst«, sagte er. »Aber da wir gerade über Zeichen reden, hast du mal nach oben geschaut?«
»Was meinst du? Oh …!« Maries erstaunte Frage beantwortete sich von selbst. Unbemerkt hatten sich dicke, gewitterschwere Wolken zusammengeballt, die mit aufkommendem Wind immer schneller über den Himmel jagten und den Mond verdunkelten. Noch war er als unvollständige, blasse Scheibe zu erkennen, aber die Wolkendecke wurde zusehends dichter. In weiter Ferne jenseits des Dorfes flackerte erstes Wetterleuchten.
»Jetzt aber rasch!«, drängte Marie. Mit drei, vier Schritten hatte sie das Ufer erreicht und trat auf den sicheren Wegesrand. »Wie gut, dass wir schon so weit gelaufen sind!«, sagte sie und streifte hastig ihre Sandalen über.
Auch Ben war schnell in seine Schuhe geschlüpft. »Wir haben nur noch den Hang vor uns, auf dem dein Hof liegt; das schaffen wir, ehe das Gewitter losbricht.«
Wie selbstverständlich ergriff Marie seine Hand, und die beiden machten sich eilig auf den Rest des Heimwegs. Aus einem romantischen Mondscheinspaziergang wurde nun ein hastiges Voranstolpern über eine Wiese mit unebenem Grund und hohem Gras. Heftige Windböen, die Marie immer wieder die Haare ins Gesicht trieben, und vor allem die Finsternis erschwerten das schnelle Gehen. Wegen der dicken Wolkendecke erhellten weder Mond noch Sterne die Landschaft, und weit und breit standen keine Häuser mit erleuchteten Fenstern oder Eingängen. Dennoch war Marie nicht verängstigt, im Gegenteil, sie konnte diesem energischen Ausschreiten und immer wieder Stolpern sogar eine komische Seite abgewinnen. »Wie gut, dass diese Grünfläche jetzt nicht beweidet ist. Stell dir vor, wir hätten zwischen den Rindviechern hindurch gemusst!«, kicherte sie.
»Ganz großartig wäre eine Schar Jungbullen gewesen und die noch nervös gemacht durch das aufziehende Wetter!«, spann Benjamin den Faden weiter.
»Ja, das wäre dann wie im Film gewesen«, japste Marie, ein wenig atemlos vom raschen Anstieg. »Der Mann lenkt die Viecher ab, und die Frau rennt mit flatternden Röcken um ihr Leben.«
»Was?! Und überlässt den armen Helden seinem Schicksal? Herzloses Weibsstück!«, tat Ben empört. Er warf ihr aus lachenden Augen einen Blick zu. »Außerdem trägst du gar keine Röcke sondern Shorts.«
»Und du bist kein Held«, konterte Marie grinsend.
»Ach, nein? Dann zeig doch mal, wie du allein in der Dunkelheit nach Hause kommst!«, rief Ben und ließ ihre Hand los.
»Gern, du verhinderter Held! Das hier ist nämlich meine Wiese, und ich kenne jedes Grasbüschel!«, antwortete Marie lachend und setzte zum Endspurt an. Es waren nur noch wenige Hundert Meter bis zum Hofplatz, und die junge Frau war schnell. Nicht nur das Gewitter, auch der Spaß an der harmlosen Kabbelei mit Benjamin trieb sie an. Als mit einem gewaltigen Donnerschlag der Himmel aufriss und seine Regenfluten freisetzte, spurtete sie gerade über den gepflasterten Hofplatz und warf sich unter dem schützenden Vordach gegen die Hintertür. Kurze Zeit später stand Benjamin neben ihr, schwer atmend vom Endspurt und mit dem feuchten Schimmer des Sommerregens auf Haut und Haaren. Lachend platzten beide in die einladende Küche hinein und ließen sich am Esstisch auf die Bank fallen.
»Und? Brauche ich nun einen ritterlichen Helden, der mich sicher nach Hause geleitet?«, grinste Marie den Zimmermann an.
»Jede Prinzessin sollte einen Ritter haben«, antwortete Ben mit einer Stimme, die noch tiefer klang als gewöhnlich.
Maries Herz machte einen Satz.
Aber sie antwortete: »Dann ist es ja gut, dass ich keine Prinzessin bin!« Mühsam löste sie sich aus Benjamins intensivem Blick, stand auf und bewegte sich zu den Fenstern hinüber, um dort die Lampen anzuzünden. Sie starrte hinaus in den heftigen Regen. »Wie, äh, wie kommst du jetzt wieder nach Bergmoosbach zurück?«, überlegte sie laut.
Benjamin betrachtete ihren schmalen Rücken und die Wolke dunkler Haare, die ihre Schultern umspielten. Wo führt das hin?, dachte er erstaunt. Ich kenne sie doch erst seit kurzem und dennoch fühle ich mich mit ihr verbunden, als wären wir uns vor einer Ewigkeit schon begegnet.
Er räusperte sich irritiert und schlug dann vor: »Vielleicht kannst du mir deinen Wagen leihen? Ich bringe ihn dir in der Früh zurück. Mein Freund Niklas kommt mit, und mit seinem Wagen fahren wir dann weiter.«
Marie drehte sich um und musterte ihn nachdenklich. »Dieser ganze Aufwand lohnt sich doch kaum. Außerdem hast du bestimmt noch Alkohol im Blut, sodass du nicht fahren solltest, besonders nicht bei diesem Wetter. Wenn du möchtest, kannst du gern hier bleiben.« Sie schaute Ben nicht in die Augen, sondern fixierte einen Punkt haargenau über seinem linken Ohr. »Ich fahre dich dann morgens ins Dorf hinüber.«
Benjamin räusperte sich schon wieder. »Du meinst, ich kann über Nacht bei dir bleiben?«
»Ja. Im Haus sind so viele freie Zimmer, die auf Besucher warten. Betrachte dich als meinen ersten Gast«, antwortete Marie. Sie hatte jetzt wieder zu mehr Sicherheit zurückgefunden und lächelte Ben an. Die kleine innere Stimme, die sie davor warnte, einen eigentlich Fremden zum Übernachten ins Haus zu holen, hatte sie kurzerhand zum Schweigen gebracht.
»Dann nehme ich gern an«, antwortete er. »Es waren ein langer Tag und eine lange, schöne Nacht. Aber nun habe ich auch nichts dagegen, mich schlafen zu legen.«
»Fein, dann gehen wir nach oben«, sagte Marie scheinbar ganz unbefangen. Sie löschte die Lampen in der Küche, holte frisches Bettzeug und Handtücher und zeigte Ben sein Zimmer. »Du kannst gern noch duschen, wenn du magst. Das Wasserrauschen stört mich nicht, mein Zimmer liegt am anderen Ende des Flures.« Sie schaute zu ihm auf. »Es waren ein schöner Tag und ein noch schönerer Abend. Dank dir dafür, Ben. Ich wünsche dir eine gute Nacht.«
»Gute Nacht, Marie«, antwortete er leise.
Ben zog sich ein sein Zimmer zurück. Er öffnete das Fenster, ließ sich aufs Bett fallen, und versuchte, seine Gedanken und Gefühle zu ordnen.
Er empfand Marie als eine außergewöhnliche Frau; außergewöhnlich hübsch und attraktiv und außergewöhnlich empfindlich, ohne aber launenhaft zu sein. Er selbst war ein ausgeglichener, in sich ruhender Mann, und es erstaunte ihn zu erleben, wie schnell sich Maries Verhalten ändern konnte. Zurückhaltung war ein deutlicher Wesenszug, aber offensichtlich auch die Fähigkeit zu kindlicher Freude und zu spontanen Aktionen. Wie offen und glücklich die junge Frau war, als sie im Bach nach Kieselsteinen suchten! Das war ein verzauberter Augenblick gewesen, in dem beide ihre gegenseitige starke Anziehungskraft und Hingabebereitschaft spürten, und sich ihre Herzen für einander öffneten.
Und genau davor war Marie erschreckt zurückgewichen.
War es dieser rätselhafte Fabian, dem sie ihre tief gehende Unsicherheit zu verdanken hatte? Waren die Umstände, welche zum Scheitern der Ehe geführt hatten, so scheußlich gewesen, dass sie lebenslängliche Narben hinterließen? Offensichtlich.
»Hey, unbekannter Fabian!«, sagte Benjamin in das abziehende Gewitter hinaus. »Du magst eure Ehe gegen die Wand gefahren und ihr Leben verdammt schwer gemacht haben, aber ich baue ihr ein Haus! Und ich werde alles tun, damit es ein Zuhause für sie wird!«
Ein letztes Donnergrollen setzte sozusagen ein himmlisches Ausrufungszeichen hinter diesen Satz, dann waren nur noch das sanfte Rauschen des Regens und Bens tiefe, regelmäßige Atemzüge zu hören.
Er schlief ein.
Auch Marie hatte ihr Fenster geöffnet und lauschte in die Nacht hinaus. Das Gewitter war kurz und heftig gewesen; jetzt grollte es nur noch leise in der Ferne, und das Wetterleuchten erlosch hinter dem Dunkel der Nacht.
Die Gedanken der jungen Frau drehten sich im Kreis. War das nun mit Benjamin im Haus, nur ein paar Zimmer entfernt, eine dumme und völlig unmögliche Situation? War ihr Übernachtungsvorschlag unbedacht und leichtsinnig gewesen oder ein Hilfsangebot, das selbstverständlich sein sollte? Jedem Freund hätte man doch ohne zu zögern in dieser Nacht ein Bett angeboten.
Einem Freund schon, flüsterte Maries unbestechliche innere Stimme, aber auch einem Fremden?
Benjamin ist kein Fremder!, antwortete ihr Herz.
Nein, aber er ist auch kein Freund!, entgegnete ihr Verstand.
Noch nicht. Aber wer sagt denn, dass sich das nicht ändern kann? Merkwürdig, das eben hatte so geklungen, als ob Herz und Verstand tatsächlich mit einer Stimme sprechen können.
Unbewusst lächelte Marie, und ihr Blick suchte den Stein, der wie ein Haus geformt war, und der nun gleich einem Talisman auf ihrem Nachttisch ruhte. Zufrieden kuschelte Marie sich tiefer zwischen ihre weichen Kissen und schlief ein.
*
Am nächsten Morgen stieg die Sonne über den Dunst und brachte die nächtliche Feuchtigkeit auf dem Grün der Wiesen und Bäume zum Funkeln. Es waren nur kurze Augenblicke, in denen sich Lichtstrahlen in den Tropfen brachen; vielleicht gerade deshalb besonders schön, weil sie so flüchtig waren. Auch das Dorf wirkte wie reingewaschen, die roten Dächer glänzten, und die goldene Kirchturmspitze leuchtete im Sonnenschein. Die Schulkinder waren in ihre Klassenräume verschwunden, auf vereinzelten Fenstersimsen lag noch das Bettzeug zum Lüften, die Geschäfte öffneten ihre Türen für die erste Kundschaft.
Im Salon Glamour saß eine junge Frau, die für ihre Hochzeit Brautfrisuren ausprobieren wollte. Sie wunderte sich über die seltsam zerstreut wirkende Lisa, welche heute so gar nicht zum üblichen Plaudern aufgelegt war. Mit heftigen Bürstenstrichen zerrte sie die dunklen Haarsträhnen nach hinten und stieß dabei zum zweiten Mal ziemlich heftig mit der Bürste gegen die Schläfe ihrer Kundin.
»Aua! Jetzt pass doch mal auf!«, beschwerte sich die junge Frau.
»Du hast aber auch dicke Haare, die passen richtig zu dir!«, antwortete Lisa zickig.
»Jetzt werd‘ mal nicht unverschämt!« Die Frau, eine rundliche Brünette namens Stefanie, funkelte die Friseurin empört an. »Wenn du mit der Frisur nicht fertig wirst, hast du den falschen Beruf! Vielleicht würde es helfen, wenn du mehr auf deine Arbeit achtest als auf das, was draußen passiert!«
Der Vorwurf war berechtigt, denn andauernd schweifte Lisas Blick von den dunklen Locken unter ihren Händen hinüber zum Fenster. Von hier aus hatte sie den Eingang zu Bens Wohnung im Auge und sie wollte unbedingt mitkriegen, wie er heute früh nach Hause kam!
»Jetzt hab dich nicht so!«, zischte Lisa und rammte die nächste Haarnadel in die aufgetürmten Lockenpracht.
»Was heißt hier: Hab dich nicht so! Beim Probefrisieren will ich Spaß haben und nicht mit der Haarbürste verprügelt werden!«, konterte die aufgebrachte Braut. »Schau halt besser hin!«
Das tue ich doch, du blöde Kuh!, dachte Lisa gereizt. Nach Afras Anruf hatte sie eine schlaflose Nacht verbracht und mit Argusaugen Bens Hauseingang beobachtet. Der Kerl war doch tatsächlich die ganze Nacht über bei Marie geblieben!
Und jetzt parkte Maries Wagen direkt gegenüber, und das Paar, das Paar!, stieg aus. Lisas Augen durchbohrten geradezu die Fensterscheibe!
Marie und Ben standen in sichtlich guter Laune und entspannt einander gegenüber und verabschiedeten sich mit einem langen Händedruck, der schon verdächtig nach Händchenhalten aussah. Wenigsten gibt es keine Umarmung und keinen Kuss, dachte Lisa boshaft, damit solltest du in der Öffentlichkeit auch vorsichtig sein als frisch geschiedene Frau!
Mit einem letzten freundlichen Blick verabschiedeten sich die beiden jungen Leute endgültig von einander, Ben betrat sein Haus, und Marie ging mit beschwingten Schritten hinüber in Fannys kleinen Supermarkt.
Lisa drückte Jeanette die Bürste in die Hand. »Mach du hier weiter, ich muss was besorgen!«, sagte sie knapp und verließ den Salon, ohne sich um den lauten Protest ihrer Kundin zu kümmern. Stefanie hatte absolut nicht vor, sich von einer Auszubildenden für die Hochzeit aufrüschen zu lassen!
Drüben bei Fanny waren schon einige Kundinnen zwischen den Regalen unterwegs. Lisa schnappte sich einen Einkaufskorb, legte wahllos zwei, drei Artikel hinein und stellte sich Marie in den Weg.
»Grüß dich, Lisa!«, sagte Marie freundlich und umarmte die andere Frau. »Schön, dich zu sehen.«
»Ja, ich freu mich auch!«, strahlte Lisa zurück. »Wie geht’s dir denn, und was machst du so früh schon unten im Dorf?«
»Mir geht es gut, und ich habe heute eine Menge zu erledigen. Einkaufen, zum Beispiel. Ich hab ja kaum Lebensmittel im Haus.« Sie deutete in ihren Korb, in dem Lisa Backzutaten, Obst und abgepackten Käse erkannte.
»Erwartest du Besuch?«, fragte sie harmlos.
»Ich weiß nicht, ob ich Handwerker als Besuch bezeichnen würde«, antwortete Marie. »Morgen erwarte ich Fliesenleger und Installateur für die Kostenvoranschläge. Wenn das so lange dauert wie für die Zimmermannsarbeiten, dann möchte ich ihnen schon etwas anbieten können.«
»Dann war der Ben also ziemlich lange bei dir draußen?«, erkundigte sich Lisa.
»Ja, so kann man das sagen«, antwortete Marie mit einem leisen Lächeln, das Lisa ihr am liebsten vom Gesicht gekratzt hätte.
»Und … bist du zufrieden mit ihm? Ist er nett?« Jetzt konnte Lisa den lauernden Tonfall in ihrer Stimme nicht mehr unterdrücken, aber die arglose Marie bemerkte ihn nicht.
»Er ist sogar sehr nett«, antwortete die junge Frau und schaute ihre Freundin offen an. »Aber das weißt du wohl, du kennst ihn ja länger als ich?«
»Ja, hm, ein bisschen. Ben wohnt seit knapp einem Jahr in Bergmoosbach, und da begegnet man sich halt hier und da«, sagte Lisa aalglatt.
Interessiert schaute Marie ihre Freundin an. »Davon musst du mir erzählen«, meinte sie. »Hab ich da vielleicht etwas verpasst?«
»Och, na ja-aa…?«, spielte Lisa die Kindlich-Geheimnisvolle.
»Weißt du, was? Wir machen einfach mal wieder einen gemütlichen Mädelsabend und reden bis nach Mitternacht, genauso wie früher«, schlug Marie vor.
Ehe Lisa darauf antworten konnte, kam Afra um die Ecke und baute sich neugierig vor den beiden jungen Frauen auf. »Bist du denn gestern gut nach Hause gekommen, den ganzen, langen Weg? Und dann noch beim Gewitter!«, erkundigte sie sich mit glitzernden Augen.
»Danke, ja«, antworte Marie nicht unfreundlich, aber deutlich zurückhaltend.
»Ich hab euch gesehen, als ihr losgegangen seid, der Benjamin und du!«, kam ein neuer Vorstoß der älteren Frau. »Und ich hab noch so gedacht, Afra, hab ich gedacht, wenn das nur gut geht mit den jungen Leuten, wo sie doch das Gewitter angesagt hatten! Wann ist er denn zurückgekommen, der Ben?«
Marie schaute Afra gerade in die Augen. »Das fragst du ihn am besten selbst. Ich glaube, du findest ihn drüben in seiner Werkstatt.« Sie wandte sich zu ihrer Freundin und umarmte sie kurz. »Ich muss jetzt los, Lisa. Ich will erst noch rüber zu Doktor Seefeld und dann zur Bank wegen meiner Umbauten. Wegen des Mädelabends telefonieren wir, ja?«
»Sehr gern! Bis dahin, tschau, tschau«, säuselte Lisa, ganz die liebevolle Freundin.
Marie ging rasch zur Kasse, während Afra und die junge Frau noch einen Moment zusammen standen. »Was will sie denn beim Doktor?«, murmelte Lisa halb in Gedanken.
»Na, sich das Rezept holen!«, antwortete Afra mit einem vielsagenden Lächeln.
»Hä? Was für ein Rezept denn?«, fragte Lisa irritiert. Sie mochte wohl eine kleine Intrigantin sein, aber sehr schnell beim Denken war sie nicht.
»Für die Pille natürlich!«, trumpfte Afra auf.
»Habt ihr nichts anderes zu tun, als hier im Weg zu stehen und euch über andere Menschen unausgegorene Gedanken zu machen?«, ertönte plötzlich eine scharfe Frauenstimme hinter ihnen. Traudel Bruckner war unbemerkt von den beiden Klatschmäulern in den Laden getreten.
»Was heißt hier unausgegoren? Benjamin Lauterbach hat gestern gegen Mitternacht mit ihr zusammen den Biergarten verlassen, weil er sie nach Hause bringen wollte. Und heute in der Früh ist er hier aus ihrem Auto gestiegen!«, informierte sie Afra prompt.
»Na und?« Fassungslos schüttelte Traudel den Kopf. »Was bedeutet das? Ihr solltet aufhören, eure Nasen in die Angelegenheiten anderer zu stecken, sonst handelt ihr euch noch gewaltigen Ärger ein!«
»Ich hab doch gar nichts gesagt!«, verteidigte Lisa empört ihre Rolle als alte Freundin.
Traudel warf ihr einen scharfen Blick zu. »Nein, aber gedacht!«, erwiderte sie.
Lisa zuckte in gespielter Unschuld die Achseln und stöckelte zurück in ihren Salon. Afras Augen blitzten neugieriger denn je, sie witterte Ärger! Traudel hievte kopfschüttelnd ihren Korb bei Fanny auf den Tisch. »Man braucht gar kein Buntes Blättchen mehr zu kaufen, ein Besuch in deinem Geschäft reicht völlig!«, meinte sie zu der jungen Frau an der Kasse.
Fanny nickte wissend. »Wem sagst du das!«
*
»Grüß Gott, Frau Höfer! Bitte setzten Sie sich.« Sebastian Seefeld deutete freundlich auf den bequemen Stuhl vor seinem Schreibtisch.
»Grüß Gott, Herr Doktor!« Marie nahm Platz und griff nach ihrer Handtasche.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte der Arzt. Er schaute sie freundlich-prüfend an und bemerkte erfreut, wie ausgeruht und entspannt die junge Frau wirkte.
»Es geht mir sehr gut!«, antwortete sie umgehend. »Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und kann es kaum noch abwarten, dass es endlich losgeht! Und deshalb bin ich gekommen. Ich glaube, dass ich meine Tetanusimpfung auffrischen lassen muss. Man weiß ja nie, was passieren kann, vor allem nicht auf einer Baustelle.«
»Das ist sehr vernünftig!«, antwortete Doktor Seefeld mit Nachdruck. »Gerade den Schutz gegen Wundstarrkrampf verlieren viele aus den Augen, weil er nur alle zehn Jahre aufgefrischt werden muss.« Er studierte Maries Impfpass. »Das sieht alles noch gut aus, nur den Tetanusschutz müssen wir tatsächlich auffrischen, die letzte Impfung ist im Frühjahr zehn Jahre her gewesen. Wenn jetzt keine Erkältung oder andere Infekte vorliegen, können wir Sie gleich impfen.«
»Mir geht es rundum gut«, erklärte Marie.
Der Arzt führte sie in das Behandlungszimmer hinüber. Während er den Impfstoff und die nötigen Utensilien bereit legte, fragte er: »Möchten Sie sich lieber hinlegen oder setzten?«
»Danke, wenn ich sitze, reicht es. Mir wird nicht schwummerig, wenn ich eine Spritze bekomme«, antwortete Marie.
»Spritzen lösen bei vielen Menschen Stress aus und das kann auf den Kreislauf, deshalb frage ich lieber vorher«, sagte Doktor Seefeld und fügte mit einem kleinen Schmunzeln hinzu: »Es sind übrigens meistens Männer, die sich lieber hinlegen, wenn es ums Spritzen geht.«
Routiniert führte der Arzt die Impfung durch. »Heute und morgen keine großen körperlichen Anstrengungen, keinen Sport und keine Sonnenbäder!«, erinnerte Doktor Seefeld seine Patientin.
»Ich denk dran«, antwortete Marie. Sie reckte unternehmungslustig ihr Kinn empor. »Jetzt stehen sowieso erst einmal die ganze Organisation und Gespräche mit Banken und Versicherungen an.«
»Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg!«, sagte Sebastian Seefeld aufrichtig. Er zögerte einen kleinen Augenblick und fragte dann behutsam: »Sie kommen gut zurecht mit allem hier?« Er dachte an den Abend im Biergarten zurück und an das, was eine zornige Traudel über das Gerede im Dorf erzählt hatte. »Sie wissen doch, dass Sie sich an mich wenden können, wenn es Schwierigkeiten gibt?«
Voller Vertrauen schaute Marie den Arzt an. »Ich weiß!«, antwortete sie mit einem Lächeln.
»Unsere dörfliche Gemeinschaft ist etwas sehr Wertvolles, aber manchmal kann sie auch ein wenig …«, er zögerte, »… eng werden.«
Die junge Frau nickte, dankbar für das Verständnis.
»Also, nicht vergessen: wenn es irgendwann hakt, dann melden Sie sich bei uns!« Mit einem freundlichen Händedruck verabschiedete sich der Arzt von seiner Patientin.
Unter der Tür schaute Marie sich noch einmal um und schmunzelte. »Früher, als ich noch ganz klein war, hat die Mutter gesagt: zu unserem Doktor kannst du immer gehen, wenn’s nötig ist, der Seefeld Benedikt kommt ohne feste Sprechzeiten daher!«
Der Arzt lachte. »Und so soll es bleiben, auch wenn jetzt der Seefeld Sebastian daher kommt!«
Die Impfung beeinträchtigte Marie in keiner Weise, und kurze Zeit später war sie unterwegs in die Kreisstadt. Sie hatte einen Termin bei der Bank, wo es um die benötigten Gelder für ihren Umbau ging. Die junge Frau ging gut vorbereitet in das Gespräch, und es gab keine Schwierigkeiten, die veranschlagte Summe zu erhalten. Sehr zufrieden mit dem, was sie im Laufe des Tages erledigt hatte, fuhr Marie nach Bergmoosbach zurück.
Ehe sie auf die Landstraße einbog, die zum Ebereschenhof führte, hielt sie am Wegesrand und pflückte einen Strauß Feldblumen. Sie fand das weiße Hirtentäschelkraut, blaue Ackerglockenblumen, Wiesenmargeriten, wilde Malve und sogar noch prächtig blühenden Klatschmohn. Einzelne lange Gräser vervollständigten diesen sommerlichen Gruß, und sie umwand ihn mit einer langen Efeuranke, die an einem Weidegatter empor gewachsen war.
Mit diesem Strauß in der Hand ging Marie hinüber auf den kleinen Friedhof, auf dem ihre Eltern beerdigt waren. Liebevoll zupfte sie welke Blumen von den blühenden Gräbern, holte frisches Wasser und stellte das Glas mit ihrem Feldblumenstrauß zu ihren Eltern.
»So magst du es doch am liebsten, gell, Mama?«, sagte sie leise. »Ich wollte euch einen Gruß bringen und einen Dank für den Ebereschenhof. Ich musste eine Hypothek aufnehmen und ich weiß, ihr seht es nicht gern, dass jetzt Schulden auf unserem Zuhause lasten. Wir hatten ja darüber gesprochen. Es ist so eigenartig, das jetzt alles allein zu tun, ohne euch. Ihr wisst schon: das Schuldenmachen und Bauen und Abbezahlen, ohne dass wir uns dabei gegenseitig raten und helfen können.« Marie schwieg, und in Gedanken versunken strichen ihre Fingerspitzen über das Stückchen Erde, unter dem ihre Eltern ruhten. Ein ganz vorsichtiges Lächeln erwachte auf ihrem ernsten Gesicht.
»Wisst ihr, so ganz und gar allein bin ich eigentlich nicht. Es gibt da jemanden, der mir eine große Hilfe ist; er heißt Benjamin, aber seine Freunde sagen Ben. Und dieser Ben und ich – ich kann gar nicht sagen, was es genau ist, es ist jedenfalls etwas Besonderes und sehr Schönes.«
Ein leichter Windhauch strich über den friedlichen Ort, ließ die Blätter der Bäume leise rauschen und bewegte die zarten Gräser und blühenden Blumen auf den Gräbern. Es war beinahe wie ein kleines, liebevolles Winken.
Marie erhob sich von den Knien und winkte zärtlich zurück. »Pfiat eich, Mama und Papa! Bald komme ich wieder und erzähle, wie es weitergeht mit dem Hof und – und mit Ben.« Sie warf eine Kusshand hinauf in den Sommerhimmel und ging, zum ersten Mal seit den Beerdigungen, leichten Herzens hinüber zum Ausgang.
»Marie?«, sagte plötzlich eine tiefe Männerstimme hinter ihr.
Eine Stimme, die sie nicht nur durch ihr Gehör wahrnahm, sondern mit ihrem ganzen Körper; samtene Wärme durchflutete sie von Kopf bis Fuß. Atemlos drehte die junge Frau sich um. »Ben? Was tust du hier? Ich …, ich hab dich gar nicht kommen gesehen.«
»Das konntest du auch nicht«, antwortete er. »Ich war dort hinter der Lorbeerhecke und habe die beiden Bänke aufgestellt, welche die Gemeinde bestellt hatte. Und ich finde es sehr schön, dass wir uns getroffen haben, denn ich wollte dich etwas fragen.«
»Lass mich raten«, antwortete Marie und versuchte, ihren Blick von seinen seegrünen Augen abzuwenden. »Du möchtest wissen, für welches Holz ich mich für die neuen Zimmertüren entschieden habe?«
»Nein, das habe ich gerade nicht gemeint«, entgegnete Ben. »Heute ist Vollmond, und es sind keine Gewitter angesagt, sondern wir werden eine sternklare Nacht haben. Ich habe ein kleines Ruderboot auf dem Sternwolkensee. Hast du Lust, heute Nacht auf dem Wasser ein Picknick zu machen?«
Bilder wirbelten durch Maries Kopf, Blau und Silber und Grün, Bens Lächeln, seine Hände, die nach den Rudern griffen, sein Körper, irgendwo in der Dunkelheit auf der Bank hinter ihr, der Geruch des Wassers und darüber Bens Duft, Sandelholz und Zitronengras …
»Ja«, sagte sie atemlos, »ja, ich komme sehr gern.«
Benjamins Herz geriet aus dem Takt. »Ich freue mich«, murmelte er, und irgendwie fanden seine Fingerspitzen ihren Weg zu Maries Gesicht und glitten sanft über die Rundung ihrer Wangen. »Bis dahin, Marie.«
»Bis dahin, Ben«, antwortete sie leise.
*
Der zehnte Glockenschlag vom Kirchturm verhallte in der Nacht. Marie hatte ihren Wagen abgestellt und ging zum Seeufer hinüber. Das Licht des nun vollständig gerundeten Mondes fiel auf die Erde und schuf einen klaren Gegensatz von Helligkeit und scharf umrissener Dunkelheit. Die wenigen Hundert Meter vom Auto zum Uferrand ging Marie rasch und ohne zu stolpern, das silbrige Licht wies ihr den Weg.
Gegen jede Stimme der Vernunft (es wird kühl sein, die Mücken werden dich plagen, auf dem Wasser geht immer ein leichter Wind) hatte Marie sich nicht für praktische Jeans und eine warme Strickjacke entschieden. Sie trug ein langes Sommerkleid aus weich fließender Seide, ärmellos und von dünnen Trägern auf den Schultern gehalten. Seine Farbe war ein sanftes Elfenbein, und in diesem Licht leuchtete es wie zum Leben erwachter Mondschein. Gegen die Kühle trug Marie einen Samtschal, so groß wie ein Plaid, in den sanften Farben einer blühenden Heidelandschaft über dem Arm. Ihre Haare spielten wie eine dunkle Wolke um ihre Schultern. Als einzigen Schmuck trug sie eine herrliche, alte Duftrose, die sie mit einem Schleifenband am linken Handgelenk befestigt hatte.
Benjamin, der am Boot gewartet hatte, stockte der Atem. Mit diesem Kleid und in dem unwirklichen Licht des Mondes wirkte die junge Frau wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Er nahm ihre Hand und sagte: »Du siehst wunderschön aus, Marie. Fast schon beängstigend schön. Bist du sicher, dass du nicht nur Licht und Duft einer Rose bist und dich im nächsten Windhauch verflüchtigen wirst?«
»Oh!« Verunsichert schaute Marie zu ihm auf. »Du …, du meinst, ich bin nicht richtig angezogen für eine Fahrt mit dem Ruderboot?«
Ben hätte sich auf die Zunge beißen mögen! Seine romantischen Worte waren ihm einfach so durch den Kopf gegangen; dass sie missverstanden werden könnten, daran hatte er nicht gedacht. »Nein, überhaupt nicht!«, sagte er hastig. »Du bist wunderschön angezogen und genau richtig! Sieh nur …«, er wies auf das kleine Ruderboot, welches am hölzernen Steg lag. Maries Augen weiteten sich vor Überraschung: Benjamin hatte aus einem schlichten Ruderboot einen verzauberten Nachen wie aus einem alten Märchen gemacht.
Der Boden war mit einem Teppich in pflaumenblauen, burgunderroten und brombeerfarbenen Mustern belegt. Auf den beiden schmalen Ruderbänken lagen weiche Decken und Kissen, ein Weidenkorb mit einer blütenweißen Spitzentischdecke war mit Delikatessen gefüllt, und entlang des Bootrandes hatte Ben winzige gläserne Laternen befestigt, in denen Teelichte brannten.
»Es ist wunderschön!«, sagte Marie hingerissen. Sie konnte kaum glauben, dass jemand, der aussah wie ein Wikingerfürst und tagtäglich ein schweres Handwerk ausübte, einen so märchenhaften Rahmen für ein Picknick gestaltet hatte. »Ich bin einfach überwältigt! Mit etwas so Fantasievollem habe ich nicht gerechnet.«
»Tja, eines der unbekannten Talente des Benjamin Lauterbach«, antwortete er augenzwinkernd und griff nach ihrer Hand. »Möchtest du denn jetzt einsteigen?« Ben half ihr ins Boot hinein, was sich als etwas wackelige Angelegenheit entpuppte. Aber nachdem beide ihren Platz eingenommen hatten und der Mann die Ruder ins Wasser tauchte, blieb das Boot im Gleichgewicht, und mit ruhigen, kräftigen Bewegungen lenkte Ben das Gefährt auf den See hinaus.
In der Stille der Nacht war nur das gleichmäßige Eintauchen der Ruderblätter ins Wasser zu hören. In weiter Ferne konnte man noch erleuchtete Fenster als kleine Lichtpunkte ausmachen, ansonsten versilberte der Mondschein die Wasseroberfläche. Marie saß auf der vorderen Bank und hatte Ben den Rücken zugekehrt. Wenn er sich vorbeugte, um die Ruder durchs Wasser zu ziehen, strichen seine Arme sehr dicht an ihr vorbei, und seine Brust berührte fast ihren Rücken. Sie spürten jeden seiner tiefen, gleichmäßigen Atemzüge im Nacken. Es war wie im Traum, wirklich und unwirklich zugleich, und in seiner Nähe, in dieser Beinahe-Umarmung fühlte Marie sich geborgen wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Bis in alle Ewigkeit hätte sie so sitzen mögen und war fast ein wenig enttäuscht, als Ben langsam die Ruder einholte und das Boot treiben ließ.
»Möchtest du jetzt etwas von unserem Picknick probieren?«, fragte er sie.
»Gehört das, was du in den Korb gepackt hast, auch zu den unbekannten Talenten des Benjamin Lauterbach?«, erkundigte sich die junge Frau.
»Lass dich überraschen!«, antwortete Ben. Vorsichtig, um das Boot nicht zum Kentern zu bringen, stellte er den Korb zwischen die beiden Bänke und half Marie, sich anders hinzusetzen. Dann schenkte er tiefroten Wein ein und ließ sein Glas sacht gegen ihres klingen. »Auf uns!«, sagte er leise.
»Auf uns!«, flüsterte Marie.
Ihre Haut schien im Mondlicht zu schimmern, und ihr Mund hatte dieselbe Farbe wie der edle Wein. Sie duftete nach der Rose an ihrem Handgelenk, und sie schmeckte nach Sommer und süßen Trauben, und Benjamin verlor sich in ihr und er wusste, dass es für immer war.
*
Die nächsten Tage und Wochen waren erfüllt von harter Arbeit, dem Überwinden vieler Hindernisse, mit denen man beim Bauen rechnen muss, und dem stillen Wachsen ihrer Liebe. So fantasievoll, wie Ben das Picknick auf dem See gestaltet hatte, so liebevoll umwarb er weiterhin die Frau, der bereits sein ganzes Herz gehörte. Viel freie Zeit blieb ihnen nicht, sodass Stunden für Kinobesuche, fürs Essen gehen oder Ausflüge in die Umgebung selten und kostbar waren.
Aber mussten es denn immer die großen Dinge sein?
Wenn Marie zum Frühstück hinunter in die Küche kam, konnte ein Herz aus taufeuchten Brombeeren auf dem Fensterbrett liegen.
Sie erzählte von einem Lieblingsbuch, das sie in Frankreich hatte lassen müssen und das jetzt vergriffen war. Ben verbrachte zwei Nächte vor dem Computer, bis er es gefunden hatte und kaufen konnte. Eines Tages lag es in ihrem Lieblingssessel, und Ben hatte ein Seidenband in der Farbe von Maries Augen als Lesezeichen zwischen die Seiten gelegt.
Als sie eines Abends so müde war, dass sie kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen konnte und auf den Wäscheplatz taumelte, da lagen alle getrockneten Laken, Decken und Handtücher bereits säuberlich gefaltet im Korb und obenauf die schönste Rose ihres Gartens.
Das alles rührte Marie, und sie verwahrte diese kleinen Liebesbeweise als Schatz in ihrer Erinnerung.
*
»Du hast es richtig gut!«, stellte Lisa fest, als sie sich endlich zu ihrem Mädelsabend getroffen hatten. Es gelang ihr, den Neid in ihrer Stimme zu unterdrücken. Stattdessen lächelte sie so, wie jemand lächelt, der sich für jemanden freut.
»Ja, das habe«, antwortete Marie.
Sie war eindeutig keine Plaudertasche, wie Lisa hatte feststellen müssen! Und über intime Details sprach sie schon mal gar nicht.
»Und? Wie geht’s jetzt weiter mit euch? Hört man schon die Hochzeitsglocken läuten?«, bohrte Lisa weiter.
»Wie bitte?« Marie errötete, ohne es selber zu bemerken. »Was du nur wieder denkst! Das ist mir viel zu wichtig, als dass ich es überstürzen würde! Den Mann, den ich heirate, muss ich durch und durch kennen, und ich muss ihm vertrauen können.«
Lisa spielte mit ihrem Glas Prosecco und warf ihrer Freundin einen langen, forschenden Blick zu. Dann nickte sie in gespieltem Ernst. »Ja, das kann ich gut verstehen. Nach den Erfahrungen, die du gemacht hast! Und Ben ist ein so toller Mann, da ist ein bisschen Vorsicht vielleicht gar nicht verkehrt.«
Marie horchte auf. »Was meinst du damit?«
Lisa produzierte den allerbesten Unschuldsblick, zu dem sie fähig war. »Na ja, ich mein ja nur …, schau ihn dir doch an, den Benjamin. Das ist doch wirklich ein Prachtkerl. Und bestimmt sehen das andere Frauen genauso. Hast du dich eigentlich noch nie gefragt, weshalb er mit Mitte Dreißig noch nicht verheiratet ist?«
»Es hat sich halt nicht ergeben«, antwortete Marie zögernd. »Vielleicht war die große Liebe noch nicht dabei?«
»Oder er ist ein Mann, der sich nicht festlegen will!«, erwiderte Lisa. Sie beobachtete Maries nachdenkliches Gesicht, die Hände, die zerstreut mit dem Lesezeichen spielten. »Das kennen wir doch alle«, setzte sie zutraulich hinzu. »Es gibt Männer, die haben ein Herz aus Gold, aber warum sollen sie das einer einzigen Frau schenken, wenn sie an jedem Finger zehn haben können?«
Maries dunkle Augen begegneten ihrem Blick offen und ohne Arg. »Sag, wie gut kennst du den Benjamin eigentlich?«
»Och …« Lisa zwirbelte eine Haarsträhne zwischen den Fingern und klimperte mit den Wimpern. Jetzt nur nichts Falsches sagen! »Also nicht, dass da mal zwischen uns was Festes war. Man kennt sich halt, sieht sich hier und da, geht zusammen was trinken oder tanzen, wenn es sich so ergibt«, antwortete sie vage. Sie musste den richtigen Weg finden, Marie zu beunruhigen, ohne konkret zu werden. »Weißt du, ist das nicht ein bisschen wie bei Fabian? Er sah doch auch so gut aus, war charmant, bei den Frauen beliebt – genau wie Ben. Und war er damals nicht auch schon in diesem Alter und noch ungebunden?«
Marie schaute sie mit einer Mischung aus Erschrecken und Abwehr an. »Ich finde nicht, dass man Benjamin und Fabian miteinander vergleichen kann!«, sagte sie.
»Natürlich nicht, so direkt habe ich das auch nicht gemeint!«, erklärte Lisa. Sie stellte ihr Glas zur Seite, rutschte zu ihrer Freundin in die Sofaecke und legte den Arm um ihre Schultern. »Natürlich ist Ben nicht so ein Hallodri wie Fabian! Mir ist da halt nur aufgefallen, dass beide sich mit Mitte Dreißig noch nicht gebunden hatten und zumindest bei Fabian wissen wir, warum. Das kann bei Ben doch ganz anders sein! Wenn er sagt, dass er die Richtige bisher noch nicht gefunden hat …« Aufmunternd klopfte sie ihrer Freundin auf die Schulter. »Komm, lassen wir uns unseren Mädelsabend nicht durch so ernste Gespräche verderben! Gib doch mal die Schokolade rüber, und dann lass uns endlich unseren Film gucken.«
Marie nickte. Sie griff nach der Schale mit den Süßigkeiten, legte die DVD ein und versuchte, sich auf den Film zu konzentrieren, aber immer öfter schweiften ihre Gedanken ab.
War etwas Wahres dran an Lisas Worten? Gab es tatsächlich Ähnlichkeiten zwischen Benjamin und ihrem Ex-Ehemann? Und was sagte das über sie selbst aus? – Wählte sie unbewusst Männer aus, die sie automatisch enttäuschen würden? Musste sie noch vorsichtiger sein? Irgendwann verlor Marie den Anschluss an den Film und hing nur noch ihren Gedanken nach. Sehnsucht nach Geborgenheit, Sehnsucht nach Benjamin stritten in ihrem Herzen mit der Angst vor neuer Enttäuschung und der Furcht, wieder eine falsche Entscheidung zu treffen. Waren ihre Gefühle für Ben bereits zu tief? War sie in ihrer Beziehung zu ihm schon zu weit gegangen?
Lisa war ganz in der Geschichte mit Herz, Schmerz und großer Liebe aufgegangen und vergoss Tränen der Rührung, als sich das Paar endlich in den Armen lag. »Ist das nicht süß?«, schniefte sie und tupfte um ihre wasserdichte Wimperntusche herum. »Was die für eine Hochzeit hatten!«
Marie antwortete mit einem halben Lächeln und begann, Gläser und Schalen zusammen zu räumen. Ihre Freundin gähnte herzhaft, zwängte die Füße zurück in ihre High Heels und stöckelte zur Tür.
Lisa fühlte sich sehr gut, das war doch mal ein netter Abend gewesen: Film, Prosecco, Naschkram und eine verunsicherte Marie.
*
Einiges von dem, was ihre vermeintliche Freundin erzählt hatte, blieb wirklich in Maries Bewusstsein haften. Sie grübelte nicht ständig darüber nach, aber irgendwo begann sich ein dunkler Bodensatz abzusetzen, der die unbeschwerte Freude an ihrer neuen Liebe allmählich zu trüben begann.
Abends, wenn die anderen Handwerker nach Hause fuhren, blieb Ben noch lange auf dem Ebereschenhof. Er führte seine Arbeiten weiter, und später saßen Marie und er bei leckerem Essen noch stundenlang in der Küche zusammen oder draußen in dem alten Bauerngarten, der sich ans Haus anschloss.
Der Sternenhimmel wölbte sich über dem schlafenden Land, im Garten hatte Marie Windlichter angezündet, und sie saß in der alten Laube neben Ben, eingekuschelt in seine Umarmung. Beiden waren müde vom Tag, zufrieden mit der geleisteten Arbeit und bereits sehr schläfrig.
Ben vergrub sein Gesicht in ihren duftenden Haaren und murmelte: »Schön wär’s, jetzt nicht mehr fahren zu müssen, sondern hier zu bleiben und sich einfach neben dir schlafen zu legen und morgen früh zusammen mit dir aufzuwachen.«
Marie antwortete nicht sofort, aber Ben bemerkte, wie sich ihr Körper in seinen Armen versteifte. Ein wenig nur, aber es war eben doch eine winzige Abwehrbewegung. War es zuviel Nähe, die er sich von der jungen Frau wünschte? Ben unterdrückte einen Seufzer. Manchmal schien dieser windige Fabian wie eine Mauer zwischen ihm und Marie zu stehen.
Er strich zärtlich über Maries Haare und hob ihr Gesicht zu sich empor. »Du hast bisher nicht viel über deine Ehe gesprochen. Meinst du nicht, dass es jetzt an der Zeit ist, mir mehr davon zu erzählen? Ich würde gern wissen, womit er dich so verletzt und misstrauisch gemacht hat.«
Die junge Frau suchte seinen Blick und fand darin nichts als aufrichtige Zuneigung. »Einzelne Begebenheiten kann ich dir nicht aufzählen«, begann sie zögernd. »Es war einfach von Anfang an ein falsches Leben – und ich habe es nicht bemerkt. Ich hätte gern ein Kind bekommen, aber Fabian wollte keins. Er meinte, es sei zu früh; ich sollte für ihn, seine Firma und sein großes, gastliches Haus da sein. Später habe ich erfahren, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits Vater war, und ein Jahr nach unserer Hochzeit hat er noch ein Kind bekommen! Von einer weiteren Frau. Er hat mich systematisch belogen und betrogen, und ich habe nichts davon gewusst.
Außerdem hat er sehr viel Geld unterschlagen und seine eigene Firma in den Bankrott getrieben. Eines Tages war er verschwunden, ganz einfach so, von heut auf morgen weg. Ich habe natürlich die Polizei eingeschaltet und damit den Stein ins Rollen gebracht.«
Marie saß jetzt sehr aufrecht auf der Bank, unbewusst hatte sie ihre Hände zu Fäusten geballt, und ihr Blick war dunkel vor Zorn. »Kannst du dir auch nur entfernt vorstellen, was das für mich bedeutet hat? Vor welchem Trümmerberg ich stand? Der Justiz beweisen zu müssen, dass ich von seinen Machenschaften nichts gewusst habe? Wir waren verheiratet, und per Gesetzt war ich für seine Schulden mitverantwortlich! Auf gefälschten Dokumenten hatte er mir die Firma überschrieben, sodass ich für die Folgen seines Bankrotts aufkommen sollte! Alles Bargeld, alle Wertpapiere waren mit ihm verschwunden. Ich stand buchstäblich nicht nur vor dem Nichts, sondern auch vor einem Schuldenberg in Millionenhöhe, den ich nie im Leben hätte abtragen können.
Zum Glück glaubte man mir irgendwann meine absolute Ahnungslosigkeit, und die Justiz begann zu ermitteln. Dabei konnte bewiesen werden, dass ich die belastenden Papiere nie unterschrieben hatte! Es waren alles Fälschungen. Trotzdem dauerte es Jahre, in denen ich mehr schlecht als recht überlebte, bis eindeutig bewiesen war, dass ich mit dem betrügerischen Bankrott nichts zu tun hatte, und wir in seiner Abwesenheit geschieden werden konnten. Interpol ist ihm auf den Fersen, es gibt Spuren von ihm in Südamerika.
Ich wollte nicht eher in die Heimat zurückkehren, als bis jeder Schatten eines Verdachts von mir abgewaschen war. Jahre habe ich für den reinen Überlebenskampf gebraucht und den habe ich gewonnen! Aber was er meiner Seele angetan hat, das schlummert immer noch in mir.«
Ben hatte ihr schweigend zugehört. Er musste ein paar Mal tief Atem holen, um ruhig antworten zu können. »Es ist unfassbar, was er dir angetan, Marie! Wenn ich ihn jetzt in die Finger bekäme …, ich könnte für nichts garantieren! Dieser Mistkerl hat dein Leben zerstört und nachhaltig dafür gesorgt, dass du es sehr schwer hast, wieder irgendjemandem zu trauen.«
»Oder zu lieben«, fügte Marie mit dünner Stimme hinzu. Sie konnte Benjamin jetzt nicht in die Augen schauen. »Fabian hat gesagt, dass er mich liebt. Bis zu der Stunde, in der er zum letzten Mal vor mir stand, hat er es gesagt. Und ich habe es ihm immer geglaubt.«
»Marie, bitte, wenn es dir hilft, deinen Frieden zu finden, dann verspreche ich dir, dass ich niemals sagen werde, dass ich dich liebe!«, rief Ben verzweifelt aus.
Das klang so absurd, dass Marie ungewollt lachen musste. Es war ein Lachen unter Tränen, aber es kam aus einem Teil ihres Herzens, der bisher verstummt gewesen war. »Du!«, sagte sie. Sie nahm sein Gesicht zwischen beide Hände und verlor sich in seinem Blick. »Du«, wiederholte sie leise, »du bist etwas ganz anderes. Dir vertraue ich. Glaubst du, sonst hätte es unsere Nacht auf dem Sternwolkensee gegeben? Wenn ich dich anschaue und du mich in deinen Armen hältst, dann fühle ich mich sicher und geborgen.«
»Aber im Alltag nicht so sicher, dass wir zusammenziehen und ein gemeinsames Leben beginnen können?«, fragte Benjamin. In seiner Stimme schwang ein Unterton von Bitterkeit, den er nicht ganz unterdrücken konnte.
Marie schwieg und fühlte sich innerlich zerrissen zwischen ihrer Liebe und überängstlichen Vorsicht. »Ich habe einmal den Fehler gemacht, mich schnell zu binden«, erwiderte sie. »Und ich hatte immer geglaubt, meinem Gefühl trauen zu können. Dieses Gefühl ist nicht mehr da. Es ist, als ob ich über schwankenden Boden gehe und nicht mehr weiß, woran ich mich halten kann. Immer versuche ich, alles aus unterschiedlichen Gesichtspunkten zu sehen und frage mich, welche Wege und Entscheidungen welche Reaktionen bei dir auslösen könnten.«
Ben hörte schweigend und sehr konzentriert zu. Er war betroffen von Maries Gefühlschaos und, wenn er ganz ehrlich sein sollte, auch ein wenig ungeduldig. »Liebste Marie!«, sagte er mit einem tiefen Seufzer. »Was ist das nur für eine komplizierte Geschichte mit all diesem: ich dachte … und dann denkt er, dass ich dachte …! Entschuldige bitte, aber ich finde, du machst es jetzt wirklich unnötig kompliziert! Dabei ist es doch so einfach.«
»Ach, ist es das?«, antwortete Marie verletzt.
»Ja! Ich lie…, äh, …« Er unterbrach sich und fuhr dann mit fester Stimme fort: »Ich mag dich von Herzen gern, und ich vertraue dir, und dir geht es mit mir doch genauso! Bisher verstehen wir uns in allem, was wir tun, als ob wir uns schon ewig kennen! Wir sind ein Paar, das zusammengehört, weil es ganz einfach passt. Wo also ist das Problem?«
»Es …, ich …«, stotterte Marie, »ich weiß nicht, ob es so bleiben wird.«
»Das weiß niemand!«, antwortete Ben hart. Er war müde und abgearbeitet und sein Bein schmerzte an einer Stelle, wo er sich eine kleine Verletzung zugezogen hatte. Dieses Gespräch führte zu nichts, und er wollte jetzt nur noch ins Bett und schlafen. »Du scheinst unserer gemeinsamen Zukunft ja wenig zu trauen! Dann vertrau doch wenigstens der Gegenwart, anstatt auch die immer wieder in Frage zu stellen! Hör auf, ständig einen Schritt nach vorn und wieder zwei zurück zu gehen!««
Marie schluckte. Ihr Blick irrte durch den stillen Garten, in dem die Windlichter warme Lichtinseln bildeten und der vom Duft des blühenden Geißblatts durchzogen war. Es war ein so friedliches Bild, aber … »Wir sitzen hier und streiten?«, fragte sie hilflos.
»Scheint so«, brummte Ben. »Und zwar um nichts und wieder nichts!« Er stand auf und streckte sich, um die Müdigkeit aus seinem Körper zu vertreiben. »Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt fahre. Es war ein langer Tag, und morgen muss ich die neuen Türstürze einpassen. Ich bin früh wieder hier, aber für heute lass uns gute Nacht sagen.«
»Gute Nacht, Ben«, antwortete Marie leise. Sie stand in seiner vorsichtigen Umarmung und hob ihr Gesicht zu ihm empor. Aber er küsste sie nicht.
»Willst du denn noch, dass wir ein Paar sind?«, fragte er.
»Natürlich will ich das!«, rief Marie erschüttert. Und hörte irgendwo in ihrem Kopf die Worte: Aber ich weiß nicht, ob ich dem trauen kann …
Ben nickte leicht, fast so, als ob auch er diese Worte gehört hatte. Sein Abschiedskuss streifte leicht ihren Mundwinkel, und die Wärme seiner Umarmung verlor sich sofort, als er sich abwandte und zu seinem Auto ging. »Gute Nacht, Marie!«
Langsam fuhr er vom Hof, und Marie blieb ratlos und erschöpft allein zurück. In einer hilflosen Geste umarmte sie den Ebereschenbaum neben ihrer Tür und suchte Trost in seiner unerschütterlichen Standhaftigkeit. Mit geschlossenen Augen legte sie ihr Gesicht gegen die kühle Rinde und dachte an Bens Atemzüge und den ruhigen Herzschlag in seiner Brust, den sie eben noch gespürt hatte. Jetzt war er fort, und sie spürte den bitteren Geschmack der Einsamkeit auf ihrer Zunge.
Wahrscheinlich war es tatsächlich zu viel von Ben verlangt, wenn sie Verständnis für ihre wirren Gedanken von ihm erwartete. Es wäre besser, das erst mit einer anderen Person zu besprechen, die Meinung einer Freundin zu hören. Vielleicht wusste Lisa einen Rat, wie sie ihre belastende Vergangenheit hinter sich lassen und unbeschwert ihr Glück mit Ben genießen konnte?
Morgen wollte Marie Doktor Seefelds Angebot annehmen, sich einige der neuen Einbauten anzusehen. Wenn sie schon unten im Dorf war, dann konnte sie auch gleich bei Lisa vorbei schauen. Vielleicht hatte die Freundin Zeit für ein vertrauliches Gespräch.
*
»Hallo!«, rief Emilia fröhlich zu Marie hinüber. Die junge Frau stand vor dem privaten Eingang zum Doktorhaus, und Emilia wollte gerade mit dem Fahrrad losfahren. »Gehen Sie ruhig rein, der Papa und die Traudel warten in der Küche auf Sie.« Sie winkte und war dann um die Ecke verschwunden. Marie betrat das Haus und wurde gleich von der warmen und gemütlichen Atmosphäre eingenommen. Durch die geöffnete Küchentür strömten Sonnenschein und der Duft nach frischem Kaffee in die Diele.
»Kommen Sie, setzen Sie sich zu uns!«, rief Doktor Seefeld und winkte die junge Frau neben sich an den großen Esstisch. »Schauen Sie sich nur in aller Ruhe um, diese schönen Küchenmöbel hat Benjamin Lauterbach entworfen und passgenau für uns eingebaut.«
Obwohl es Marie zunächst peinlich war, sich in den privaten Räumen des Arztes so offensichtlich interessiert umzuschauen, überwand sie ihre Scheu allmählich. Wie schön sich die weißen Möbel mit ihren schlichten Zierleisten und den Glasvitrinen in das alte Haus einpassten! Unter dem großen Fenster war ein weißer Spülstein eingebaut, sodass sich beim Arbeiten ein herrlicher Blick nach draußen ergab. An der linken Wand schlossen sich ein großer Einbauherd, weitere Schränke und Arbeitsplatten an. Die Küche war modern und funktional, der vorhandene Platz bis in den letzten Winkel der Schrägen und Wandvorsprünge hinein perfekt genutzt. Und doch war sie kein kalter Neubau, der nach ganz anderen Gesichtspunkten entworfen worden war als die Bauernküchen früherer Zeiten. Sie hatte Charakter und passte genau in dieses alte Haus und zu dieser Familie, die mit drei Generationen unter einem Dach lebten. Über Maries Gesicht spielte ein zärtliches Lächeln, sie erkannte Benjamins Handschrift. Auch in diesem Haus hatte er verstanden, was den Bewohnern zum Leben wichtig war, und es in seiner Arbeit umgesetzt.
Über den Rand ihres dampfenden Kaffeebechers hinweg schaute sie in die Ecke, in der noch der alte, mit Holz beheizte eiserne Kochherd stand. Die Klappen aus weißer Emaille glänzten seidig, die Griffe und Stangen aus Messing waren poliert, und auf der säuberlich geschwärzten Oberfläche standen eine alte Tonkruke mit einem Wildblumenstrauß und eine große Schale reifer Brombeeren. Es war genauso ein gusseiserner Herd wie der, welcher bei ihr auf dem Ebereschenhof stand.
»Ich habe mir gedacht, dass es so aussehen würde«, sagte Marie zufrieden. »Ben weiß, was er tut. Er versteht, was zu den Menschen und ihren Häusern passt.«
»Kommen Sie mit nach oben, dort hat er auch für Einbauschränke gesorgt, die den Charakter dieses alten Hauses nicht verändern«, lud Sebastian die junge Frau ein.
Marie folgte dem Arzt ins Treppenhaus, wo Benjamin tote Winkel und Ecken genutzt hatte, um Stauraum zu schaffen. Auch hier wirkte seine Arbeit nicht fremd und störend, sondern sie fügte sich harmonisch in das alte Haus ein.
Sebastian Seefeld wies auf sein schönes Zuhause und sagte lächelnd: »Sie sehen also, dass auch Ihr Ebereschenhof in den besten Händen ist.«
»Ja, das ist er«, antwortete Marie.
Ihr Blick streifte noch einmal durch den Raum und blieb auf einem Bild im Silberrahmen hängen, das offensichtlich einen Ehrenplatz unter vielen Familienfotos hatte. Es zeigte Sebastian Seefeld und seine Frau Helen bei ihrer Hochzeitsfeier, das Paar tanzte mit einander. Es war ein wunderhübscher Schnappschuss, der einen Moment tiefer Übereinstimmung und glücklicher Sorglosigkeit festgehalten hatte. Ein Windstoß hatte eine seidige Haarsträhne über Helens lachende Augen geweht, ihren Schleier erfasst und in einem eleganten Bogen um die Gestalt ihres Mannes gelegt. Das Paar tanzte im warmen Abendsonnenschein, und das zarte Gespinst des Brautschleiers umhüllte sie beide wie feines, sichtbar gewordenes Band, das ihre Liebe um sie gewoben hatte.
Marie wandte ihren Blick ab. »Sie haben sie verloren«, sagte sie leise.
Sebastian schaute zwischen dem Foto und der jungen Frau hin und her. Marie stand im Schatten der halb geöffneten Tür, aber der Landdoktor konnte ihren ernsten Gesichtsausdruck erkennen. Er sah auch die Blässe und die bläulichen Schatten unter ihren Augen, die ihm als Arzt bereits beim Kaffeetrinken in der Küche aufgefallen waren.
»Marie, wie geht es Ihnen? Ist alles in Ordnung?«, fragte er behutsam.
»Doch, ja, warum fragen Sie?« Marie konnte ihn nicht anschauen.
»Sie wirken ein wenig …«, Sebastian zögerte, »abgespannt?«
Die junge Frau versuchte ein Lächeln. »Das ist kein Wunder, nicht wahr? Bei allem, was jetzt auf dem Hof ansteht. Ich bin einfach sehr müde in der letzten Zeit.«
»Das verstehe ich gut, Sie erleben jetzt eine anstrengende Zeit«, antwortete Sebastian. Aber sein Feingefühl und seine Menschenkenntnis sagten ihm, dass sich noch etwas anderes hinter der sachlichen Antwort der jungen Frau verbarg. Er griff nach ihrem Ellenbogen und drehte Marie behutsam zu sich herum, sodass sie ihm in die Augen sehen konnte. »Aber wenn einmal etwas nicht stimmen sollte, dann sagen Sie es mir, ja? Sorgen können Menschen krank machen, und Sie tragen einiges mit sich herum. Hier im Doktorhaus finden Sie immer jemanden, der Ihnen zuhört.«
»Danke, es tut gut, das zu wissen«, antwortete Marie mit einem kleinen Lächeln. »Aber ich bin wirklich nur müde in der letzten Zeit. Und jetzt muss ich weiter. Ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihr Haus gezeigt haben.«
»Das habe ich gern getan«, antwortete Sebastian freundlich, und dann breitete sich ein Lausbubengrinsen auf seinem sympathischen Gesicht aus. »Allerdings nicht so ganz uneigennützig. Ein Gegenbesuch bei Ihnen und Benjamin auf dem Ebereschenhof wär‘ schon schön. Ich hab da so eine Erinnerung an den Obstler, den der Vater im Herbst aufgesetzt hat …?«
Jetzt lachte Marie. Es klang fröhlich und unbeschwert, und genau das war es, was der Landdoktor hatte erreichen wollen. »Jederzeit, ob Baustelle oder nicht! Bis dahin, Doktor!« Sie verabschiedete sich mit einem festen Händedruck.
Sebastian ging hinunter in seine Nachmittagssprechstunde. Im Flur traf er auf Traudel, die gerade einen Strauß frischer Gartenblumen ins Wartezimmer bringen wollte. »Eben hab ich die Marie lachen gehört und das ist schön«, sagte sie. »Vorhin hab ich mir so meine Gedanken gemacht. Das Madl schaut aus, als ob da noch etwas anderes wäre unter all der Freude und Aufregung wegen der großen Pläne.«
»Hast du das also auch bemerkt«, antwortete Sebastian. Liebevoll musterte er die Frau, die ihn aufgezogen hatte und zu einer Ersatzmutter geworden war. Sie wusste immer, was mit den Menschen los war. »Du hast eben das Herz auf dem rechten Fleck.«
»Vor allem hab ich Augen im Kopf!«, antwortete Traudel resolut. »Das Madl braucht ein bisschen Ruhe. Hoffentlich rennt sie nicht heim und macht sofort weiter mit all dem Räumen und Tragen und Abreißen! Sie sollte sich mal einen netten Nachmittag gönnen.«
»Das tut sie«, antwortete Sebastian, während er in seinen weißen Kittel schlüpfte. »Soweit ich mich erinnere, wollte sie jetzt hinüber zu Lisa Ecker gehen. Es sieht nach einem gemütlichen Nachmittag unter Freundinnen aus, du musst dir also keine Gedanken um sie machen.«
Mit einem freundlichen Nicken verschwand Sebastian in seiner Praxis, und Traudel blickte seufzend auf die geschlossene Tür. »Lisa Ecker? Die selbst ernannte Diva von Bergmoosbach?«, murmelte sie. »Und ob ich mir Gedanken machen muss!«
*
Lisa sah die junge Frau durch die Schaufensterscheibe und beeilte sich, ihr freundlichstes Gesicht aufzusetzen. Jetzt nur nichts Falsches sagen, sondern den Samen des Zweifelns, den sie so hinterhältig in Maries arglose Seele gepflanzt hatte, fleißig weiter wachsen lassen! »Jeannette, mach du allein weiter, ich bin mal kurz weg!«, sagte sie zu ihrer Auszubildenden und ging dann mit ausgestreckten Armen auf ihre Freundin zu. »Marie! Ist das aber schön, dass du vorbeikommst!« Sie verteilte Luftküsschen rechts und links. »Komm, lass uns nach oben in meine Wohnung gehen, und wir machen es uns gemütlich.«
Als die beiden Frauen in Lisas Wohnzimmer saßen, meinte Marie leicht beunruhigt: »Du, ich finde es zwar sehr nett, dass du dir einfach so zwischendurch Zeit nimmst, aber müsstest du nicht eigentlich im Geschäft sein?«
»Wo kommen wir denn da hin, wenn ich nicht mal ein Stündchen für eine Freundin übrig habe!«, posaunte Lisa. »Und ich hab doch gesehen, dass du vom Doktor kommst, und recht blass bist du auch. Ist denn was Schlimmes los bei dir?«
»Nein, gar nicht! Ich war nur drüben, um mir die Arbeiten anzuschauen, die Ben für die Seefelds gemacht hat«, erklärte Marie.
»Dann bin ich ja beruhigt!«, antwortete Lisa und legte scheinbar liebevoll ihren Arm um Maries Schultern.« »Und sonst?«
»Leider nicht so gut«, sagte die junge Frau leise. Sie senkte den Kopf. »Ich weiß nicht, wie es mit Ben und mir weitergehen kann.«
So, so! Gerade noch gelang es Lisa, den lodernden Triumph aus ihrem Gesicht zu verbannen und ihre Stimme besorgt klingen zu lassen. »Aber warum denn, ist etwas geschehen?«, fragte sie heuchlerisch.
»Nichts Bestimmtes«, antwortete Marie sehr leise. Sie war den Tränen nahe. »Es ist nur – meine Gefühle für ihn sind schon viel zu tief, und wenn ich ihn noch mehr in mein Herz und in mein Leben hinein lasse, dann würde ich es nicht ertragen, wenn ich ihn verliere. Ich weiß ja, dass Liebe wehtut, aber von Ben verlassen zu werden daran würde ich zerbrechen. Kannst du das verstehen?«
Nein, das konnte Lisa keineswegs! Überhaupt waren ihr Maries Zaghaftigkeit und Unsicherheit ein Dorn im Auge. Sie fand, die andere Frau hatte einen tollen neuen Fang gemacht und absolut keinen Grund zum Jammern. Lisa schluckte ihre Ungeduld hinunter und antwortete so sanft wie möglich. »Natürlich kann ich das verstehen, bei den Erfahrungen, die du mit Fabian machen musstest! Und wenn Ben auch nur halb so lieb und nett ist, wie er zu sein scheint, dann wird er dafür Verständnis haben, ganz sicher!« Sie suchte Maries Blick und hielt ihn mit ihren blauen Unschuldsaugen fest. »Das hat er doch …, oder etwa nicht?«
»N-nicht so g-ganz«, stammelte Marie unter Tränen. »Er bemüht sich sehr, a-aber er s-sagt, ich mache i-immer einen Sch-Schritt vor und zwei zu-zurück und dass das s-sehr schwer für i-ihn ist.«
»Aber du weißt doch am besten, was du fühlst, und was gut für dich ist«, warf Lisa ein. »Und das ist immer noch besser, als wenn man es nicht merkt.« Sie legte eine kunstvolle Pause ein, so als ob sie sich selbst überwinden müsste, und dann sagte sie: »Weißt du, ich hab das noch nie jemanden erzählt, aber ich bin auch einmal ganz furchtbar von einem Mann betrogen und belogen worden.«
Und nun, da sie Maries Aufmerksamkeit hatte, erzählte sie die ganze schmutzige Geschichte mit Fabian – allerdings sehr verfremdet! Sie nannte keine Namen und machte sich selbst zum ahnungslosen Opfer eines Mannes, der eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit ihr hatte, während er seine Hochzeit mit einer anderen vorbereitete. Wovon sie, die liebende, gutgläubige Lisa, natürlich nie etwas geahnt hatte! Er ging sogar so weit, sich nach der Hochzeit noch mit ihr zu treffen. Erst kurz bevor er mit seiner jungen Frau in ein neues Leben verschwand, flog der ganze Schwindel auf. Er ging ganz einfach und ließ die arme Lisa mit gebrochenem Herzen zurück.
Die junge Frau war von ihrer eigenen Geschichte direkt gerührt und musste sich nicht anstrengen, um ein paar Tränchen zu zerdrücken. Wie beabsichtigt, war Marie tief beeindruckt!
»Du Arme!«, rief sie und umarmte Lisa mitleidig. »Was hast du aushalten müssen! Dieser gemeine Kerl! Wie schrecklich hat er sich dir gegenüber verhalten. Und, entschuldige, wenn ich das jetzt sage, auch gegenüber seiner Ehefrau.«
»Ja, diese Ehefrau …«, murmelte Lisa, und dieses Mal war die Bitterkeit in ihrer Stimme nicht gespielt. Sie konnte Marie kaum anschauen, und beide Frauen saßen eine Weile stumm neben einander.
»Danke, dass du es mir erzählst hast«, sagte Marie endlich. »Du hast also auch bittere Erfahrungen machen müssen. So traurig das auch ist, bestärkt es mich darin, auf mein Gefühl zu hören und mein Herz zu schützen.«
»Willst du dich von Ben trennen?«, fragte Lisa lauernd.
Marie wurde weiß wie eine Wand. »Nein, das will ich ganz gewiss nicht!«, flüsterte sie. »Aber ich kann auch noch nicht mit ihm zusammenleben. Und wenn ihm das mit uns nicht reicht, so wie es jetzt ist –, dann muss das Schicksal entscheiden.«
Na, da kann ich gern nachhelfen!, dachte Lisa triumphierend. Wenn Marie so zurückhaltend blieb, dann würde das bei Ben Tür und Tor für sie selbst öffnen! Sie schluckte einige Male, um ihre Stimme nicht zu schrill und verräterisch klingen zu lassen.
»Das ist mutig von dir, es so langsam angehen zu lassen«, sagte sie schließlich.
»Oder sehr dumm …«, murmelte die andere Frau fast unhörbar.
Da sagst du was!, frohlockte Lisa innerlich. Laut sagte sie: »Bleib bei deinem Gefühl, und alles wird gut! Die Zeit wird zeigen, wie tief seine Liebe und sein Verständnis für dich wirklich sind.«
Marie seufzte. Dann umarmte sie ihre vermeintliche Freundin zum Abschied und sagte: »Wie gut, dass ich mit dir reden konnte, danke!«
»Wir müssen doch zusammenhalten!«, lächelte Lisa. »Wo wir doch beide so böse Erfahrungen gemacht haben und wissen, wie es ist, verlassen zu werden.«
Marie sah jetzt wirklich sehr blass und mitgenommen aus. Sie fühlte sich nicht gut, und das Wort verlassen bohrte sich wie ein gefährlicher Parasit in ihr Herz. Auf einmal hatte sie nur noch den Wunsch, sich im Ebereschenhof zu verkriechen, die Decke über den Kopf zu ziehen und hundert Jahre lang zu schlafen. »Bis bald, Lisa. Wir sehen uns, ja?«
»Tschau, tschau!«, flötete Lisa. Sie schaute der anderen Frau hinterher, als diese mit gesenktem Kopf zum Auto ging. Du willst also das Schicksal entscheiden lassen, du dumme Gans?, dachte sie höhnisch. Da bin ich doch mal sehr gespannt, wie diese Entscheidung ausfällt!
*
»Marie? Hallo? Marie, wo steckst du denn?« In Bens tiefer Stimme schwang ein leiser Ton von Ungeduld mit. Er hatte gesehen, wie die junge Frau auf den Hof gefahren und ins Haus gegangen war. Seitdem waren fast zwei Stunden vergangen. Ben hatte die Arbeit an den neuen Türen und Türstürzen beendet und wollte die nächsten Anschaffungen mit Marie besprechen. Die Zeit drängte, das Sägewerk unten im Ort würde in einer Stunde schließen. »Marie?« Seine Stimme wurde schärfer. Er hatte starke Kopfweh, und sein linkes Bein schmerzte. Bei seinen Arbeiten hatte Ben sich an einem hervorstehenden Nagel verletzt. Es war nichts Dramatisches gewesen, nur eine Fleischwunde an der Wade. Er hatte sie ausgewaschen und mit einem Pflaster versehen, um die Blutung zu stoppen. Da er einen ausreichenden Impfschutz gegen Tetanus besaß, verschwendete er keine weiteren Gedanken an die Wunde. Das Pflaster wurde regelmäßig erneuert, und das war’s. Es tat halt ein bisschen weh, aber deswegen machte man keine Umstände. Nur hatte der Wundschmerz inzwischen zugenommen und sich in ein starkes, regelmäßiges Pochen verwandelt, das sich nicht mehr aus dem Bewusstsein ausblenden ließ. Außerdem litt Ben unter dem Wetter, er fühlte sich unangenehm heiß und war am ganzen Körper von Schweiß überzogen. Am liebsten würde er sich die schwere Arbeitskleidung ausziehen und lange unter die kühle Dusche gehen, dann würden seine Beschwerden rasch verschwinden. Stattdessen musste er ins Sägewerk fahren, dessen kreischende Betriebsamkeit seine Kopfschmerzen nur verstärken würde.
»Marie!«, rief er wieder, jetzt ausgesprochen ärgerlich, und riss mit einem Ruck die Küchentür auf. Dort endlich fand er die junge Frau. Sie saß auf der Bank, hatte die Arme vor sich auf dem Tisch verschränkt und den Kopf darauf gelegt. Wie eine seidige, dunkle Wolke umgab ihr dunkles Haar Schultern und Rücken und verbarg das Gesicht. Sie schlief.
Bens Ärger verflog, als er die Schlafende sah, und er betrachtete sie gerührt. Wie zart und schutzlos sie wirkte und auf eine seltsame, nicht näher zu beschreibende Weise traurig. Er setzte sich leise neben sie und strich behutsam über ihr Haar. »Aufwachen, du kleine Schlafmütze!«, sagte er liebevoll.
»W-was?« Schlaftrunken hob Marie den Kopf und schaute ihn verwirrt an. Allmählich wurde ihr Blick klarer, und sie richtete sich ruckartig auf. »Bin ich etwa eingeschlafen? Das gibt’s doch wohl nicht! Wie spät ist es denn?«
»Es ist fast achtzehn Uhr, Träumerlein«, neckte Ben sie. »Eigentlich zu spät für einen Mittagsschlaf und zu früh, um abends ins Bett zu gehen.«
»Meine Güte, ich bin tatsächlich fest eingeschlafen«, wunderte sich Marie. »Eigentlich wollte ich mich nur ein bisschen hinsetzen und ausruhen, ich war so müde.«
»Macht doch nichts«, erwiderte Ben und strich zärtlich über ihre Wange. »Das Holz für die Fußbodendielen läuft uns nicht weg, das kann ich auch morgen kaufen.«
»Die Dielen! Meine Güte, das hab ich jetzt ganz vergessen. Ich war bei Seefelds und bei Lisa und irgendwie habe ich gar nicht mehr an das Holz gedacht«, erklärte die junge Frau ein wenig schuldbewusst.
»Was wolltest du denn bei Lisa?«, erkundigte sich Benjamin. Er verstand die Freundschaft zwischen diesen so unterschiedlichen Frauen nicht so recht.
»Nichts Bestimmtes, nur einfach vorbei schauen und reden«, wich Marie aus.
»Hm, der Salon Glamour muss ja gut laufen, wenn sie sich einfach einen Nachmittag frei nehmen und mit einer Freundin verbringen kann«, brummte Ben. Er versuchte, unter dem Tisch eine bequemere Position für sein schmerzendes Bein zu finden.
»Sie arbeitet viel und dann kann sie doch auch mal eine Stunde frei nehmen!«, verteidigte Marie ihre Freundin.
»Sicher, soll sie machen, was sie will!«, antwortete er zerstreut. Letztendlich war ihm Lisa egal, er wollte sich nicht über sie unterhalten. Müde lehnte er seinen Kopf gegen das Fenster in seinem Rücken. »Wollen wir für heute Schluss machen? Ich räume noch das Werkzeug zusammen, und dann hätte ich nichts gegen eine kalte Dusche und ein bequemes Bett.«
Marie legte ihre Wange gegen seine, und dann schrak sie leicht zurück. »Ben, du bist ja ganz heiß! Hast du etwa Fieber?« Besorgt musterte sie sein gerötetes Gesicht, das von einem leichten Schweißfilm überzogen war. Seine Augen hatten einen unnatürlichen Glanz, und seine Lippen wirkten sehr trocken. »Natürlich hast du Fieber!«
»Nein, hab ich nicht!«, wehrte er leicht gereizt ab. »Wir haben Hochsommer, und es ist sehr heiß. Kein Wunder, dass ich verschwitzt und rot im Gesicht bin! Warum müsst ihr Frauen eigentlich immer gleich so einen Aufstand machen?«
»Was heißt hier Aufstand? Und von welchen Frauen sprichst du?« Marie fühlte sich von seinen gereizten Worten verletzt, und Ben bemerkte es.
»Entschuldige!«, brummte er. »Ich bin ziemlich fertig und habe üble Kopfschmerzen, wahrscheinlich bin ich deshalb ein wenig gereizt. Eben hast du mich an Senta erinnert, und das mag ich halt gar nicht!«
»Augenblick, bitte! Wer ist denn Senta?«, erkundigte sich Marie überrascht.
Ben seufzte. »Eine Freundin von mir, von früher. Sie war Krankenschwester und wenn ich mal gehustet hatte, dann stand ich kurz vor der Lungenentzündung und sollte ins Bett, um mich auszukurieren. Sie war ziemlich anstrengend, kann ich dir sagen!«
Marie hatte gar nicht richtig zugehört. »Senta …«, wiederholte sie langsam. »Du hast nie von ihr erzählt.«
»Weil es nichts zu erzählen gibt, deshalb! Wir waren mal zusammen, und dann haben wir uns getrennt«, antwortete Ben knapp. Sein Schädel schmerzte zum Zerspringen, und er hatte jetzt keine Lust zum Reden. Schon gar nicht, wenn es um das heikle Thema Ex-Freundinnen ging.
»Wie lange wart ihr denn zusammen?«, fragte Marie prompt.
»Fast sechs Jahre«, kam die Antwort.
»Das ist eine ziemlich lange Zeit für eine anstrengende Freundin!«, bemerkte Marie spitzt.
»Du meine Güte, sie war ja nicht nur anstrengend!«, rief Ben genervt.
Marie schaute ihn aus dunklen Augen an. »Und warum habt ihr euch dann getrennt?«
»Es …, ich …, es war einfach vorbei«, stotterte Ben. Was für eine sinnlose Diskussion! Senta und er waren längst Geschichte, seit über zwei Jahren hatten sie sich weder gesehen noch von einander gehört.
Maries Hände fühlten sich kalt an, sie konnte es spüren. Dafür tobte in ihrem Herzen eine heiße, unberechtigte Eifersucht, gegen die sie nichts tun konnte. Sie musste einfach weiterfragen. »Hast du die Beziehung beendet oder sie?«
»Ich.« Ben klang erschöpft.
»Und warum?« Es ging nicht anders, sie musste es wissen.
»Ach, zum Kuckuck noch mal, was soll das, Marie!«, explodierte Benjamin. »Es war lange vor unserer Zeit! Wen interessiert das denn noch?«
»Mich!«, antwortete sie sofort. »Und zwar sehr! Ich finde es wichtig, diese Dinge aus deiner Vergangenheit zu wissen, Ben! Das hat mit Vertrautheit und Vertrauen zu tun! Also, warum hast du die Beziehung beendet?«
Ben sog scharf die Luft ein. Er konnte sich Maries Reaktion auf seine Antwort gut vorstellen! »Weil es eine andere gab«, sagte er.
Fassungslos schaute Marie ihn an. Mit allem hatte sie gerechnet – damit nicht. »Du …, du hattest eine andere?«, flüsterte sie heiser.
Ben wand sich unter dem Blick aus ihren waidwunden Rehaugen. Was für eine irrwitzige Wendung nahm dieses Gespräch? Am liebsten hätte er gelacht, aber das Lachen blieb ihm im Hals stecken. Er packte Marie bei den Schultern und schüttelte sie leicht. »Merkst du eigentlich, was wir hier tun? Wir reden über Dinge aus der Vergangenheit, die überhaupt keine Bedeutung mehr haben!«
»Keine Bedeutung?«, wiederholte Marie tonlos. »Keine Bedeutung? Du hattest eine andere, das heißt, du …, du hast deine Freundin betrogen!« Hier brach ihre Stimme mit einem herzzerreißenden Schluchzer.
Ben wäre vor lauter Irritation am liebsten aus der Haut gefahren. »Marie, hörst du mir jetzt bitte einmal zu?«, forderte er. »Ich habe Senta nicht betrogen! Ja, wir waren zusammen, und ja, da gab es dieses andere Mädchen, in das ich mich verliebt hatte. Ich habe nicht mit ihr geschlafen, ich habe sie noch nicht einmal geküsst, ehe ich mich nicht von Senta getrennt hatte! Nennst du das etwa betrügen?
Und für Senta ist durch unsere Trennung keineswegs eine Welt zusammengebrochen. Auch sie hatte das Gefühl, dass unsere Beziehung keine Zukunft mehr hatte, und wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Es gab kein Drama, es ging einfach auseinander, und wir haben einander auch nicht schmerzlich vermisst.«
Marie schaute ihn mit einem Blick an, der durch ihn hindurch zu gehen schien. »Wie kalt du darüber sprechen kannst«, flüsterte sie. »Macht es dir denn gar nichts aus?«
»Ach, zum … Marie!« Benjamin antwortete mit einem kräftigen Fluch. »Es ist doch verrückt, was wir hier tun! Du machst mir Vorwürfe, weil und wie ich mich von einer früheren Freundin getrennt habe? Das hat doch überhaupt nichts mit uns zu tun!«
»Hat es sehr wohl!«, widersprach Marie heftig. »Es zeigt mir eine Seite an dir, die ich vorher nicht gesehen, vielleicht aber erahnt habe. Und wenn es nun – auch mit uns auseinander geht? Kann man sich wirklich auf dich verlassen, Benjamin Lauterbach?«
»Das schon wieder!«, rief Ben erbittert aus. »Wie oft sollen wir das denn noch diskutieren? Du wirst immer einen Grund finden, mir zu misstrauen! Mir und wahrscheinlich jedem anderen Mann auf diesem Planeten auch.«
»Wundert dich das etwa?«, antwortete Marie aufgebracht. »Ich spreche nun mal aus bitterer Erfahrung! Und nicht ich allein, auch andere Frauen sind belogen und betrogen worden, da wird man halt vorsichtig. Auch wenn du es nicht verstehen kannst, andere können es; die Lisa, zum Beispiel.«
»Die muss es ja wissen!«, warf Benjamin spöttisch ein.
»Wenn du wüsstest, was sie mir heute anvertraut hat, würdest du nicht so reden!«, antwortete Marie gekränkt.
Müde schüttelte Ben den Kopf. »Ich weiß nicht, welchen Floh Lisa dir ins Ohr gesetzt hat, im Augenblick ist es mir auch ziemlich egal. Ich höre nur immer wieder, dass du unserer Lie…«, er unterbrach sich und fuhr nach einer kleinen, spannungsgeladenen Pause fort, »unserer Beziehung nicht wirklich trauen kannst. Ehrlich gesagt, ich habe davon jetzt genug. Ich will mich nicht zwischen deinen Zweifeln zerreiben lassen!
Lass uns auf Abstand gehen. Vielleicht bist du bald mit dir im Reinen, und vielleicht bin ich dann noch da.«
Langsam stand er auf und ging schwerfällig zur Tür. Dort drehte er sich noch einmal um und schaute mit einem Ausdruck tiefer Trauer zu der jungen Frau zurück. »Natürlich gilt das Abstand nehmen nicht für mich als dein Zimmermann. Ich bin morgen früh wie besprochen hier und arbeite weiter. Gute Nacht, Marie.«
Unfähig, sich zu rühren, unfähig, ein Wort zu sagen, saß die junge Frau am Tisch und starrte auf die geschlossene Tür. Benjamin war fort. Das, wovor sie am meisten Angst gehabt hatte, war nun eingetreten. Ein Band aus Stahl schien sich um ihren Hals zu legen und immer weiter zuzuziehen, sodass sie nicht mehr atmen konnte. Ihr Herz, das bei Bens Worten noch wie wild gepocht hatte, erstarrte zu einem Klumpen Blei und lag untragbar schwer in ihrer Brust.
Mühsam stand sie vom Tisch auf und schleppte sich nach oben in ihr Zimmer. Wie fremd es ihr auf einmal erschien, kalt und leblos. Sie spürte Bens Abwesenheit in jeder einzelnen Zelle ihres Körpers und an jeder Stelle ihres Hauses, das nun kein Zuhause mehr für sie war.
Wie erstarrt lag sie auf ihrem Bett und starrte blicklos in die aufziehende Dunkelheit. Den Stein, ihren Stein hielt sie fest umklammert in der Hand. Er war das Symbol für eine glückliche Zukunft gewesen, und sie hatte es geliebt, ihn in die Hand zu nehmen und zu spüren, wie sich ihre Körperwärme auf den Stein übertrug und ihn erwärmte, ihn wie lebendig erscheinen ließ.
Heute blieb er kalt und leblos, einfach nur ein bizarr geformter Stein ohne besondere Bedeutung. Wie hatte sie nur jemals ein Haus in ihm erkennen können?
Stunde um Stunde lag Marie schlaflos, reglos im Bett und versuchte, ihren Verlust und ihre Einsamkeit auszuhalten. Erst als sich die Morgenröte am Himmel abzeichnete, fiel sie in einen abgrundtiefen Schlaf der Erschöpfung.
*
Auch Ben erlebte keine gute Nacht.
Langsam war er nach Bergmoosbach gefahren, wie betäubt von seinen eigenen Worten. Hatte er das eben wirklich gesagt? Hatte er sich tatsächlich von Marie getrennt?
Von der Frau, die er von ganzem Herzen liebte?
Das Gespräch auf dem Ebereschenhof verlor sich im Nebel seiner körperlichen Schmerzen. Ihm war unsagbar heiß, und seine Haut fühlte sich an, als sei sie zu klein geworden für den Körper, der darunter steckte. Es war höchste Zeit für eine kalte Dusche und frische, leichte Kleidung und vielleicht auch für die eine oder andere Schmerztablette. Ben gehörte zu den Menschen, die Medikamente nur sehr selten und dann widerstrebend einnehmen, aber jetzt waren sie nötig, das spürte er.
Aufatmend hielt er vor seinem Haus. Endlich! Das Gehen bereitete ihm Schwierigkeiten, und die Berührung des schweren Stoffes seiner Arbeitshose auf seinem verletzten Bein war höllisch unangenehm. Trotzdem klammerte er sich an diesen körperlichen Schmerz, denn er hielt ihn aufrecht. Er hielt den seelischen Schmerz in Schach, der zusammengekauert in Bens Herz lauerte und nur darauf wartete, dort zu explodieren und es in tausend Stücke zu zerreißen.
Als Ben am nächsten Morgen aufwachte, ging es seinem Kopf und seinem Bein nicht besser, obwohl er für ausreichend Ruhe und Kühlung gesorgt und ein starkes Schmerzmittel genommen. Hunger verspürte er zwar keinen, aber er zwang sich, ein kleines Müsli zu essen, um eine Grundlage für die nächsten Medikamente zu schaffen
Lange starrte er auf die beiden weißen Tabletten in seiner Handfläche. »Warum nur gibt es keine Medizin gegen Herzschmerz?«, murmelte er bitter. Mit aller Kraft stemmte er sich gegen die Gefühle von Trauer und Verlassenheit, die ihn überrollten, sowie er an Marie dachte. Wie sie ihn angesehen hatte, als er in der Küchentür stand! Alleine, diese Erinnerung trieb ihm die Tränen in die Augen, und er musste hart schlucken. Am liebsten würde er jetzt mit Vollgas zum Ebereschenhof rasen, Marie in seine Arme schließen und nie wieder von seiner Seite lassen. Er liebte und vermisste sie so sehr, dass es wehtat. Aber ebenso schmerzte ihn die Erkenntnis, dass sie ihm nicht genug vertraute, um an ein gemeinsames Leben zu glauben.
»Was kann ich denn nur tun, dass du mir wirklich vertraust?«, fragte er verzweifelt in die Stille hinein. Mit einer hilflosen Geste wischte er sich die Tränen aus den Augenwinkeln und schüttelte über sich selbst den Kopf. Jetzt fing er wahrhaftig schon an, Selbstgespräche zu führen! Er riss sich zusammen und konzentrierte sich auf die Arbeiten, die heute vor ihm lagen. Das einzige, was er für Marie – und vielleicht für sie beide als Paar – tun konnte, war, stetig und zuverlässig seine Aufgaben beim Hausbau auszuführen. Wenn Marie erlebte, wie verantwortungsvoll er sich um die Arbeiten kümmerte, vielleicht gewann sie dann genug Vertrauen, um der Beständigkeit seiner Liebe zu glauben.
Als er auf den Hof kam, empfing ihn Stille. Marie schien nicht hier zu sein oder noch zu schlafen. Da er einen eigenen Schlüssel besaß, kam er ohne Probleme ins Haus und machte sich an die Arbeit. Naturgemäß war die laut, und wenige Zeit später öffnete sich Maries Zimmertür. Zögernd trat die junge Frau in den Flur. Ben ließ den Zollstock sinken und schaute Marie stumm an.
Sie schien in ihren Kleidern geschlafen zu haben, und das schöne, dunkle Haar hing wirr und stumpf um ihr Gesicht. Tiefe Schatten lagen unter ihren Augen, und sie war geradezu geisterhaft blass. »Ben!«, sagte sie. Ihre Stimme klang heiser, so als ob über Nacht die Worte in ihr eingerostet waren.
»Guten Morgen, Marie«, antwortete er. Zu mehr war er nicht fähig.
Die junge Frau machte eine hilflose Geste, fast sah es so aus, als wolle sie die Hände nach ihm ausstrecken, aber dann strich sie sich doch nur die wirren Haare aus dem Gesicht. »Ich will Kaffee kochen, möchtest du auch einen?«, fragte sie leise.
»Nein, danke, nicht jetzt«, murmelte Ben. Ihm war übel, und irgendetwas schien mit dem Licht im Raum nicht zu stimmen, Maries Umrisse begannen zu verschwimmen. Er konnte sie nicht klar erkennen. Die Hitze und das Pochen in seinem linken Bein beherrschten jetzt seinen ganzen Körper. Er musste unbedingt hier raus, draußen an der frischen Luft würde es ihm bestimmt besser gehen. »Ich …, das Windbrett hinten am Giebel …, ich muss es richten«, murmelte er.
»Ben?« Beunruhigt durch sein seltsames Verhalten, schaute Marie ihn genauer an und erschrak: er schwankte und schien vor Fieber zu glühen. »Ben! Was ist passiert, du siehst furchtbar aus!« Sie wollte ihn in die Arme nehmen, aber der Mann machte eine abwehrende Handbewegung.
»Lass gut sein, Marie, ich komm schon klar!«, stieß er zwischen zusammengepressten Zähnen hervor.
»Nichts ist gut! Du bist krank, Ben! Bitte, lass dir doch von mir helfen!«, sagte Marie angstvoll.
»Aber gern doch …, Senta!«, stieß er spöttisch hervor, drehte sich um und stieg langsam die Treppe herab. Es war nicht zu übersehen, wie schwerfällig und unsicher seine Schritte waren und dass sie ihm Schmerzen bereiteten.
Marie war wie gelähmt von seiner Reaktion. Noch nie hatte er sie verspottet! Und so, wie er aussah und wirkte, ging es ihm sehr schlecht. Egal, was sich dahinter verbarg, Benjamin brauchte einen Arzt!
Mit zitternden Fingern wählte Marie die Nummer von Doktor Seefeld. Die erfahrene Sprechstundenhilfe Gertrud hörte schon an der Stimme, dass es sich nicht um einen hysterischen Anruf, sondern um einen dringenden Notfall handelte, und stellte Marie sofort zum Arzt durch, obwohl dieser in einem Patientengespräch war.
»Bitte, entschuldigen Sie, das hier scheint sehr dringend zu sein!«, sagte er zu seiner Patientin und konzentrierte sich dann ganz auf Maries Anruf.
Sein Gesicht wurde während des Zuhörens sehr ernst, und er stellte einige knappe Frage. Mit einer weiteren, kurzen Entschuldigung gegenüber seiner Patientin war er schon zur Tür hinaus gestürzt. »Informieren Sie meinen Vater, er muss hier übernehmen!«, rief er Gertrud zu, griff seine einsatzbereite Arzttasche und den Notfallkoffer und rannte zu seinem Wagen.
So schnell es ging, fuhr er durchs Dorf und auf die Landstraße, die aus dem Ort hinaus führte. Dabei ging er im Kopf die Symptome durch, die ihm Marie geschildert hatte. Auch von einem rostigen Nagel war die Rede gewesen. Alles in allem hörte sich das nach einer schweren Blutvergiftung an. Wenn dieser Zustand wirklich schon seit Tagen andauerte, war höchste Eile geboten!
Sebastian Seefeld gab Gas und überschritt ohne mit der Wimper zu zucken die Geschwindigkeitsbeschränkung auf Landstraßen, wurde aber gleich hinter der nächsten Kurve ausgebremst: eine Viehherde wechselte von einer Weide zur nächsten über die Landstraße, Kuh an Kuh zog gemächlich an seinem Wagen vorbei und die eine oder andere blieb auch mal stehen, um freundlich durch sein Fenster zu ihm herein zu schauen.
Sebastian konnte Kühe gut leiden, und vor allen Dingen liebte er das Landleben, aber jetzt wünschte er sich in eine Großstadt, wo er mit Blaulicht und Sirene jedes Hindernis hätte aus dem Weg fegen können! Hier blieb ihm nur übrig, die Zeit abzuwarten, bis Rind um Rind und schließlich der Huber Bauer mit einem freundlichen »Pfuiat Eana, Doktor!« an ihm vorüber gezogen waren. Und das konnte dauern … Der Landdoktor biss die Zähne zusammen und übte sich in Geduld.
Auf dem Ebereschenhof hatten sich die Ereignisse inzwischen dramatisch zugespitzt.
Trotz seiner schlechten Verfassung war Ben auf dem Weg zum rückwärtigen Giebel, um dort ein loses Windbrett zu befestigen. Jeder Schritt schmerzte unerträglich, und das Tragen der Leiter stellte ihn vor eine kaum lösbare Aufgabe. Aber Stolz und Sturheit hielten ihn aufrecht.
Nachdem Marie ihr Telefonat mit Doktor Seefeld beendet hatte, machte sie sich voller Angst auf die Suche nach Ben. Was hatte der Mann vorhin gesagt? Etwas von einem Windbrett? Marie stockte der Atem! Benjamin würde doch wohl nicht so leichtsinnig sein und hoch bis unters Dach steigen? Er konnte sich doch kaum noch auf den Beinen halten!
Sie rannte nach draußen, laut seinen Namen rufend. An der östlichen Giebelfront hatte sich ein Windbrett gelockert, deshalb wandte Marie sich sofort dieser Seite des Gebäudes zu. Als sie um die Ecke bog, sah sie zu ihrem Entsetzen, dass sich ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten: an der Giebelseite lehnte eine Leiter, und langsam arbeitete Benjamin sich Sprosse für Sprosse in die Höhe.
»Ben! Was tust du! Bitte, bitte, komm wieder runter! Du bist krank, du schaffst es nicht bis oben!«, rief Marie verzweifelt.
Als Ben ihre Stimme hörte, blieb er keuchend stehen. Sein Herz raste, und sein Mund war wie ausgedörrt. Erschöpft ließ er seine fieberheiße Stirn gegen die nächste Leitersprosse sinken. Er hörte ihr Rufen, konnte aber die einzelnen Worte nicht verstehen. Das seltsam hohe, metallische Klingeln in seinen Ohren übertönte alle anderen Geräusche. Und die Leiter schwankte, er konnte nichts dagegen tun. Sie schwankte, und er schwankte mir ihr, die ganze Hauswand bewegte sich, bewegte sich weg von ihm. Er hörte einen unfassbar lauten Schrei, der für einen Sekundenbruchteil seine Benommenheit zerriss, und dann wurde alles schwarz.
Marie stand wie gelähmt, als sie den beginnenden Sturz sah. Für sie veränderte sich die Zeit, sie dehnte sich mit quälender Langsamkeit, und im Zeitlupentempo sah sie Ben fallen. Es war ihr Leben, das dort fiel, und sie konnte nichts tun. Ihr Mund öffnete sich, ohne dass sie es wusste, und sie schrie ihr Entsetzen, ihre grauenhafte Hilflosigkeit und ihren wilden Protest in den Sommertag hinaus: »NEIN!!!«
Dieser gellende Schrei wies Doktor Seefeld den Weg, als er endlich mit quietschenden Reifen auf dem Hof zum Stehen kam. Ein Griff, und er hatte beide Koffer in den Händen und raste in die Richtung, aus welcher der Schrei gekommen war. Als er Sekunden später um die Ecke bog, sah er Marie, die wie zur Salzsäule erstarrt auf der gemähten Hauswiese stand. Nur wenige Meter entfernt lag Benjamin auf dem Rücken, Arme und Beine ausgestreckt, halb unter einer langen Leiter aus Metall begraben. Er hatte die Augen geschlossen und bewegte sich nicht.
Beim Anblick des Arztes löste sich Marie aus ihrer Erstarrung. »Ben!« Sie fiel neben ihm auf die Knie, wagte aber nicht, ihn zu berühren aus Angst, ihm durch Bewegung weitere Verletzungen zuzufügen. »Ben, bitte, bitte …«, flehte sie.
Doktor Seefeld kniete ebenfalls neben dem Verletzten und überprüfte als erstes Herzschlag und Atmung. »Er lebt!«, sagte er zu der verzweifelten Marie. »Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben!« Seine geübten Hände glitten über den Körper des Bewusstlosen, tasteten vorsichtig die Gliedmaßen ab. »Nichts gebrochen!«, teilte er Marie mit, die leichenblass neben ihm kniete. Vorsichtig streckte sie die Fingerspitzen aus und berührte Bens Wange. »Liebster, bitte komm zurück, bitte komm zurück …«, murmelte sie wie eine Beschwörung.
Und wie durch ein Wunder öffnete Ben die Augen, blinzelte verwirrt in die Sonne und wandte den Kopf zur Seite. »Was …, was ist denn passiert?«, murmelte er.
Maries Schluchzen war irgendetwas zwischen Lachen und Weinen, ihre Erleichterung war zu groß für Worte. Sie fasste nach Bens Hand, die er ihr entgegen streckte, bedeckte sie mit Küssen und legte sie an ihre Wange. Nur seinen Namen konnte sie stammeln, wieder und wieder. »Ben! Liebster, liebster Ben!«
»Ben, können Sie sich erinnern, aus welcher Höhe sie gestürzt sind?«, fragte Doktor Seefeld.
»Ich war ungefähr auf der Höhe des ersten Stockwerks«, murmelte Ben. »Und jetzt bin ich im Himmel.« Er griff mit beiden Händen nach Marie und hielt sie mit erstaunlicher Kraft fest. »Auch wenn ich versprochen habe, es nie zu sagen: ich liebe dich, Marie, und ich weiß, dass ich dich für immer lieben werde.«
»Und ich liebe dich, ich liebe dich so sehr! Bitte, geh nie wieder weg! Bleib bei mir, bleib bei mir!«, schluchzte sie.
»Für immer, Marie!«, versprach Benjamin.
»Ich möchte diesen wunderschönen Augenblick nicht stören, aber neben einer großen Liebe haben wir hier auch eine dramatische Notsituation!«, erinnerte Doktor Seefeld die Liebenden. »Wie durch ein Wunder scheinen Sie durch den Sturz keine großen äußeren Verletzungen erlitten zu haben, aber wie es mit inneren Verletzungen aussieht, das müssen die Kollegen im Krankenhaus abklären. Der Rettungswagen ist schon unterwegs. Aber auch wenn Sie keinen Beinbruch haben, so ist das linke Bein doch deutlich geschwollen und heiß, ich habe es eben beim Abtasten gespürt. Ich werde jetzt das Hosenbein aufschneiden, um zu sehen, was passiert ist.«
»Rostiger Nagel«, murmelte Ben. Er hatte nur Augen für Marie und hielt ihre Hände in seinen, als wollte er sie nie wieder loslassen. Sein Bein, sein Kopf, sein bitterer Kummer wegen Maries Misstrauen all das hatte sich auf wunderbare Weise aufgelöst und in ein Glücksgefühl verwandelt, das ihn schweben ließ.
Er bemerkte kaum, wie Doktor Seefeld das entzündete Bein versorgte, wie ein erster Tropf gelegt wurde, wie ihn das Team vom Rettungswagen auf die Trage legte und zum Krankenhaus fuhr. Infusionen und starke Medikamente begannen ihren Kampf gegen die Blutvergiftung, aber auch das nahm er nicht wahr. Wirklich war nur Marie, die neben ihm saß, die seine Hand hielt und immer wieder sein Herz auf den Kopf stellte, wenn sie sich über ihn beugte und ihm den schönsten Satz der Welt zuflüsterte: »Ich liebe dich!«
Die Zeit im Krankenhaus war lebensrettend für Benjamin. Ohne das Eingreifen der Ärzte, insbesondere Doktor Seefelds, wäre die verschleppte Blutvergiftung tödlich verlaufen.
Wegen des Sturzes waren sich alle einig, dass Ben einen Schutzengel gehabt haben musste, denn außer einigen blauen Flecken blieb er unverletzt. Medizinisch gesehen, war es auf zwei Umstände zurückzuführen: Erstens war Ben nicht aus großer Höhe gefallen, und zweitens genau auf der Stelle aufgeschlagen, auf der das gemähte Gras der Wiese auf einem Haufen lag. Der hatte den Aufprall ein wenig gemildert. Dennoch konnte man es nur als ein Wunder bezeichnen.
Auch dass sich sein Körper so schnell von einer derart schweren Infektion erholte, grenzte an ein Wunder. Die Ärzte führten es darauf zurück, dass Ben vorher kerngesund gewesen war und eine sehr gute Konstitution besaß. Auch Doktor Seefeld war dieser Meinung, aber als darüber gesprochen wurde, zwinkerte er dem Patienten heimlich zu; er wusste genau, was – oder vielmehr wer – Ben so schnell wieder gesund machte.
Ben teilte diese Ansicht aus tiefstem Herzen!
Es war Marie, die jeden Tag von morgens bis abends bei ihm saß.
Immer, wenn er aufwachte, erwartete ihn ihr Lächeln. Dann spürte er, dass sie seine Hand hielt, und er wusste, es war kein Traum. In den ersten Tagen, als die Medikamente gegen die Entzündung ankämpften, hatte er wie in einem Nebel gelegen und nicht immer sofort gewusst, was Wunschdenken und was Wirklichkeit war. Aber Marie war immer da.
Auch für die junge Frau begann in diesen Stunden ein neues Leben.
Vor der lebensbedrohlichen Situation lösten sich ihre eigenen Ängste und Bedenken in Nichts auf. Sie erkannte, wie unnötig ihr Zögern und ihr Misstrauen gewesen waren. Dieses hier war eine Situation, in der sie Ben tatsächlich und unwiederbringlich hätte verlieren können. Wie dumm war sie gewesen, ihrer Liebe nicht zu vertrauen und jeden einzelnen Augenblick zu genießen, den ein gütiges Schicksal ihnen schenkte!
Aber als sie Ben das sagte, schüttelte er entschieden den Kopf. »Du warst nicht dumm!«, widersprach er. »Du hattest Ängste, und das ist niemals dumm! Wenn sich hier jemand diesen Vorwurf machen muss, dann bin doch wohl ich es. Mein gekränkter Stolz hat mich diese blödsinnigen Dinge von einer Trennung sagen lassen. Du ahnst ja gar nicht, wie bitter ich das bereut habe! Und anstatt sofort zu dir zu …«.
Seidige Lippen berührten ihn und verschlossen seinen Mund mit einem Kuss. »Kein Wort von Dummheit mehr«, murmelte Marie zärtlich. »Wir haben doch etwas viel Schöneres, das wir uns sagen können: ich liebe dich, Benjamin Lauterbach.«
Ben umfasste ihr Gesicht mit beiden Händen, und er wurde sehr ernst, ohne etwas von dem Leuchten seiner Liebe zu verlieren. »Ich liebe dich auch, Marie Höfer, von ganzem Herzen und für immer. Und deshalb möchte ich dich etwas fragen, obwohl dieses hier vielleicht ein nicht so ganz romantischer Ort ist und ich keinen Ring bei mir habe.
Willst du dein Leben mit mir teilen, in guten wie in schlechten Zeiten? Willst du Kinder mit mir haben, die wir gemeinsam aufwachsen und in ihr eigenes Leben gehen sehen? Willst du zusammen mit mir alt werden? Erweist du mir die Ehre, mit dir verheiratet zu sein? Marie, willst du meine Frau werden?«
Tränen glänzten in Maries dunklen Augen und vertieften deren dunklen Glanz. »Seit unserer Nacht auf dem Sternwolkensee bin ich deine Frau, Benjamin, und keine Ängste und Bedenken können das ruckgängig machen. Und ja, ich will für dich und vor den Augen aller Welt deine Ehefrau sein. Ich will bei dir sein, in allem, was das Leben uns noch bringen wird.«
Tief bewegt hatte Ben zugehört, hatte jedes einzelne Wort in sich aufgenommen und dem Schatz ihrer gemeinsamen Erinnerungen hinzugefügt. Wie ein kostbares Geschenk hielt er ihr Gesicht zwischen seinen Händen und dachte: und wenn wir auch sehr alt geworden sind, werde ich nie vergessen, wie sie in diesem Augenblick ausgesehen hat!
»Meine Liebste«, sagte er innig.
Sanft zog er ihr Gesicht zu sich herunter, um sie zu küssen, aber Marie hob ihren Kopf und wich soweit zurück, dass sie ihm weiterhin in die Augen schauen konnte. »Da ist noch etwas, was du wissen musst, ehe du mein Jawort annimmst«, sagte sie.
Erwartungsvoll und ein wenig verwirrt schaute Ben die junge Frau an. Sie war ernst, aber in ihren Augen lag ein überirdischer Glanz. »Du wirst nicht nur mich heiraten, Benjamin. Erinnerst du dich an den Sternwolkensee? In dieser Nacht wurde unser Kind gezeugt.«
Zunächst war Benjamin sprachlos. Tausend Gefühle und Gedanken explodierten in seinem Gehirn. Die Worte, die durch seinen Kopf schossen, fanden einfach nicht den Weg auf seine Zunge. »Wir …, wir bekommst ein Baby?«, war schließlich alles, was er herausbrachte.
»Ja, wir bekommen ein Baby«, antwortete seine Liebste.
Er hätte sie auf Händen tragen, vor ihr niederknien und ihre Hände küssen wollen, aber alles, was er tun konnte, war, bewegungslos in diesem Krankenhausbett zu liegen und unter Tränen zu sagen: »Marie, neben deiner Liebe ist es das größte Geschenk, das du mir machen kannst. Ich bin so glücklich, dass …, dass ich dafür keine Worte finde.«
»Die brauchst du nicht; ich höre, was dein Herz mir sagt«, antwortete Marie. Sie verschränkte ihre Finger mit seinen und legte ihre Hände dorthin, wo ihr winziges Ungeborenes dem Leben entgegen wuchs. So blieb sie bei ihm sitzen, bis er einschlief, und als Benjamin wieder aufwachte, saß sie immer noch dort und begrüßte ihn mit ihrem sanften Lächeln.
*
Während Benjamin in der Uniklinik wieder zu Kräften kam, hatte die Nachricht von seinem Unfall und der Blutvergiftung in Bergmoosbach die Runde gemacht. Jeder war schockiert von der Nachricht und wünschte dem beliebten Zimmermann alles Gute für seine baldige Genesung.
Auch Lisa hatte die Nachricht aufgeschreckt. Sie wäre gern in die Klinik gefahren, um sich nach Ben zu erkundigen, obwohl ihr die Rolle als barmherzige Samariterin nicht wirklich gefiel. Aber Doktor Seefeld, der vor allem einen gewissen Rückzug für Ben und Marie gewährleisten wollte, sagte, dass der Patient absolute Ruhe brauchte und keinen Besuch empfangen durfte. In absehbarer Zeit käme er nach Hause, und dann könnte man ihn hier mit guten Wünschen empfangen.
Das war Lisa ganz recht, denn Krankenhäuser fand sie unheimlich. Sollte doch Marie in diesen Tagen die hingebungsvolle Begleiterin sein, hier in Bergmoosbach würde sie schon die Möglichkeit haben, ihre Absichten bei Benjamin voran zu treiben. Sollte ihr intrigantes Gerede bei Marie keine Wirkung mehr zeigen, nun, dann würde sie eben stärkere Geschütze auffahren. Ein Sturz und eine überstandene Blutvergiftung waren noch lange kein Grund, die andere Frau und Ben als Paar an einander zu binden. Immerhin waren sie nicht miteinander verheiratet, und selbst wenn – Lisas Erfahrungen sagten ihr, dass das durchaus kein Hinderungsgrund sein musste.
Deshalb lächelte sie strahlend, als Ben und Marie ins Dorf zurückkehrten, und sie lächelte, als sie ihnen die Einladung zu einer kleinen Feier auf dem Ebereschenhof überbrachten, und sie lächelte, als sie mit den anderen Gästen in Maries duftendem Sommergarten saß.
Es war keine große Feier, mehr ein improvisiertes Fest unter Freunden, bei dem jeder etwas auf den Tisch stellte. Man konnte sich entspannt zurücklehnen und hatte einfach Freude an der Gesellschaft der anderen. Die Luft war erfüllt vom Duft der Rosen und des Geißblatts, Kerzen warteten darauf, in der Dämmerung entzündet zu werden, und wer Lust dazu hatte, konnte tanzen.
Erfüllt von ihrem Glück, lehnte Marie sich in Benjamins Arm und schaute in die Runde. Sie hatten enge Freunde eingeladen und natürlich die ganze Doktorfamilie, einschließlich des Freundes von Emilia. Markus saß ein wenig verlegen, aber gleichzeitig unübersehbar verliebt neben dem jungen Mädchen.
»Wir wollten uns bei euch allen bedanken!«, begann Benjamin. »Ihr habt uns so freundlich empfangen, als wir aus der Klinik kamen. Marie und ich hatten eine schwere Zeit, und so seltsam das auch klingen mag, die Tage im Krankenhaus haben uns gut getan. Wir konnten zur Ruhe kommen und unsere Dinge neu ordnen. Danach war es gut, nach Hause zu kommen. Wir werden hier weitermachen, allerdings anders als bisher geplant.
Und wir möchten uns besonders bei Doktor Seefeld bedanken, der so schnell gekommen ist und ohne dessen Erstversorgung alles viel schlimmer hätte ausgehen können!«
An dieser Stelle versuchte Sebastian Seefeld, Ben zu unterbrechen. Er sagte etwas von Beruf und Selbstverständlichkeit und keine große Sache, aber Ben ließ sich nicht beirren.
»Sollte man nicht trotzdem danke sagen, wenn man Dankbarkeit empfindet?«, entgegnete er. »Was wären wir hier auf dem Land ohne unseren Doktor!«
Zustimmendes Nicken und Applaus der Gäste begleiteten diese Worte. Traudel strahlte über das ganze Gesicht. Diese Anerkennung hatte ihr Bub wirklich verdient! Ihr Blick suchte den des älteren Arztes, und ihr Herz weitete sich, als sie das glückliche Lächeln Benedikts sah. Sie las seine Gedanken in seinen Augen: nun war sein Sohn wirklich in seiner Heimat angekommen.
»Und wie sehen nun eure neuen Pläne aus? Wie geht es denn weiter mit euch und dem Ebereschenhof?«, brachte Lisa sich ins Spiel. Ohne ihr Lächeln zu verlieren, aber innerlich leicht beunruhigt beobachtete sie den tiefen Blick, den Ben und Marie mit einander tauschten.
»Wie die Pläne für den Hof aussehen, das wissen wir noch nicht genau, daran arbeiten wir noch«, sagte Ben. »Zuerst konzentrieren wir uns auf ein großes Ereignis, zu dem ihr alle eingeladen seid. So bald wie möglich feiern Marie und ich unsere Hochzeit!«
Diese Neuigkeit wurde mit neuem Applaus und vielen Glückwünschen begrüßt. Das Paar hatte für diese Gelegenheit Champagner kalt gestellt, und man stieß auf eine glückliche Zukunft an.
Dass in Maries Glas anstelle des edlen Tropfens Apfelschorle perlte, fiel nur Traudel auf. Sie behielt ihre Beobachtung für sich und lächelte.
Lisa spielte die freudig aufgeregte Freundin. Nein, was war das aber plötzlich gekommen! Wie spannend das doch alles ist! War der Antrag romantisch? Wie sah der Ring aus? Welches Kleid würde die Braut anziehen?
Marie ließ die Fragen um sich herum flattern und antwortete mit einem Lächeln. »Siehst du, alles ist gut geworden! Es ist wirklich so, wie du gesagt hast: ich muss mir nicht mit unnötigen Gedanken das Herz schwer machen.«
Oh, das würde ich keineswegs so sagen, du strahlendes Glückskind! Das hier ist noch lange nicht zu Ende, Hochzeit hin oder her!, dachte Lisa giftig. Natürlich sagte sie das nicht laut, sondern stieß mit allen auf den schönen Anlass an, lachte, tanzte und verbarg ihr armseliges, neidisches Herz.
Als sich die Dämmerung über das Land senkte, flammten die Kerzen in den Windlichtern auf und beleuchteten den duftenden Garten und die feiernden Menschen. Liebevoll zog Benjamin Marie in seine Arme. Die beiden blieben eng an einander geschmiegt in der warmen Dämmerung stehen und genossen den Anblick ihres lebendigen Zuhauses. Alt und Jung saß zusammen, und zumindest für diese wundervollen Stunden waren sie alle Teil ihres gemeinsamen Lebens.
»Was uns die Zukunft wohl bringen mag?«, fragte Marie träumerisch. Ihr Gesicht zeigte keine Zweifel oder Ängste, es war von tiefem Frieden erfüllt.
Ben streichelte ihre Wange und barg dann ihren Kopf an seiner Brust. »Das Leben«, beantwortete er Maries Frage. »Liebe. Und unser Kind. Was könnten wir noch mehr vom Schicksal erbitten?«
»Nichts!«, antwortete sie aus tiefster Seele. »Gar nichts!«
Und genau in diesem Augenblick glitt eine Sternschnuppe über den Himmel. Sie zeichnete einen eleganten Bogen in das Dunkel der Nacht, und ihr goldenes Schimmern leuchtete wie ein freundlicher Gruß aus der Unendlichkeit.
- E N D E -