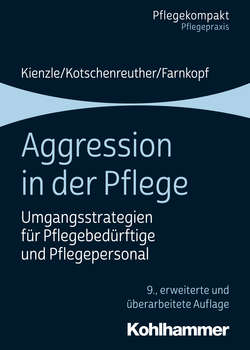Читать книгу Aggression in der Pflege - Theo Kienzle - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3 Kommunikationstheorien
»Kommunikation ist eine Kette mehr oder weniger nützlicher Missverständnisse.« (Steve deShazer 1940–2005)
Im Bereich der Pflege ist es sehr wichtig, sein Gegenüber wahrzunehmen und sich in ihn/sie hineinversetzen zu können. Gerade im sprachlichen Bereich kommt es häufig zu Missverständnissen und Störungen in der Kommunikation. Die folgenden Modelle beschäftigen sich damit, wie Kommunikation abläuft und welche Störungen auftreten können.
3.1 Sender-Empfänger-Modell von Stuart Hall
Stuart Hall veranschaulicht das Prinzip der Kommunikation durch das Sender-Empfänger-Modell (Röhner 2015). Sender A und Empfänger B tauschen eine Nachricht aus. Damit die Kommunikation gelingt, müssen beide Parteien die gleiche Codierung verwenden. (z. B. unter einem Wort die gleiche Bedeutung verstehen). Hall teilt die Übermittlung und den Empfang einer Nachricht in sieben Schritte auf:
1. Kommunikationspartner A hat eine Absicht.
2. Er übersetzt sie in Worte.
3. Er sendet sie und spricht sie aus.
4. Die Nachricht wird übermittelt.
5. Kommunikationspartner B empfängt die Nachricht und hört sie.
6. Er übersetzt sie.
7. Er interpretiert die Bedeutung.
Beispiel
Pfleger H. möchte, dass Herr A. heute früh ins Bett geht, da er am nächsten Tag eine wichtige Untersuchung im Krankenhaus hat. »Herr A. sie gehen heute schon um 20.00 Uhr ins Bett.« Dabei schaut er gehetzt auf die Uhr, da er selbst noch einen wichtigen Termin hat.
»Ich soll heute schon um 20.00 Uhr ins Bett!!!« Pfleger H. konnte mich noch nie leiden. Er ist ständig genervt (schaut auf die Uhr) und will seine Ruhe haben. Ich wollte doch heute Abend noch eine Runde Karten spielen.
Tritt bei einem dieser Schritte ein Fehler auf (falsche Interpretation von Mimik und Gestik …) führt das zu einer Störung der Kommunikation.
3.2 Die fünf Grundgesetze der Kommunikation von Paul Watzlawick (Watzlawick 2017)
1. Man kann nicht nicht kommunizieren
Die zwischenmenschliche Kommunikation findet auf mindestens drei Ebenen statt. Durch Tonfall, Mimik und Gestik werden verschiedene Reaktionen hervorgerufen.
Beispiel
Eine alte Frau sitzt im Gemeinschaftsbereich des Altenheimes und blickt die ganze Zeit vor sich auf den Boden. Auf den ersten Blick würde man denken, dass sie mit niemandem kommuniziert. Und doch teilt sie den anderen Bewohnern nonverbal mit, dass sie keinen Kontakt möchte.
2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt
Das Verhältnis zwischen Sender und Empfänger entscheidet, wie die Botschaft übermittelt wird.
Beispiel
Frau S. sucht ihre Brille und erkundigt sich bei ihrer Tochter, ob sie die Brille gesehen hat.
Die Gefühle des Empfängers gegenüber dem Sender entscheiden, wie die Botschaft aufgenommen wird.
Beispiel
Ihre Tochter antwortet mit rollenden Augen: »Hast du die Brille schon wieder verlegt?«.
3. Kommunikation besteht aus Aktion und Reaktion
Das Verhalten des einen Gesprächspartners ist immer eine Reaktion auf das Verhalten des anderen Gesprächspartners. Jemand sagt etwas und sein Gegenüber reagiert darauf. Je nachdem auf welchem Kanal die Nachricht empfangen wird, können Missverständnisse und Konflikte entstehen. Jedes ausgesendete Signal ist gleichzeitig auch Kommunikation. Da eine Kommunikation kreisförmig verläuft, lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen, von wem die Unstimmigkeiten ursprünglich ausgegangen sind.
Der Fokus der Beteiligten sollte jetzt eher auf den Punkt gerichtet sein, was man JETZT tun kann, um das Problem zu lösen. Nicht den »Schuldigen« zu identifizieren.
4. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten
Analoge Kommunikation spielt sich nonverbal auf der Beziehungsebene ab. Sie ist mehrdeutig und kann unterschiedlich interpretiert werden. Die digitale Kommunikation dagegen, findet auf der Sachebene (verbal) statt. Sie ist eindeutig. Wörter und Sätze beziehen sich auf einen bestimmten Sachverhalt.
Beispiel
Die Pflegerin A. schlägt dem Patienten, Herrn P., vor, eine Mittagsruhe zu halten. Das kann heißen, dass sie sich wirklich um sein Wohlergehen sorgt, oder dass sie einfach ihre Ruhe haben will.
Im Idealfall stimmen analoge und digitale Kommunikation miteinander überein.
5. Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär
Welches Verhältnis herrscht zwischen den Kommunikationspartnern?
Handelt es sich um eine symmetrische Kommunikation, befinden sich die Gesprächspartner auf Augenhöhe. (z. B. Kollegen in einer Pflegeeinrichtung, Patienten eines Wohnbereiches).
Bei einer komplementären Kommunikation befinden sich die Gesprächspartner auf unterschiedlichen Ebenen. Sie ergänzen sich jedoch im Gespräch. (z. B. Pflegedienstleitung und Pfleger, Gesprächspartner mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln).
3.3 Vier Seiten Modell von Schulz von Thun
Der Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun beschreibt in seinem Vier-Seiten-Modell (Schulz von Thun 2011) vier Ebenen, die eine Nachricht bei der Übermittlung beeinflussen können:
1. Sachebene:
Wie kann ich meinem Gegenüber den Sachverhalt klar und deutlich mitteilen?
2. Beziehungsebene:
Was halte ich von meinem Gegenüber? Wie ist unser Verhältnis? Betrachte ich mein Gegenüber als gleichwertig?
3. Selbstaussage:
Wieviel meiner Persönlichkeit gebe ich als Sprecher preis? Gefühle, Werte …
4. Appell:
Zu was möchte ich mein Gegenüber veranlassen? Was möchte ich bewirken?
Betrachten wir die Grafik genauer, wird deutlich, dass Kommunikation vierdimensional verläuft. Eine einzige Nachricht, kann viele Botschaften haben, je nachdem, wie sie vom Empfänger dekodiert wird. Gerade die Beziehungs- und Apell Ebene lassen einen großen Spielraum der Interpretation und sind deshalb besonders Störungsanfällig. Ist die Kommunikation gestört, kommt es zu Missverständnissen.
Beispiel
Herr. L würde sehr gerne mal wieder ein Stück seines Lieblingskuchens essen. Seine Tochter bringt ihm am Sonntag ein Stück mit. Während er den Kuchen isst, fragt er seine Tochter, ob sie das Rezept verändert habe.
| Sachebene: | Der Kuchen schmeckt anders als gewohnt. |
| Selbstaussage: | Herr L. hat eine geschmackliche Veränderung festgestellt und der Kuchen schmeckt ihm nicht. |
| Beziehungsebene: | Herr L. und seine Tochter haben ein gutes Verhältnis. Deshalb beichtet er ihr, dass ihm der Kuchen nicht schmeckt. |
| Appell: | Bitte backe den Kuchen wieder nach dem alten Rezept. |