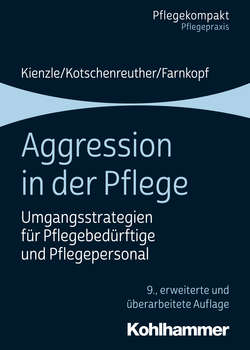Читать книгу Aggression in der Pflege - Theo Kienzle - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4 Sonstige Erklärungsmodelle
4.1 Körperliche Faktoren
Neben den wissenschaftlichen Theorien und Missverständnissen bei der Kommunikation können auch körperliche Grunderkrankungen für ein gesteigertes aggressives Verhalten verantwortlich sein. Psychomotorische Erregungszustände sind gekennzeichnet durch wachsende Unruhe, bedrohendes Verhalten, Ängste und Gewaltbereitschaft. Ausgelöst werden sie u. a. durch Alkohol- und Drogenmissbrauch oder bei demenziellen Erkrankungen.
Steinert & Berk (Steinert & Bergk 2008) haben in ihrer Studie untersucht, bei welchen Krankheitsbildern psychomotorische Erregung, in welcher Häufigkeit, auftritt:
Besonders häufig ist sie zu beobachten bei:
• Alkoholintoxikation (evtl. in Verbindung mit einer Persönlichkeitsstörung)
• akuten Psychosen (Schizophrenie, Manie)
• psychoreaktiven Erregungszuständen (z. B. familiäre Konfliktsituation,
• gelegentlich mit begleitender depressiver Störung)
• Intoxikationen mit stimulierenden Drogen (z. B. Kokain, Amphetamin,
• Ecstasy, häufig Mischintoxikation bei Polytoxikomanie)
Weniger oft ist sie zu beobachten bei:
• postkonvulsivem Dämmerzustand bei Epilepsie
• akuter Belastungsreaktion nach psychischem Trauma (z. B. Autounfall, Brand, Verlust nahestehender Angehöriger)
• geistiger Behinderung mit rezidivierenden, gleichartig verlaufenden Erregungszuständen
• sogenannten »Primitivreaktionen« als »Kurzschlusshandlung« bei intelligenzgeminderten, einfach strukturierten Personen
• Demenz
• Entzugssyndrom/Delir
• einem unmittelbar vorangegangenem Schädel-Hirn-Trauma
• Organischen Persönlichkeitsstörungen (»hirnorganische Wesensänderung«)
Seltener bei:
• Akuten Gehirnerkrankung, z. B. Subarachnoidalblutung, Enzephalitis (neurologische Symptome können zunächst fehlen!)
• metabolischer Störung (z. B. Hypoglykämie, Nieren-/Leberinsuffizienz)
• sonstiger Gehirnerkrankung (Tumor, Gefäßprozess)
• pathologischem Rausch (abnorme Reaktion mit extremer Persönlichkeitsveränderung und aggressiven Durchbrüchen bei geringen Mengen von Alkohol)
Psychomotorische Erregungszustände sind auf jeden Fall als psychiatrischer Notfall zu behandeln.
4.2 Substanzmissbrauch
Laut einer Veröffentlichung des Bundesministeriums für Gesundheit (Gesundheit 2019) rauchen in Deutschland 14,7 Millionen Menschen, 1,8 Millionen Menschen sind alkoholabhängig und Schätzungen legen nahe, dass 2,3 Millionen Menschen von Medikamenten abhängig sind (hauptsächlich von Benzodiazepinen).
Substanzmittelkonsum im Alter kann verschiedene Gründe haben:
• Gewohnheit/Langeweile
• Fehlende Sozialkontakte (Einsamkeit)
• Kein geregelter Tagesablauf
• Geringe Rente
• Depressionen
• Ängste (Abhängigkeit, Verlust der Selbständigkeit, Sterben)
• Andere Erkrankungen
• Schlaflosigkeit
Risiken, die eine Abhängigkeit mit sich bringen:
• Erhöhte Unfallgefahr
• Rückzug aus dem sozialen Leben
• Verlust der Selbständigkeit durch direkte Folgen der Abhängigkeit
Um eine mögliche Abhängigkeit frühzeitig zu erkennen, sollten Pfleger und Angehörige auf folgende Hinweise achten:
• Atem riecht nach Alkohol
• Fehlender Antrieb
• Massive Stimmungsschwankungen
• Vernachlässigung der Person selbst (Aussehen, Körperpflege) und des Haushaltes
• Entzugserscheinungen (zittern, innere Unruhe)
• vermehrte Unfälle/Stürze
• Medikamente/Alkohol werden gehortet
Bei einem Verdacht auf Abhängigkeit, sollten Sie das Geschehen gründlich dokumentieren und andere Mitarbeiter sensibilisieren. Sprechen Sie mit dem Betroffenen und dessen Angehörigen über die Risiken und Folgen, die eine Abhängigkeit mit sich bringt. Zusätzlich sollte der Hausarzt zur Abklärung hinzugezogen werden (Achtung Schweigepflichtentbindung nötig!) oder schlagen Sie den Kontakt mit einer Beratungsstelle für Abhängige vor. Auch Angehörige können sich dort beraten lassen.
Beispiel
Den Mitarbeitern des ambulanten Pflegedienstes fällt schon seit geraumer Zeit auf, dass Frau M. öfter stürzt und ihr allgemeines Erscheinungsbild immer schlechter wird. Bei der morgendlichen Blutdruckmessung roch Frau M. nach Alkohol. Der Fall wird im Team besprochen. Der Hausarzt und die Tochter von Frau M. werden hinzugezogen.
Gerade für nahe Bezugspersonen ist eine Beratung und Unterstützung wichtig. Oft besteht die Gefahr einer Co-Abhängigkeit. Durch Handlungen oder Unterlassungen der Bezugsperson wird die Sucht gefördert oder nach Außen versteckt.
4.3 Medikamente als Aggressionsförderer
Verschiedene Medikamente können, auch bei korrekter Dosierung, Aggressivität steigern oder erzeugen (Wesuls 2005)
• Aktivierende Antidepressiva: Anafranil®, Gamonil®, Pertofran®, Imipramin, Noveril®, Vivilan®
• Schilddrüsenhormone: Levothyroxin, Eferox®, Euthyrox®, Thevier®
• Antiepileptika und Barbiturate: Luminal®, Liskantin®, Phenytoine, Epanutin®
• Parkinsonmittel: Levodopa, Dopaflex®, kirim®, Pravidel®
• Koffein: Alacetan, Coffetylin®, Doppel-Spalt®, Neuralgin®, Octadon®, Togal®
• Benzodiazepin-Tranquilizer: Adumbran®, Diazepam, Praxiten®
• Benzodiazepin-Schlafmittel: Rohypnol®, Mogadan®, Remastan®
4.4 Gefühle der Angst und Bedrohung
Gefühle von Angst und Bedrohung gelten als einer der Hauptauslöser von aggressivem Verhalten.
Definition Angst
Unter Angst versteht man einen emotionalen Zustand einer Person, bei der eine erhöhte Aktivität des autonomen Nervensystems festzustellen ist. Anspannung, Unruhe, Nervosität und Stress sind die Folgen. Diese innere Anspannung lässt die Motivation sinken und führt dazu, dass ein gewünschtes Verhalten nicht gezeigt wird.
Gerade in den Bereichen der Pflege, wo es hektisch zugeht, Mitarbeiter gestresst sind und alle Beteiligten auf engstem Raume versammelt sind, sollte der Faktor Angst nicht unterschätzt werden (z. B. bei einer Behandlung in der Notaufnahme). Machen sich Mitarbeiter diese Tatsache bewusst und fühlen sich in den Patienten ein, kann der auslösende Reiz der Angst oft schon erkannt und minimiert werden, bevor der innere Spannungszustand unerträglich wird und es zu gewalttätigen Ausbrüchen kommt. Sprache, Körperhaltung und Empathie spielen hier eine große Rolle.
Ängste können auch als eigenständige Erkrankung auftreten (z. B. neurotische Ängste – Angst vor Einsamkeit) oder werden von Medikamenten ausgelöst. Laut einer Studie des Ärzteblattes (Ärzteblatt 2019) sind in Deutschland über 10 % der Senioren von einer Angsterkrankung betroffen. Auch Erkrankungen wie Diabetes mellitus und Angina pectoris bringen Ängste mit sich. Ängste können auch Begleiterscheinungen depressiver Störungen, Psychosen (z. B. wahnhaft, Auflösung der Ich-Grenzen) oder einer Demenz (Ängste bei Desorientiertheit) sein.
Beispiel
Herr L. leidet unter einer Demenz. Er ist nicht mehr in der Lage zu verstehen, was mit ihm passiert. Innere Unruhe und Angst sind die Folge. Als die Pflegerin Frau F. ihn auffordert aufzustehen, damit sie ihm beim Ankleiden helfen kann, beschimpft er sie und schlägt nach ihr.
4.5 Aggression als Form der Kontaktaufnahme
Auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit!
Beispiel
Wegen einer Grippewelle ist das Personal der Einrichtung stark reduziert und die Angestellten haben keine Zeit, sich um jeden Patienten intensiv zu kümmern. Die Bewohnerin Frau F. beginnt aus heiterem Himmel auf die im Rollstuhl sitzende Frau S. einzuschlagen. Pfleger M. greift ein und führt ein ernsthaftes Gespräch mit Frau F. Damit erhält Frau F. die gewünschte Aufmerksamkeit.
Durch das negative, oft aggressive Verhalten macht die Person die Pflegekraft auf sich aufmerksam. Beschäftigt sich die Pflegekraft mit ihr, erlebt sie das als Zuwendung. Mögliche Gründe dafür, können u. a. sein:
• Einsamkeit
• Kein Zugang zu den eigenen Gefühlen
• Die Person hat nie gelernt, eigene Gefühle und Bedürfnisse adäquat umzusetzen.
4.6 Sexuelle Belästigung (rechtliche Bewertung Kap. 2)
Im Bereich der Pflege ist die Gefahr von sexuellen Übergriffen besonders hoch, da die Patienten oft keine andere Möglichkeit haben, mit ihrer Sexualität umzugehen. Deshalb ist es wichtig, den Mitarbeitern in Teamgesprächen und Fortbildungen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, damit sie in einer akuten Situation professionell reagieren können.
Definition: Sexuelle Belästigung
Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (§ 3 Abs. 4 AGG) spricht man von einer sexuellen Belästigung, wenn ein unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhaltes, sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird.
Beispiel
Die Pflegerin Frau F. wird von dem Bewohner Herrn L. mit den Worten begrüßt. »Sie haben aber einen geilen Arsch.« Bei der Grundpflege greift er ihr plötzlich an die Brust.
Reaktionen auf sexuelle Belästigung:
• Grenzen setzen
• Sexuelle Belästigung nicht ignorieren
• Klare und eindeutige Worte – z. B. »Stopp!«, »Halt!«, »Nein!«
• Abwehrende Bewegung
• Bei ausgeführten sexuellen Handlungen sofort den Raum verlassen. Kommen sie mit einer Kollegin/Kollegen zurück, um die Pflege zu beenden.
• Patienten, die für Übergriffe bekannt sind, von gleichgeschlechtlichen Kollegen betreuen lassen.
• Professionelle Distanz waren – (Lassen Sie sich vom Patienten mit »Sie« und Nachname ansprechen; tragen sie Dienstkleidung).
• Dokumentation des Vorfalls
4.6.1 »Dreier Regel« bei sexueller Belästigung