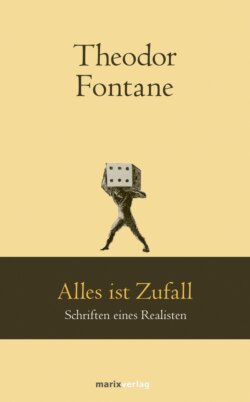Читать книгу Alles ist Zufall - Theodor Fontane - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеTheodor Fontane hatte eine glückliche Kindheit. Er verbrachte sie in Neuruppin und Swinemünde, dem heutigen Świnoujście in Polen. Nun sind es nicht Land und Leute allein, die den Wesenszug eines Heranwachsenden prägen. Es ist aber wohl kaum zu leugnen, dass vom Ort der Geburt und Kindheit eine magische Kraft ausgeht, die sich in das Tiefengedächtnis eines Menschen dauerhaft eingräbt und in den folgenden Jahrzehnten des Lebensbaumes immer wieder auf überraschende und wundersame Weise zurückmeldet. Bei Fontane ist es jedenfalls so gewesen. Er hat es auch so empfunden. Wenn sich in den ersten Lebensjahren der Mensch entwickelt und diese Aussage mehr oder weniger »auf Allgemeingültigkeit Anspruch hat, so darf vielleicht auch diese meine Kindheitsgeschichte als eine Lebensgeschichte gelten«, schrieb er. Am deutlichsten belegen dies seine beiden Erinnerungsbücher Meine Kinderjahre und Von Zwanzig bis Dreißig, die er in hohem Alter niederschrieb. In ihnen geht es zwar vor allem um die ersten drei Lebensjahrzehnte, sie stellen aber zugleich eine Bilanz des Lebens dar, indem sie die Gegenwart und jüngere Vergangenheit in den Rückblick einfließen lassen. Wenn ich davon spreche, dass Land und Leute den Wesenszug eines Menschen beeinflussen, so ist in unserem Falle anzufügen, dass ihn mit Neuruppin und Swinemünde zwei Städte prägten, die im Grunde genommen nicht unterschiedlicher sein konnten. Nun liegen die Unterschiede nicht im Grundsätzlichen. Vielmehr handelt es sich um Unterschiede im Kleinen. Aber diese waren durchaus von Gewicht und schufen so etwas wie einen kulturellen und narrativen Spannungsbogen, der sich im Charakter von Fontane spiegelte.
In Neuruppin erlebte er eine Stadt, die nach der großen Feuersbrunst am Ende des 18. Jahrhunderts völlig neu aufgebaut wurde. Ihre Straßen und Häuserreihen erinnern an ein Schachbrett, jedenfalls an eine rechtwinklige Ordnung, die es Fontane schon als Kind leicht gemacht haben dürfte, sich zu orientieren. Dem Besucher heute ergeht es nicht anders. Der Grund dafür lag darin, dass Preußen Neuruppin zu einer bedeutenden Garnisonsstadt ausbaute, in der schon vor dem Brand kein geringerer als der junge Friedrich als Kronprinz das gleichnamige Regiment befehligte. Fontane wuchs folglich mit dem Hurra der Bürger: »die Soldaten kommen«, ihren Platzkonzerten, Paraden, dem Donner der Manöver und dem Pfeifen der Schießübungen auf. Die Einflüsse der Garnisonsstadt und das von ihr ausgehende militärische Treiben und Getöse prägten sein literarisches Schaffen bis in das Alterswerk hinein. Zwölf bittere Jahre, in denen er über die drei preußischen Kriege als Kriegsberichterstatter Auskunft gab, zeugen davon. Seine Erzählung Kriegsgefangen und seine Reportage Aus den Tagen der Okkupation, einer Reise durch Nordfrankreich und das besetzte Elsaß-Lothringen zu Ostern 1871, sowie zahlreiche seiner Gedichte wie etwa die Balladen Männer und Helden sind ohne diese Prägungen, ohne diese tiefe Verbindung mit Preußen und seinem Militär nicht zu erklären.
Neuruppin steht aber in seinem Leben nicht nur für Tradition, Ordnung, Geschichte und Militärwesen. Zur Stadt gehört auch der Ruppiner See mit seiner weichen Landschaft, seinen Promenaden, seinen herrlichen Sonnenuntergängen, seinen Lastkähnen, Fischern, ihren Booten und Netzen, seinen idyllischen Buchten und zum Baden einladenden Ufern. Theodor Fontane wuchs in diese Idylle hinein. Sie schärfte seine Wahrnehmungen und Empfindungen. Sie bildete den Nährboden für viele seiner Gedichte und Landschaftsschilderungen in seinen Reiseberichten und Romanen. Sein Elternhaus, die Löwen Apotheke, die das junge Ehepaar mit der Hochzeit erwarb, die Magistrale der Stadt, die zu seiner Zeit, es wird kaum überraschen, Friedrich Straße hieß und heute nach Karl Marx benannt ist, liegt nur wenige Meter vom See entfernt. Neuruppin und der See tauchen denn auch nicht nur in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg immer wieder auf, auch sein letzter großer Roman Der Stechlin setzt mit der Grafschaft Ruppin und der Beschreibung eines Sees ein. Nur handelt es sich hier um den Stechlin, häufig auch der Große Stechlinsee oder kurz Stechlinsee genannt. Er gehört zum Rheinsberger Seengebiet und liegt nicht weit vom Ruppiner See entfernt. Fontane stellt ihn dem Leser folgendermaßen vor: »Einer der Seen, die diese Seenkette bilden, heißt ›der Stechlin‹. Zwischen flachen, nur an einer einzigen Stelle steil und kaiartig ansteigenden Ufern liegt er da, rundum von alten Buchen eingefaßt, deren Zweige, von ihrer Schwere nach unten gezogen, den See mit ihrer Spitze berühren.«
Rückblickend hat Fontane Neuruppin als eng und langweilig bezeichnet. Doch dürfte er dies als Kind kaum so empfunden haben. Für Augen und Ohren bot die Garnisonsstadt am See viele Reize, die in ihrer Widersprüchlichkeit – Naturlandschaft einerseits und militärische Ordnung andererseits – seine Empfindungen und Charakterbildung durchaus angeregt haben.
In noch viel stärkerem Maße öffnet sich dieser Spannungsbogen in der Hafenstadt Swinemünde, der nächsten Station auf seiner Entdeckungsreise in die Kindheit. Der Umzug erschien ihm rückblickend wie die Abkehr vom Refugium zum Tor der Welt, von einer überschaubaren Schutzzone bürgerlichen Lebens, in die raue, pralle, ungeordnete, schillernde, wilde Wirklichkeit. Wenn Ruppin für ihn für ein behütetes bürgerliches Leben stand, dann Swinemünde für seine Offenheit, eine dem Schicksal des Lebens zugewandte Stadt, die in der Begegnung der Kulturen die Freuden- und Schattenseiten eines offenen Lebensentwurfes aufscheinen ließ.
Swinemünde empfand Fontane als ein »unschönes Nest«, aber zugleich entdeckte er auch einen »Ort von ganz besonderem Reiz«. Dieser lag für ihn in seiner eigentümlichen Lebendigkeit, die Handel und Schifffahrt mit sich brachten. Der Strom, wie die Swine genannt wurde, übte einen ganz besonderen Zauber auf ihn aus. Die Flöße, Flußbagger und Handelsschiffe, die um die Welt fuhren und nicht nur Waren, sondern auch Geschichten mit in die Stadt brachten, faszinierten ihn. Sie gaben der Stadt ihr eigentümliches Flair. Spießbürgertum und Weltbürgertum bildeten eine Melange, wie sie sich damals nur in Hafenstädten entwickeln konnte. Während die Innenstadt, wo nahe dem Kirchplatz die Familie ihr neues Zuhause fand, der Betulichkeit anderer Kleinstädte nicht nachstand, entdeckte er den Hafen als Abenteuerplatz des Lebens. Fontane schilderte Swinemünde in seinen Lebenserinnerungen als Ort der Poesie, dem die Prosa auf dem Fuße folgte.
In seinem Charakter entfalteten sich zwei Wesenszüge, die es ihm nicht leicht machten, eine Balance zu finden, weil sie sich nur schwerlich zum Ausgleich bringen ließen: eine tiefe Bindung an die Heimat und eine Sehnsucht nach der Fremde, eine nach Sicherheit und Geborgenheit strebende Bürgerlichkeit und eine das Risiko nicht scheuende Abenteuerlust. Ein Jugendfreund schilderte ihn als scharfsinnigen, mit glühender Phantasie ausgestatteten, gutmütigen aber auch in sich widersprüchlichen Menschen, dessen Hauptschwäche die Eitelkeit sei.
Nun erfährt der heranwachsende Mensch seine Prägungen nicht nur von der Umgebung, in der er lebt. Zuallererst sind hier wohl die Eltern zu nennen. Sie übermitteln eine Mitgift, die dem Menschen in die Wiege gelegt ist. Sie trägt mit den Jahren zu seiner Charakterbildung wesentlich bei. Seine Eltern unterschieden sich in vielerlei Hinsicht. Doch in einem stimmten sie völlig überein. Sie fühlten sich als etwas Besonderes, weil sie französische Namen trugen, ihre Vorfahren nach Preußen emigriert waren und sie sich als vom Calvinismus geprägte Hugenotten zu jener Schicht rechnen durften, die es in Preußen geschützt durch das Edikt von Potsdam (1685) zu etwas gebracht hatten. Aber dieser Kolonisten-Stolz genügte ihnen nicht. Sie bemühten sich, unter ihrem Namen, Persönlichkeiten zu finden, die eine herausragende Stellung in Staat und Gesellschaft innehatten, um sie als Vorfahren anzuführen. In diesen mehr der Phantasie als der Wirklichkeit geschuldeten denkbaren Verwandtschaften versuchten sie einander zu übertrumpfen, und daraus für sich jeweils besondere Vorrechte für die Kindererziehung abzuleiten. Fontane schilderte dies in seinem Buch Meine Kindheitserinnerungen mit eben so viel Ironie wie Zustimmung. Er machte aber auch deutlich, dass dieser Wettstreit um die Vorfahren ihn nicht unbeeindruckt ließ. Kolonisten-Stolz hin oder her, seine Eltern standen unter Wahrung ihrer kulturellen Identität loyal zum preußischen Staat und seinen Herrschern. So verwunderte es nicht, dass Fontane mit Stolz auf seine Vorfahren und das Land blickte, in dem er heranwuchs. Doch in dieser Übereinstimmung seiner Eltern zu Stellung, Herkunft und Familie erschöpfte sich das sie einigende Band; ihre Charaktere hätten kaum unterschiedlicher sein können. In der detaillierten Darstellung ihrer Wesensunterschiede hält er sich mit der Milde des Rückblicks im Alter selbst den Spiegel vor.
Seinen Vater, den er in seiner Kindheit besonders verehrte, schilderte er als einen gebildeten Mann, der weit über seine Tätigkeit als Apotheker hinauszublicken vermochte. Er bezeichnete ihn als einen »humoristischen Visionär«, einen Phantasten und Plauderer, der guten Sinnes zu sein und gut zu leben zu den wesentlichen Merkmalen seiner Existenz zählte. Allzu oft entfloh er der Apotheke und ging seiner Spielleidenschaft nach, die das Zusammenleben der Familie erschwerte und sie in den Abgrund schauen ließ. Um seine Spielschulden zu begleichen, musste er mehrfach seine Apotheke verkaufen. Seine Lebensweise nahm auf seine Frau und Kinder wenig Rücksicht. Dennoch liebte der junge Fontane seinen Vater, dessen Großzügigkeit ihm ein Leben eröffnete, das seine Phantasie beflügelte und ihm Freiräume schuf, die seiner Mutter ein Dorn im Auge waren.
Fontane verhehlte nicht, dass er ihr als Kind nicht gerecht geworden sei. Ihre Strenge, ihr Fleiß, ihr Anstand und ihr sittsames Leben, aber auch ihre südfranzösische Heftigkeit, ihre Unduldsamkeit und manchmal auch Härte in Fragen der Erziehung sind Dinge, denen er am Ende viel verdankte, auch wenn er in seiner Jugend wenig Gefallen daran fand. Erst im Alter lernte er schätzen, was sie ihm mit auf den Weg gegeben hatte. »Sie war dem ganzen Rest der Familie, der damaligen wie der jetzigen, weit überlegen«, schrieb er, »nicht an sogenannten Gaben, aber an Charakter, auf den doch immer alles ankommt.«
Die Gegenwelten der Eltern und der Umgebung, in die er hineinwuchs, prägten seine Entwicklung. Sie traten immer dann besonders hervor, wenn er sich an Weggabelungen befand, er entscheiden musste, welchen Lebenspfad er zukünftig beschreiten wollte. Für seine Schulzeit galt dies nur mit Einschränkungen, da er hier dem Willen der Eltern ausgesetzt war, die sich aber über seine schulische Ausbildung nur schwerlich verständigen konnten. So kurz entschlossen wie seine Mutter das Bummelleben mit Privatunterricht in Swinemünde beendete und ihn auf dem Gymnasium in Neuruppin anmeldete, meldete ihn sein Vater nach gut einem Jahr in der Quinta ebendort wieder ab, um ihn in Berlin auf die Friedrichswerdersche Gewerbeschule zu entsenden. In Neuruppin und Berlin lebte er fortan entfernt von seinen Eltern. Das Gymnasium verließ er 1836 als Sechzehnjähriger mit dem »Einjährigen«, damals ein durchaus ansehnlicher Abschluss. Die dreijährige Ausbildung knüpfte an sein Leben in Swinemünde an, da er die schulischen Verpflichtungen nicht sonderlich ernst nahm und lieber durch die Stadt schweifte und sich in Berliner Cafés mit der neuesten Literatur beschäftigte. So war er in der Lyrik seiner Zeit beschlagener als in den meisten Schulfächern. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass seine Neigung zur Literatur in diesen Jahren entfacht wurde. Sein Vater hatte ihn jedoch nicht ohne Hintergedanken an der Gewerbeschule angemeldet, denn er wollte, dass sein Theodor ebenso wie er selbst Apotheker würde. Und so kam es denn auch. Seine Lehrzeit begann er in der Apotheke Zum weißen Schwan in der Spandauer Straße bei Herrn Rose. Pflichtbewusstsein und Leidenschaft traten in diesen Jahren bereits als Wettbewerber auf. Fontane versuchte die Anforderungen der Ausbildung mit seiner Leidenschaft zur Literatur in Einklang zu bringen. Die Apotheke erwies sich dafür als ein gar nicht so ungeeigneter Raum, weil Herr Rose einem Lesezirkel angehörte und die wichtigsten literarischen Neuerscheinungen regelmäßig in die Apotheke flatterten. Schon bald schrieb der Lehrling seine ersten Gedichte, die neben einer Versnovelle am Ende seiner Ausbildungszeit im Berliner Figaro zum Jahreswechsel 1839/40 erschienen.
Der zukünftige Apotheker und der Schriftsteller Theodor Fontane lebten so nebeneinander bis er nach dem Militärdienst, seiner Approbation und der Revolution von 1848 sein Apotheker-Dasein an den Nagel hängte und das Wagnis einging, als freier Schriftsteller zu reüssieren. In den Beruf des Apothekers kehrte er danach nie wieder zurück. In der auf die Revolution folgenden Zeit der Reaktion unter König Friedrich Wilhelm IV. und Ministerpräsident Freiherr von Manteuffel bedeutete diese Entscheidung den Verzicht auf ein bürgerliches Leben in Sicherheit und Wohlstand. Dieses Risiko ging er trotz der überaus widrigen Umstände ein. Er spielte Vabanque, wie es sein Vater auch getan hatte und vertröstete seine Verlobte Emilie Rouanet-Kummer auf bessere Tage. Es waren seine Freunde, die er vor allem durch seine Aufnahme in den Tunnel über der Spree, einem literarischen Club, gefunden hatte, die ihm über diese schwierige Anfangszeit hinweg halfen und ihm schließlich eine Anstellung als Lektor im Literarischen Kabinett bei Innenminister Manteuffel verschafften, der im Dezember 1850 zum Staatsminister aufstieg. Dies war nun deshalb besonders prekär, weil er zuvor auf der Seite der Revolution gestanden hatte. Wider Willen nahm er seine Arbeit in der preußischen Regierung auf. Es fiel ihm schwer als inzwischen durchaus anerkannter Dichter, im »Tunnel« hatte er seine ersten Gedichte mit Erfolg vorgestellt und die Balladen Männer und Helden sowie den Romanzenzyklus Von der schönen Rosamunde veröffentlicht, sich in subordinierter Stellung abzurackern für eine Politik, die er entschieden ablehnte. Doch als seine Dienststelle zum Ende des Jahres vorübergehend aus politisch-organisatorischen Gründen aufgelöst wurde, erfuhr er, dass er als freier Schriftsteller nur in bitterer Armut leben konnte. Da er im Glauben ein hinreichendes Einkommen zu haben, im Oktober 1850 geheiratet hatte und sich alsbald die Geburt seines Sohnes Georg ankündigte, kehrte er ohne Zögern in die Dienste des preußischen Staates zurück, als sich die Chance dazu bot. Ihm diente er in verschiedenen Verwendungen, u. a. verbrachte er mehr als fünf Jahre in London, bis zum Jahresende 1860. In dieser für sein Leben prägenden Zeit war er auf vielfältige Weise schriftstellerisch tätig. Zu seinen herausragenden Arbeiten zählten Ein Sommer in London 1954, die Ballade Archibald Douglas und seine Reise durch Schottland, die 1860 als Vorläufer der Wanderungen unter dem Titel Jenseit des Tweet erschien.
Zum Entsetzen seiner Familie und Freunde verließ er die gut dotierte Stelle in London, heute würden wir sagen als Kulturattaché der preußischen Botschaft, um wieder als Schriftsteller tätig zu werden. Abermals entschied er sich gegen eine bürgerliche Existenz, um als freier Schriftsteller zu arbeiten; abermals musste er erfahren, dass sein ungeheurer Fleiß, seine Arbeitsdisziplin und sein Talent nicht ausreichten, um seine Familie zu ernähren. Doch das ihm von der Mutter mit ins Leben gegebene Verantwortungsbewusstsein, auch wenn er es immer wieder strapazierte und seine arme und geduldige Frau vor kaum überwindbare Probleme stellte, veranlasste ihn einmal mehr, sich den Notwendigkeiten zu stellen und über seinen Schatten zu springen.
Nach sechs Monaten ohne feste Anstellung begann er als sog. englischer Korrespondent in der erzkonservativen Kreuzzeitung, die bis dahin nicht zu seinen bevorzugten Blättern zählte. Zwar hatte er während seines Aufenthaltes in England dort schon hin und wieder publiziert, doch die freie Mitarbeit bedeutete etwas völlig anderes als die feste Anstellung in einem Blatt, dass als Reaktion auf die Revolution ins Leben gerufen worden war und das Eiserne Kreuz als Emblem im Titel trug. Die »Kreuz« stand dem Hofe und der preußischen Regierung nahe. Einmal mehr erwies Fontane sich als pflichtbewusst, wenn es darum ging, die Existenz der Familie zu sichern. Jedoch ist zu erwähnen, dass die Redaktion der »Kreuz« ihren Mitarbeitern erhebliche Freiräume bot, solange sie zu Krone und Staat loyal blieben. Dies war für Fontane selbstverständlich. Er musste sich nicht verbiegen und lernte das Arbeitsklima mehr und mehr schätzen. Bei der »Kreuz« schrieb er seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg, hier versuchte er sich als Berichterstatter der drei preußischen Kriege und publizierte seine ersten Kriegsbücher. Hier machte er sich einen Namen als dem Staat und dem Adel verpflichteter Autor. Rückblickend bezeichnete er diese Jahre als die glücklichsten zehn Jahre seines Lebens.
Fontane war ein Meister der Anpassung. Aber ihn als Opportunisten zu bezeichnen, wäre falsch. Er lebte vielmehr in dem Spannungsverhältnis, sein Pflichtbewusstsein und sein Arbeitsethos mit seinem Leben als unbekümmerter und zur Leichtsinnigkeit neigender Künstler, kurz Bohemien, sein Streben nach einem bürgerlichen Leben in Wohlstand mit seiner schriftstellerischen Leidenschaft, seine öffentliche Anerkennung als angesehener Autor mit seinem Erwerbsleben in Einklang zu bringen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, gelang es ihm auch in staatlichem Auftrag, seine Haltung zu bewahren und seine Ideale zu verteidigen. Er strebte nach einem Leben in Freiheit in einer humanen Gesellschaft. Doch immer wieder machten ihm sein Geltungsbedürfnis, seine Abneigung gegen jedwede Form der Subordination und seine Eitelkeit einen Strich durch die Rechnung. So kam es im April 1870 nach einer Kontroverse mit dem Chefredakteur zu einer abrupten Beendigung der Zusammenarbeit, weil Fontane keine dauerhafte Zukunft mehr für sich in der »Kreuz« sah. Er nutzte die Reise seiner Frau nach London, damit er sich nicht vor ihr rechtfertigen musste und erklärte sich in ihrer Abwesenheit. Eine schwere Ehekrise war die Folge, denn Emilie fürchtete nicht zu Unrecht, erneut in wirtschaftliche Turbulenzen mit nunmehr vier Kindern zu geraten. Denn trotz beachtlicher literarischer Erfolge und öffentlicher Anerkennung reichten die Einnahmen ihres Mannes nur schwerlich aus, ein standesgemäßes Leben zu führen.
Einmal mehr stand das Glück Fontane zur Seite. In der liberalen Vossischen Zeitung wurde die Stelle des Theaterkritikers frei. Er bewarb sich und erhielt den Zuschlag, obwohl zwischen der »Vossin«, wie er sie nannte, und der »Kreuz« politisch Welten lagen. Mehr als einmal hatte Fontane erfahren, mit welcher Ablehnung gerade in liberal-intellektuellen Kreisen von der »Kreuz« gesprochen wurde. Den Zuspruch erhielt er nicht als politischer Redakteur, sondern als anerkannter und inzwischen über Berlin hinaus geschätzter Schriftsteller. So hielt diese Zusammenarbeit, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, fast zwanzig Jahre. Fontane eröffneten sich dadurch neue Leserkreise. Er wurde zu einer stadtbekannten Persönlichkeit. Seine Kritiken setzten Maßstäbe, obwohl er im engeren Sinne des Wortes kein Theaterfachmann war. Vielmehr erwies er sich als ein hellsichtiger, feinfühliger Beobachter, der seine Unabhängigkeit nutzte und mit eigenem unverstellten Blick auf die Bühne schaute. Dabei hatte er den Zeitgeist stets fest im Blick. Schnell geriet seine vorherige Verbindung zur »Kreuz« bei den Lesern seiner Theaterkritiken in Vergessenheit. Unterbrochen wurde seine Tätigkeit durch den deutschfranzösischen Krieg und seine Bewerbung auf die Stelle als »Ständiger Sekretär der Akademie der Künste«. Diese hochdotierte und angesehene Beamtenstelle weckte sein Interesse. Er sah darin die Chance, seine berufliche Laufbahn auf festen Grund zu stellen und endlich einen Weg einzuschlagen, der ihm nicht nur hohes Ansehen verschaffen würde, sondern auch im Alter feste, gut auskömmliche Bezüge. Der alte Widerstreit zwischen einem Künstlerleben in Freiheit und einem Beamtenleben in Abhängigkeit trat erneut hervor. Dass seine Frau diese Bewerbung unterstützte, versteht sich nach den zurückliegenden Turbulenzen des Schriftsteller-Daseins von selbst. Seine Majestät äußerte Bedenken, da er in Fontane nicht den für diese Position geschaffenen Kandidaten erblickte. Dennoch gelang es mit Hilfe seiner Freunde aus dem Umfeld des »Tunnels«, diese Vorbehalte zu überwinden. Im März 1876 wurde er in sein neues Amt eingeführt. Doch die Bedenken des Königs von Preußen und Deutschen Kaisers Wilhelm I. bestätigten sich. Fontane zeigte sich dem Ränkespiel zwischen den Akademie-Oberen und den allgemeinen Akademie-Angelegenheiten nicht gewachsen und reichte nach wenigen Wochen sein Entlassungsgesuch ein. Da der preußische König ihn förmlich berufen hatte, musste er ihn auch um »gnädigste Entlassung« bitten. Seinem Verhältnis zu Wilhelm I. war dies nicht förderlich. Emilie war schockiert. Die Ehe stand vor dem Scheitern. Doch Fontane konnte auf seine Position als Theaterkritiker zurückkehren, so dass diese Episode keine erneuten existenziellen Probleme auslöste. Eher war das Gegenteil der Fall. Fortan kannte Fontane seinen Platz in der Gesellschaft und Familie. An der Seite seiner Frau schlug er als Schriftsteller ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Nie mehr trug er sich fortan mit dem Gedanken, eine feste Anstellung beim Staat oder bei Hofe anzunehmen. Vielmehr ließ er sich auf das ein, was er schon immer sein wollte: zu allererst Fontane – ein freier, nur sich selbst verpflichteter Schriftsteller.
Inzwischen Mitte Fünfzig gelang es ihm, noch einmal von vorne anzufangen, oder sollten wir sagen, als Schriftsteller einen neuen Weg einzuschlagen. Denn er blieb seiner Mitgift verbunden. Er begann seinen bereits vor Jahren begonnenen, aber immer wieder unterbrochenen Roman Vor dem Sturm zu vollenden. Er erschien 1878. Sein »Schmerzenskind«, weil er nach vielen inneren Widerständen endlich fertig gestellt wurde, entwickelte sich zu einem Debut mit weitreichenden poetischen Perspektiven. Seinem Verleger Wilhelm Herz schrieb er Ende der siebziger Jahre: »so lächerlich es klingen mag, ich darf – vielleicht leider – von mir sagen: ›ich fange erst an.‹ Nichts liegt hinter mir, alles vor mir; ein Glück und ein Pech zugleich.« Mit knapp sechzig Jahren war dies im 19. Jahrhundert eine mutige Ansage, die einmal mehr davon zeugte, dass Fontane mit einem guten Selbstbewusstsein und noch größerem Lebensoptimismus ausgestattet war. Beides hatte ihm besonders sein Vater mit auf den Weg gegeben. Und er sollte in dieser Lebenseinschätzung Recht behalten. Die Kritik bescheinigte ihm, ein großes Thema mit tiefem Ernst aber eben so viel Humor gestaltet zu haben.
In den folgenden Jahren schrieb Fontane zahlreiche weitere Romane und leitete damit nach eigenem Empfinden die literarisch produktivste Phase seines Lebens ein. Sie wurde zu einer Erfolgsstory, die bis in unsere Tage hineinreicht. So gesehen bewirkte die Episode als Sekretär der Akademie der Künste einen Wandel, der Fontane zu sich selbst führte und die auf sein Leben einwirkenden schöpferischen aber auch widersprüchlichen Kräfte harmonisierte. Seine späten Romane zeugen von dem »neuen« Fontane, der sich allerdings bereits mit Vor dem Sturm ankündigt hatte. In seinem Alterswerk – Unwiederbringlich, Frau Jenny Treibel, Die Poggenpuhls und eben die Meisterwerke Effi Briest und Der Stechlin – fand er zu einer Schreibweise, die später als »Fontane-Ton« charakterisiert wurde. Mit seinem unnachahmlichen, verbindlich daherkommenden Plauderton gelang es ihm, das allzu Menschliche mit einer sanften Gesellschaftskritik zu verbinden. Ohne zu verletzen oder zu schulmeistern hielt er seinen Zeitgenossen den Spiegel vor. Diese »verantwortungsvolle Ungebundenheit«, wie sie Thomas Mann bezeichnete, erlaubte ihm, die Neureichen wie den sich an seine Privilegien klammernden Adel in die Pflicht zu nehmen und auf ihre gesellschaftliche Verantwortung hinzuweisen. Während dies in seinen Romanen in abwägender, stets vermittelnder Form geschah, die dem vorgetragenen Urteil oder der geäußerten Meinung Raum für Widerspruch ließ und dieser auch formuliert wurde, äußerte er sich in seinen Briefen oft unverblümt über die ihn bekümmernden Zeiterscheinungen. Dabei schonte er weder den Kaiser noch seine Umgebung. Bismarck, den er in mehreren Gedichten würdigte und in seinen Romanen hier und da mit kleinen Episoden einflocht, nahm er einerseits gegenüber Kaiser Wilhelm II. in Schutz, andererseits bezeichnete er ihn als größten Prinzipienreiter und zugleich größten Prinzipienverächter, je nachdem, wie es die politische Situation gerade erforderte. Fontane war kein Bismarckianer, aber er würdigte seine außergewöhnlichen Leistungen als Staatsmann. Dieses Sowohl-als-auch, die Achtung und der Respekt vor dem Alten und die Offenheit und Zugewandtheit gegenüber dem Neuen, wurde zur Partitur seiner »Lebensmusik« im Alter. Sein sich aus Tradition und Geschichtsbewusstsein speisender Konservatismus verband sich hier mit einer zukunftsoffenen Modernität, die dem Wandel der Zeit gerecht zu werden versuchte.
Die unterschiedlichen Veranlagungen der Eltern und die Umgebung, in die Fontane hineinwuchs, prägten seinen Lebensweg. Sie halfen ihm, schwierige Zeiten zu meistern, führten ihm aber auch oft den Abgrund vor Augen. Schließlich, wenn auch erst in fortgeschrittenem Alter, fand er für sich einen Weg, diese Mitgift produktiv für sich als freier Schriftsteller zu nutzen. In dem Roman Schach von Wuthenow heißt es im Schlusskapitel: »Ein Rest von Dunklem und Unaufgeklärtem bleibt, und in die letzten und geheimsten Triebfedern andrer oder auch nur unsrer eignen Handlungsweise hineinzublicken, ist uns versagt.« So ist es wohl auch. Und deshalb kann diese Einleitung auch nicht mehr sein, als der Versuch einer Annäherung an einen großartigen, in seiner Menschenkenntnis, Beobachtungsgabe und poetischen Kraft herausragenden Schriftsteller.
Die Auswahl der nachfolgenden Texte spiegelt die literarische und zeitkritische Entwicklung des Autors. Zudem zeigt sie seine Vielfältigkeit und Meisterschaft als Dichter, Schriftsteller, Briefeschreiber und Publizist. Neben sehr bekannten Texten finden sich auch solche, die in Vergessenheit geraten sind oder weniger Beachtung gefunden haben, aus welchen Gründen auch immer. Allen gemeinsam ist, dass ihnen etwas Besonderes eigen ist. Dieses Besondere ergibt sich daraus, dass sie wie etwa die Balladen und einzelne Gedichte über Jahrzehnte zum Literaturkanon zählen. Es ergibt sich aber auch aus der getroffenen Zusammenstellung selbst und aus dem Eigenleben, das sie als Auszug aus einem größeren Zusammenhang dadurch zu entwickeln vermögen, weil sie sich hier ein Stückchen weit verselbständigen, so dass sie inhaltlich und sprachlich ihre Kraft und ihren Glanz losgelöst von einem weiteren Kontext entfalten können.
Die Gedichte und Balladen werden ungekürzt wiedergegeben. Sie finden sich zum Teil in einzelne Kapitel eingestreut, wenn sich dies thematisch empfiehlt. Das Kapitel 3: »Vom Pathos zum Alltäglichen, von der Geschichte zur Gegenwart« schenkt ihnen besondere Aufmerksamkeit. Fontane hat bis zu seinem Lebensende Gedichte geschrieben. Verse zu schmieden, gehörte zu seinem Leben. Doch so wie sich seine Prosa im Alter veränderte, veränderten sich auch seine Gedichte. Dies soll hier sichtbar werden.
Die Texte sind in acht Kapitel gegliedert, in die eingeführt wird. Die Überschriften stammen von Fontane, wenn nicht sind sie durch * gekennzeichnet. Zitiert wird nach der Nymphenburger Gesamtausgabe von 1959 ff., die Briefe nach der Gesamtausgabe von Hanser 1976 ff.
Günther Rüther