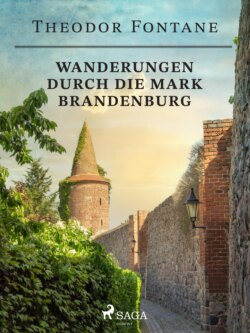Читать книгу Wanderungen durch die Mark Brandenburg - Theodor Fontane, Theodor Fontane - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Neustadt a. D.
ОглавлениеAuf der langen Bohlenbrücke,
Drüber unsre Schritte dröhnen,
Wandeln wir mit heitrem Blicke
In die Stadt; kühl sind die Straßen,
Blank die Steine, kannst du's fassen?
Du betrittst sie ganz alleine.
Wer kennte nicht Neustadt? Aber wenn es einerseits zu den Städten gehört, von denen die Welt nur den Bahnhof kennt, so gehört es andererseits zu denen, die beständig verwechselt werden.
Uns gegenüber im Coupé sitzt eine blasse Dame von sechsunddreißig und mustert abwechselnd das Bahnhofstreiben und das Bahnhofsgebäude.
»Neustadt an der Dosse... Hier ist ja wohl eine Forstakademie?«
Der Angeredete, den ich meinen Lesern kurzweg als einen Onkel Bräsig der Neustädter Territorien vorstellen möchte, verbeugt sich artig und antwortet: »Nein, meine Gnädigste, die Forstakademie ist in Neustadt-Eberswalde.«
»Richtig. Ich meinte ein Irrenhaus.«
»Bitte um Entschuldigung, das ist auch in Neustadt-Eberswalde.«
»Aber ich dächte doch...«
»Ganz richtig, hier ist ein Gestüt.«
»Ein Gestüt?«
»Ja. Sehen Sie dort.«
»Aber mein Gott das ist ja eine Kirche.«
»Verzeihung, ich meine weiter links, dort, wo die Pappeln stehen.«
»Ah, so; dort.«
»Es gibt nämlich, wenn Sie sich dafür interessieren...«
»Oh, bitte.«
»... ein königliches und ein Landesgestüt, und durch Heranziehung arabischer...«
»Ah, so... Wie weit haben wir noch bis Wittenberge?«
Der Zug rasselt inzwischen weiter. Nur der Leser und ich sind ausgestiegen, um Neustadt, an dem wir zahllose Male vorübergefahren, endlich auch in der Nähe kennenzulernen. Ein anmutiger Spaziergang, bei sinkender Septembersonne, führt uns ihm entgegen. Unterwegs, von einer Brückenwölbung aus, erfreut uns der Blick über einen weiten Wiesengrund und die kanalartig regulierte Dosse. Fünf Minuten später haben wir die Stadt erreicht, eine einzige Straße, darauf rechtwinklig eine andere mündet. Da, wo sich beide berühren, erweitern sie sich und bilden einen Marktplatz, an dem die »Amtsfreiheit« und die Kirche gelegen sind. Am äußersten Ende der Längsstraße das Gestüt. Auf einen Besuch dieser berühmten Vorbereitungsstätte für unsere Kavalleriesiege verzichten wir und begnügen uns damit, unsere Aufmerksamkeit auf Stadt und Vorstadt und insonderheit auf die Geschichte beider zu richten.
Diese (wenigstens bis in die zweite Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts) ist in wenig Zeilen erzählt.
Burg oder Schloß Neustadt gehörte 1375, wie das Landbuch Kaiser Karls IV. ausweist, dem Lippold von Bredow. Später an die Ruppiner Grafen übergehend, war es zeitweilig den Quitzows, den Bredows, den Rohrs verpfändet, bis es, nach dem Erlöschen des gräflichen Hauses von Lindow-Ruppin (1524), dem Kurfürsten zufiel. Aber neue Pfandinhaber folgten, und erst 1584 kam es erb- und eigentümlich an Reimar von Winterfeldt. Die Winterfeldts besaßen es bis zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, an dessen Ende wir Neustadt plötzlich in eine Epoche berühmter historischer Namen eintreten sehen. Es waren dies:
Feldmarschall Graf Königsmarck von 1644 bis 1662;
Prinz Friedrich von Hessen-Homburg von 1662 bis 1694;
Eberhard von Danckelmann (nicht als Besitzer, aber als kurfürstlicher Amtshauptmann) von 1694 bis 1697.
Nach dieser Zeit hören die historischen Namen wieder auf, und »Amt Neustadt« wird ein kurfürstliches respektive königliches Amt wie andere mehr.
Aus der Graf Königsmarckschen Zeit ist wenig zu berichten. Der Graf hat mutmaßlich seine Neustädter Besitzungen nie gesehen, begnügte sich vielmehr damit, sie durch seinen Regimentsquartiermeister Liborius Eck in allerdings mustergiltiger Weise verwalten zu lassen. 1662 ging das Gut, wie schon vorstehend erwähnt, an den Hessen-Homburger Prinzen über, wodurch ein Zeitabschnitt eingeleitet wurde, bei dem wir eingehender zu verweilen haben werden.
Prinz Friedrich von Hessen-Homburg
Nehmt den besten Reiterhaufen,
Folgt dem Feind und macht ihn laufen,
Aber laßt Euch nicht verleiten,
Ernstlich Euch herumzustreiten.
Prinz Friedrich von Hessen-Homburg, dies sei voraus bemerkt, war vor allem nicht der, als der er uns in dem H. von Kleistschen Schauspiel entgegentritt. Der H. von Kleistsche und der historische Prinz von Homburg verhalten sich zueinander wie der Goethesche und der historische Egmont. Sie waren in der Zeit, wo sie hervortraten, keine Liebhaber und keine Leichtfüße mehr, vielmehr ernste Leute von mittleren Jahren und reichem Kindersegen, überhaupt ebenso gute Ehemänner wie Patrioten.
Unser Prinz Friedrich ward am 30. Mai 1633 geboren. Er war der zweite Sohn des Landgrafen Friedrich von Hessen, des Stifters der homburgischen Linie. Er trat jung in schwedischen Dienst, war 1658 mit vor Kopenhagen und verlor bei dieser Belagerung ein Bein. Dasselbe wurde künstlich ersetzt, weshalb er seitdem der » Prinz mit dem silbernen Bein« hieß. Neben Götz von Berlichingen wohl der einzige Fall einer derartigen Namensgebung. Die Belagerung von Kopenhagen fiel in die glänzende Regierungszeit Karl Gustavs von Schweden, nach dessen plötzlichem Tode, 1660, unser Homburger Prinz sich zurückgesetzt fühlte, weshalb er denn auch den Abschied nahm. Wahrscheinlich 1661.
Um ebendiese Zeit (1661) hatte er sich mit der Gräfin Margarete Brahe, die übrigens bereits Witwe zweier Grafen Oxenstierna war, vermählt und übersiedelte nach Weferlingen, einem schönen Gute im Magdeburgischen, das ihm durch seine Gemahlin zugebracht worden war. Hier, von Weferlingen aus, kam er an den Berliner Hof, trat in die Armee des Kurfürsten, erhielt ein Regiment und wurde später, 1670, zum General der Kavallerie erhoben.
Ziemlich gleichzeitig mit seinem Eintritt in unsere Armee hatte er sich auch im Brandenburgischen ansässig gemacht und Amt Neustadt, das, wie wir wissen, seit 1644 in Händen des Grafen Hans Christoph von Königsmarck war, von ebendiesem erstanden. Dies war 1662. Er nahm nun, wenigstens zeitweilig, seinen Aufenthalt an genanntem Ort, und alles, was Neustadt in diesem Augenblick ist, ist es im wesentlichen durch Prinz Friedrich von Hessen-Homburg. Er besaß es zweiunddreißig Jahre lang, aber nur sechzehn Jahre (bis 1678) konnt er ihm seine besondere Aufmerksamkeit widmen. Diese sechzehn Jahre genügten jedoch. Ja, wenn dieser Zeitabschnitt auch noch wieder halbiert worden wäre, würde dadurch an dem Gesamtresultate seines Schaffens an ebendieser Stelle nichts Erhebliches geändert worden sein, denn er griff so rasch und energisch ein, daß bereits zwei, höchstens vier Jahre nach Übernahme des Besitzes all das begonnen war, was spätere Jahrzehnte nur glänzender hinausführten. Auf dies »erste Beginnen« kommt es allezeit an. Ob dasselbe, Mal auf Mal, bei ihm selber oder bei seiner Gemahlin, der Gräfin Brahe, oder aber bei dem schon rühmlich erwähnten Amtsverwalter Liborius Eck lag, den er, als einen höchst fähigen Administrator aus der Königsmarckschen Zeit her, mit übernommen hatte, gilt gleich; die oberste Herrschaft gibt den Namen, und die Hessen-Homburgische Zeit ist und bleibt die große Epoche von Neustadt.
Bei Übernahme des Gutes bestand es aus sieben Bauerhöfen, einer Schmiede und einer Mühle, war also kleiner als das kleinste Dorf. Die Bewohner zahlten keine Abgaben, hatten aber Dienste auf dem Amte zu leisten. Das war das Neustadt von 1662. Zwei Jahre später (1664) bestand es bereits aus siebenundvierzig Bürgerhäusern und einer Vorstadt, in welcher letzteren sich weitere fünfundzwanzig Familien niedergelassen hatten; dem Orte selbst aber war auf Antrag des rastlosen und bei Hofe einflußreichen Prinzen Stadtgerechtigkeit und das Recht zwei Jahrmärkte abhalten zu dürfen, zugestanden worden. Das gleichzeitig empfangene Wappen setzte sich links aus einem Elentier, rechts aus einem springenden Löwen zusammen, wovon sich der Löwe mutmaßlich auf den Prinzen, das Elentier auf die Stadt bezog.
Aber bei dem bloßen Bauen und Stellenbesetzen ließ es der Prinz nicht bewenden, vielmehr ging durch seine ganze Tätigkeit ein organisatorischer Zug, dem es nicht genug war, überhaupt etwas zu tun, sondern vor allem das praktisch Richtige zu tun. Das Nächste war eine Regulierung der Dosse, die damals, wie noch jetzt die Spree im Spreewald, in zahllosen Armen durch die Dosse-Niederung floß. Der herrliche Wiesenstand, der auf diese Weise gewonnen wurde, leitete zu sorgsamer und eifriger Pferdezucht und dadurch zu den Anfängen der späteren Gestüte hinüber. Der Raseneisenstein, der sich vorfand, ließ eine Eisenhütte, der reiche Holzbestand eine Glashütte entstehn, an der Dosse selbst hin aber erwuchsen einerseits Schleifereien für das gewonnene Glas, andererseits Papier- und Schneidemühlen. Wer Kolonisierung studieren will, muß die Geschichte von Mark Brandenburg studieren. Aber wenn die ganze Provinz nach dieser Seite hin ein sehr lehrreiches Beispiel bietet, so bietet vielleicht unser Neustadt von 1662 bis 1666 ein Muster unter den Musterstücken.
Das Jahr 1666 schien freilich ausersehen, alles wieder in Frage zu stellen. Die siebenundvierzig Bürgerhäuser brannten nieder, mit ihnen das Amt, das mutmaßlich dem Prinzen als Wohnung gedient hatte. Zugleich auch die reformierte Kapelle. Eine Stadtkirche gab es noch nicht. Erhalten blieben (vorläufig) nur die vorstädtischen Fabrikbezirke, soweit von »Vorstadt« und »Fabrikbezirken« damals die Rede sein konnte.
Prinz Friedrich indes, tapfrer Soldat, der er war, ließ sich diesen Unheilstag nicht allzu schwer anfechten, und die niedergebrannte Stadt wurde schöner und größer wieder aufgebaut. Von einem Rathausbau sah er vorläufig ab, und nur der Errichtung eines Gotteshauses schenkte er seine volle Aufmerksamkeit. Schon 1673 konnte der Grundstein zur Kirche gelegt, 1686 dieselbe geweiht werden. Lange vorher jedoch hatten sich Ereignisse zugetragen, zu denen, wenn auch nicht die Stadt Neustadt als solche, so doch ihr Besitzer, der Prinz, in die nächsten Beziehungen getreten war.
Diesen Ereignissen wenden wir uns jetzt zu.
Der Dienst, selbstverständlich, hielt den Prinzen monatelang von seinem geliebten und mit Vorliebe gepflegten Neustadt fern. War dies schon in ruhigen Zeiten der Fall, so vollends in Kriegszeiten, wie sie seit 1674 wieder angebrochen waren. Der Prinz befand sich (1675) mit seinem kurfürstlichen Herrn im Elsaß, danach in Franken, allwo den 18. Mai, im Lager vor Schweinfurt, die Nachricht vom Einfall der Schweden in die Mark Brandenburg eintraf. Der Kurfürst brach sofort auf, mit ihm der Prinz. Am 11. Juni war er in Magdeburg, am 14. vor Rathenow und nahm von hier aus, nach Erstürmung ebendieser Stadt durch Derfflinger, an jener berühmt gewordenen Verfolgung teil, die der schwedischen Armee schon am 16. und 17. in verschiedenen Avantgarden-Gefechten erhebliche Verluste beibrachte. Am 17. waren die verfolgenden Brandenburger bis Nauen gekommen. Von hier aus schrieb unser Prinz, dem für den nächsten Tag eine so bedeutende Rolle vorbehalten war, an seine Gemahlin folgenden Brief:
»Meine Engelsdicke, wir seint braff auf der jacht mit den Herren Schweden, sie seint hier beim passe Nauen diesen morgen übergegangen, musten aber bei 200 Todten zurückelassen von der arrier guarde; jenseits haben wir bei Fer-Berlin alle brücken abgebrant und alle übriche paesse so besetzet, das sie nun nicht aus dem Lande wieder können. Sobald unsere infanterie kombt, soll, ob Gott wolle, die ganze armada dran. Der schwedische Feldherr war mit 3000 Mann in Havelberg, wollte die Brücke über die Elbe machen lassen, aber nun ist er von der armada abgeschnitten und gehet über Hals und Kopf über Rupin nach pommern. Sein Bruder commandirt diese 12 000 mann hier vor uns. Wo keine sonderbare straff Gottes über uns kombt, soll keiner davon kommen, wir haben dem Feind schon über 600 todtgemacht und über 600 Gefangene. Heute hat Henning wohl 150 pferth geschlagen, und gehet alleweil Lüttique mit 1500 Mann dem Feindt in ricken. Morgen frihe werden sie ihnen den 1. morgensegen singen. Wir haben noch kein 60 mann verlohren, und unsere leite fechten als lewen. – In zwei Tagen haben wir unsere infanterie und morgen den Fürsten von Anhalt mit 4000 mann, die Kayserlichen werden alle Tage erwartet mit 8000 mann. Dann gehen wir gerath in pommern, und wenn die battaglie vorbey, gehe ich nach Schwalbach, habe schont Urlaub. – Adieu, mein Engel, dein trewer Mann und diner sterb ich.
Friedrich L. z. Hessen
Ich kann wegen affaires unmöglich mehr schreiben.«
Nichts kann uns eine bessere Vorstellung geben von der Stimmung, welche im brandenburgischen Heere herrschte, zumal auch von der des Prinzen selbst, der nunmehr auf vierundzwanzig Stunden in die vorderste Linie tritt. Am folgenden Tage, am »Tage von Fehrbellin«, führte er die Avantgarde, hing sich mit dieser an die Schweden, brachte sie zum Stehen und wurde so die vorzüglichste Ursache zum Siege über dieselben. Verfuhr er anders, so entkam der Feind. Er selber hat über diese glänzende Aktion am Tage darauf (19.), von Fehrbellin aus, abermals in einem Briefe an seine »Engelsdicke« berichtet. Der Brief lautet:
»Allerlibste Frawe!
Ich sage nun E. L. hiermit, das ich gester morgen, mit einichen Tausent mann in die advanquart commandiret gewesen, auff des Feindtes contenance achtung zu haben, da ich denn des Morgens gegen 6 Uhr des Feindtes gantzer armé ansichtig wurde, der ich dann so nahe ging, das er sich muste in ein Scharmützel einlassen, dadurch ich ihn so lange auffhielte, bis mir I. Dl. der Churfürst mit seiner gantzen Cavallerie zu Hülffe kam. Sobalten ich des Churfürsten ankunft versichert war, war mir bang, ich möchte wider andere ordre bekommen, und fing ein hartes treffen mit meinen Vortruppen an, da mir denn Dörffling soforth mit einichen Regimentern secontirte. Da ging es recht lustig ein stundte 4 oder 5 zu, bis entlichen nach langem Gefechte die Feindte weichen musten, und verfolgten wir sie von Linum bis Fer-Berlin, und ist wohl nicht viel mehr gehört worden, daß eine formirte armee, mit einer starken infanterie und canonen so wohl versehen, von bloßer Cavallerie und tragonern ist geschlagen worden. Es hilte anfenglich sehr hart; wie denn meine Vortruppen zum zweidten mahl braff gehetzet wurden, wie noch das anhaltische und mehr andere regimenter. Wie wir denn entlichen so vigoureusement drauff gingen, das uns der Feind le champ de battaglie malgré hat lassen, und sich in den passe Fer-Berlin retiriren muste, mit Verlust von mehr als 2000 Todten ohne die plessirten. Ich habe, ohne die zweitausend im Vortrupp commandirten, mehr als 6 oder 8 escatronen angeführet. Zuweilen must ich lauffen, zuweilen machte ich laufen, bin aber diesesmahl Gottlob ohn plessirt davongekommen. Auf schwedischer seiten ist gepliben der Obrist Adam Wachtmeister, Obr.-Liet. Malzan von General Dalwichens (Regiment) und wie sie sagen noch gar viele hohe oficirer; Dalwig ist durch die achsel geschosen, und sehr viele hart plessirt. Auf unser seiten wurde mir der ehrliche Obrist Mörner an der Seiten knall und falle todt geschossen, der ehrliche Frobenius todt mit einem stücke, kein schrit vom Kurfürsten. Strauß mit 5 Schossen plessirt; Major Schlapperdorf blib diesen Morgen vor Ferberlin; – – es ging sehr hart zu, da wir gegen die biquen Compani fechten musten, ich bin etzliche mahl ganz umringet gewesen, Gott hat mir doch allemahl wider drauss geholfen, und wehren alle unsere stücke und der Feld-Marschalk selbsten Verlohren gewesen, wenn ich nicht en personne secundiret hette. Darüber denn der retliche Mörner blieb. Hetten wir unsere infanterie bey uns gehabt, solte kein mann von der gantzen armée davon gekommen sein, es ist jetzo eine solche schreckliche terreur panique unter der schwedischen Armee, das sie auch nur braff lauffen können. – – Nachdeme alles nun vorbey gewesen, haben wir auff der Walstett, da mehr als 1000 Todten umb uns lagen, gessen und uns braff lustig gemacht; der Hertzog von Hannover wird nun schwerlich gedenken über die Elbe zu gehen, und ich halte davor, weilen die schweden nun so eine harte schlappe bekommen, er werdte sich eines besseren bedencken. Wangelin, der durch Uebergab von Ratenau viel daran schultig ist, dörffte grose Verantwortung haben, wo er nicht gar den Kopfe lassen mus. Gegeben im Feldlager bei Fer-Berlin den 19. Juni 1675.«
Dieser Brief (an einer Stelle vielleicht lückenhaft; es scheint ein Nachsatz zu fehlen) ist, wie der vorige, nicht nur bezeichnend für die Frische und Anspruchslosigkeit des Schreibers, er ist auch historisch wichtig, weil er die älteren Berichte über diese Schlacht wie sie sich im »Theatrum Europaeum«, im Pufendorf etc. finden, bestätigt und die erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts auftretende Sage von Insubordination, kurfürstlichem Zorn und Kriegsgericht aufs evidenteste widerlegt. »Wir haben uns nachher recht lustig auf der Walstatt gemacht.« Diese Worte des Briefes passen schlecht zu einem angedrohten Kriegsgericht. Nicht Angeklagter, wohl aber Kläger scheint er später gewesen zu sein. Wenigstens finden wir in einem Briefe, den seine Schwägerin am 19. Oktober 1675 an den Grafen von Schwerin schreibt, folgende Stelle: »Dem redlichen Landgrafen ist nicht eins gedankt von dem, das er bei Fehrbellin getan; also geht es in der Welt, die Pferde, die den Haber verdienen, bekommen am wenigsten.«
Alle diese Verstimmungen können aber nicht ernster Art gewesen sein. 1676 sehen wir den Prinzen aufs neue mit seinem kurfürstlichen Herrn im Felde, und nachdem er sich bei der Eroberung von Pommern an der Seite desselben abermals ausgezeichnet hat, erhält er von ihm die erledigten Wachtmeisterschen und Rheinschildschen Lehne als ein Geschenk.
Der Verwaltung dieser aber (ebenso wie der seines vielgeliebten »Amtes Neustadt«) konnt er sich von da ab nicht mehr unterziehen. Zwei Jahre später schon, 1678, fiel ihm, nach dem Ableben seines Bruders Wilhelm, die Grafschaft Hessen-Homburg zu. Größeres lag ihm nunmehr ob, und das Kleinere, das so viele Jahre lang der Gegenstand seiner liebevollen Sorge gewesen war, mußte daneben zurückstehen. Die Administration der märkischen Güter ward immer schwieriger, und so sprach er denn – nachdem er übrigens im Jahre 1679 noch Amt Neustadt durch Ankauf des Lüderitzschen Rittergutes Dreetz erweitert hatte – seine Bereitwilligkeit aus, besagtes Amt an den Kurfürsten Friedrich III. käuflich abzutreten. Dies war 1694.
Was er aber bis dahin gegründet hatte, lebte fort und prosperiert (wenigstens teilweis) bis diese Stunde noch. Überall hatte sein Blick das Richtige getroffen, das, was den gegebenen Bedingungen entsprach.
Er starb 1708.
Eberhard von Danckelmann
Zu spät, zu spät, liebe Lady mein,
Es ist nicht mehr, wie sonst es war,
Meine Feinde gelten bei Hofe jetzt.
Alte Ballade
1694 war Neustadt wieder ein kurfürstliches Amt geworden, und Eberhard von Danckelmann wurde zum Amtshauptmann bestellt.
Ein volles Lebensbild dieses hervorragenden Mannes zu geben kann an dieser Stelle nicht meine Aufgabe sein. Nur eine Skizze.
Christoph Balthasar Eberhard von Danckelmann wurde den 23. November 1643 zu Lingen geboren. Er war der in der Mitte stehende (vierte) von sieben Brüdern, die sich sämtlich im Staatsdienst auszeichneten, weshalb einem etwa um 1690 angefertigten Bildnis des Vaters dieser sieben die lateinische Unterschrift gegeben wurde:
Integra miretur sapientes Graecia septem,
Hie uni videas tot bona rara patri.
Der bekannte Oberzeremonienmeister und Hofpoet von Besser beglückwünschte später (1694) in einem Lob- und Huldigungsgedicht auf Eberhard von Danckelmann ebenfalls den Vater desselben und wußte bei dieser Gelegenheit den Inhalt obigen lateinischen Verses geschickt in seine Dichtung hineinzuverweben.
Dein Vater hatte mehr, als viel verlangen könnten,
Er hatte sieben Söhn' und alle bei dem Staat,
Drei sind Geheime Rät', und drei sind Präsidenten,
Des allerjüngsten Amt ist Kanzler sein und Rat.
Gewiß, wer dieses sieht, kann sicher von ihm preisen,
Was jener von ihm schrieb in kräftigem Latein:
»Das ganze Griechenland hat seine Sieben Weisen,
In seinen Söhnen hat sie Danckelmann allein.«
Soviel, vorgreifend, über das »Siebengestirn«. Wir kehren zu unsrem Eberhard von Danckelmann und unsrer biographischen Skizze zurück.
Von frühauf war er ausgezeichnet. In seinem zwölften Jahre doktorierte er in Utrecht und sprach über das schwierige Thema »De Jure Emphyteusis«, was ein solches Aufsehen in der wissenschaftlichen Welt machte, daß Beglückwünschungsschreiben von andern gelehrten Schulen eintrafen. Später reiste er und machte sich die wichtigsten Sprachen, Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch, zu eigen. Von Besser drückt sich über diese Tatsache, der zunächst (1663) die Ernennung Danckelmanns zum Director studiorum oder Ephorus beim Markgrafen, späteren Kurprinzen Friedrich gefolgt war, in nachstehenden Alexandrinern aus:
Du sahest und durchzogst die witzigsten Provinzen,
Und so, daß dein Verstand das Beste mit sich nahm –
Mit diesem Zubehör kamst du zu deinem Prinzen,
Bevor er aus der Hand des Frauenzimmers kam.
Das »Frauenzimmer« war natürlich die Gouvernante. Danckelmann bewährte sich in seiner Stellung als Prinzenerzieher. Er zeigte nicht nur Wissen, sondern auch besondere Feinheit des Geistes, was von Besser zu der selbst feinen Bemerkung veranlaßte:
Wer Prinzen Lehren gibt, polieret zarte Spiegel,
Drin, wer den Spiegel schleift, sein eigen Bildnis sieht.
1665 erfolgte seine Ernennung zum Titular-, 1669 zum halberstädtischen, 1676 zum kleveschen Geheimen Regierungsrat, Stellungen, die ihn wenigstens zeitweilig vom Berliner Hofe entfernen mußten. Aber nicht auf lange. 1679, inzwischen zum Geheimen Kammer- und Lehnsrat aufgestiegen, sehen wir ihn bereits wieder an der Seite des späteren Kurprinzen, dem er, um ebendiese Zeit, einen Beweis besonderer Anhänglichkeit und Treue zu geben in der Lage war. Er rettete nämlich den Prinzen aus einer tödlichen Krankheit, welche den letzteren im Winterfeldzuge 1679 in Preußen befiel. In einem interessanten Flugblatte, das den Titel führt: »Fall und Ungnade zweier Ersten-Staatsminister des königlich preußischen Hofes (Danckelmann und Wartenberg), Köln, bei Peter Marteau, 1712«, finde ich darüber folgendes: »Als des Kurprinzen Leben, wegen eines schweren Stickflusses, in höchster Gefahr war und während die Leibmedici sich nicht vergleichen konnten über die Arzenei, die dem Patienten gegeben werden sollte, hat Danckelmann ihm dasselbe durch ein gewagtes Aderlassen erhalten, wie schon alle Sinne verloren waren, und hat sich also, aus Liebe für seinen Prinzen, in eine große Verantwortung gesetzt.« So jenes Flugblatt. Danckelmann bewährte sich auch anderweitig: er opferte dem Kurprinzen sein Vermögen, und zwar »zu solcher Zeit, da sein Herr noch nicht auf dem kurfürstlichen Throne war, vielmehr, durch allerhand Intrigues von dem Hofe ferngehalten, eines solchen Vorschubes höchst benötigt war«.
1688, als der Kurprinz seinem Vater, dem Großen Kurfürsten, in der Regierung folgte, wurde Danckelmann zum Geheimen Staats- und Kriegsrat ernannt und ihm fast unumschränkt das Steuer der Regierung überlassen. Er schlug eine kluge, feste, von Erfolg gekrönte Politik ein, und wenigstens zu Lebzeiten Friedrichs I. ist seine Stelle nicht wieder ausgefüllt worden. Daß er dem Kurfürsten abgeraten habe, sich zum Könige zu erheben, ist längst widerlegt; er arbeitete vielmehr mit aller Kraft zu diesem Ziele hin.
1695 zum Premierminister und Oberpräsidenten ernannt stand er auf seiner Höhe. Mehr und mehr jedoch begann sein Leben jener Schilderung zu gleichen, die von Besser, in seinem mehrerwähnten Lobgedicht, schon das Jahr zuvor davon entworfen hatte:
Es liegt die ganze Last und aller Ämter Bürde
Nach deinem Herrn auf dir, der dich damit beschwert;
Man neide nicht zu sehr die dir vertraute Würde,
Du bist, wer es bedenkt, mehr des Bedauerns wert.
Ihn selbst begleitete dies Gefühl beständig. Allezeit bemüht, durch Zurückweisung erneuter Ehren, sich dem Haß der Höflinge zu entziehen, geschah schließlich doch, was ihm eine Vorahnung von Anfang an gesagt hatte: Neid und Intrigue gewannen die Oberhand. Dem drohenden Sturze wenigstens nach Möglichkeit auszuweichen, bat er selbst um seinen Abschied, der ihm auch unterm 22. November 1697 gegeben wurde.
Er zog sich nach Neustadt a. D., zu dessen Amtshauptmann er 1694 oder nach anderen Angaben erst 1696 ernannt worden war, zurück, woselbst er nunmehr Tage der Ruhe zu finden hoffte. Die Bosheit seiner Feinde jedoch war nicht erschöpft. In Sorge, daß er aus seiner selbstgewählten Verbannung jeden Augenblick wieder in ihrer Mitte erscheinen könne, gab man ihm schuld, mit fremden Potentaten eine nicht zulässige Korrespondenz geführt zu haben, und auf diese Beschuldigung hin ward er am 10. Dezember 1697 in Neustadt festgenommen. Die später gegen ihn ausgearbeitete Prozeßschrift bestand aus 109, nach anderer Angabe sogar aus 290 Anklagepunkten. Man führte den Beklagten von Neustadt nach Spandau, dann zwei Monate später nach Peitz. »Dabei« – so heißt es in unserem mehrzitierten Flugblatte – »blieb es übrigens nicht, man nahm ihm auch alle seine Güter. Endlich, gegen Ausgang des Jahres 1707, als dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm der erste Sohn geboren worden war, ward er in Freiheit gesetzet, mit der Ehre oder vielmehr mit der Schande, unter den Delinquenten, denen die Solennität dieser Geburt (eines Prinzen) die Gefängnisse geöffnet hatte, voranzustehen. Dabei war seine Freiheit so eingeschränket, daß er weniger einem freien Menschen als einem Gefangenen glich, der seine Ketten mit sich schleppet und nicht aus dem Gesicht gelassen wird. Nur in dem kleinen Bezirke von Cottbus durft er sich sehen lassen und spazierengehen.«
So gingen die Dinge bis 1713. Unmittelbar nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms I. wurde Danckelmann freigegeben und durch den König nach Berlin berufen. Dieser benutzte vielfach seinen Rat, gab ihm aber sein Vermögen nicht zurück. Danckelmann starb 1722 im achtzigsten Lebensjahre.
Erscheinung und Charakter Danckelmanns finden wir in der bei Peter Marteau erschienenen Broschüre wie folgt beschrieben: »Danckelmann war von einer großen Taille, etwas korpulent, aber allezeit von gutem Ansehen. Sein Geist hatte den Stempel des Bedeutenden; er war gediegen, zuverlässig, scharfsinnig, mit einem guten Judicio begabt, dabei durch gute Studia sowie durch vieljährige Erfahrung bei Hofe, große Affairen und unermüdlichen Fleiß ausgebildet. Hervorragend wie seine Klugheit war seine Redlichkeit, die ihn jederzeit nur auf das allgemeine Beste und das Interesse seines Herrn bedacht machte. Er trennte das eine nicht von dem andern. Solche allzu aufrichtige Sitten, ein etwas allzu ernsthafter Humeur (er soll nie gelacht haben) und allzu strenge Formen waren nicht bequem, einen guten Hofmann zu machen. Er wollte lieber dem Fürsten Instruktion geben, indem er ihm die Wahrheit sagte, als ihm schmeicheln, indem er ihm die Wahrheit verhehlte; er wollte lieber den Kalumnien seiner Neider sich unterwerfen und dabei seine Schuldigkeit tun, als dem Fürsten gefallen und ihn danach verraten.«
So die P. Marteausche Broschüre. Damit stimmen durchaus die von Besserschen Verse:
Was fordert man von dir? Verlanget man Geblüte?
Du hast ein alt Geblüt; verlanget man Gestalt?
Du hast sie, und noch mehr, du hast auch ein Gemüte,
Das mehr zu schätzen ist als Ansehn und Gewalt.
Verlangt man Wissenschaft? In dir sind alle Künste;
Verlangt man Tugenden? Wer kennt nicht deine Treu,
Wer nicht dein edles Herz, entfernet vom Gewinste,
Wie groß, wie unverzagt, wie standhaft solches sei?
Nach diesem Versuch einer kurzen Charakteristik erübrigt uns nur noch, unter Hinzufügung einiger Züge, zu rekapitulieren, inwieweit Danckelmann in Beziehung zu Neustadt trat.
Es ergibt sich dabei das Folgende:
1694 wurde Neustadt wie weiter oben erzählt seitens des Kurfürsten erworben und Danckelmann zum Amtshauptmann bestellt. Es scheint daß der Ankauf überhaupt nur geschah, um eine neue, einträgliche Stellung für ihn zu kreieren. Wir finden nämlich in der dieser Skizze vorzugsweise zugrunde gelegten Schrift von 1712 die nachstehende Stelle: »Den Ankauf der Grafschaft Spiegelberg, womit der Kurfürst ihn begnadigen wollte, suchte D. zu hintertreiben.«
Da es eine »Grafschaft« Spiegelberg nirgends gibt, so ist hier selbstverständlich jene Neustädter Fabrik- und Spiegelmanufaktur-Vorstadt gemeint, die bis diesen Tag den Namen »Spiegelberg« führt.
Daß Danckelmann, solang ihn die Fülle seiner Ämter – er war auch Erbpostmeister geworden – in Berlin festhielt, oft und andauernd in Neustadt verweilt habe, läßt sich nicht annehmen; andererseits ist es unzweifelhaft, daß er mit der ihm eigenen Umsicht alle dortigen Unternehmungen, die seit dem Ausscheiden des Prinzen von Hessen-Homburg (1678) ins Stocken geraten waren, wieder in Gang brachte. Die reichen Mittel, über die teils sein Vermögen, teils seine hohe Stellung ihm Verfügung gab, erleichterten ihm dies. Besonders scheint er sich auch an Vollendung und Ausschmückung der, wie wir wissen, 1673 begonnenen und 1686 eingeweihten Kirche beteiligt zu haben. So find ich unter andern im Bratring: »Erst 1696 wurde der innere Ausbau der Kirche durch den Amtshauptmann von Danckelmann beendigt.«
Schon damals mochte der Wunsch in ihm lebendig sein, sich je eher, je lieber aus den Kabalen des Hofes heraus- und an diese stille Stelle zurückzuziehen, deren weiter Wiesengrund ihn auch landschaftlich an die Tage seiner Jugend, an Lingen und Kleve erinnern durfte, und so werden wir kaum irregehen, wenn wir ihn, in jenem letzten kurzen Zeitabschnitte, der dem Einreichen beziehungsweise der Annahme seiner Demission unmittelbar vorausging, bereits innerhalb seiner Amtshauptmannschaft vermuten.
Jedenfalls erfolgte, wie schon hervorgehoben, am 10. Dezember 1697 seine Verhaftung in Neustadt.
Von jenem 10. Dezember an, wo man Danckelmann in Haft nahm und nach Spandau hin überführte, war es mit Neustadts historischer Zeit vorbei. Treffliche Kräfte waren auch noch weiterhin wirksam, aber kein Name wie Königsmarck, Prinz von Hessen-Homburg, Danckelmann war unter ihnen.
Blicken wir zum Schluß noch auf das, was der Stadt aus ihrer historischen Zeit her geblieben ist.
Die Amtsfreiheit,
an dem Knie gelegen, das die vom Bahnhofe kommende Straße durch Einmündung in die Hauptstraße bildet, ist dieselbe Lokalität, wo sich früher das Amt befand. Wie weit dies »früher« zurückreicht, ist fraglich. Gewiß ist nur, daß sich das um 1787 von Neustadt nach dem benachbarten Dorfe Dreetz verlegte Amt in obengenanntem Jahr (wie sehr wahrscheinlich auch mehrere Jahrzehnte früher schon) an dieser Amtsfreiheits-Stelle befand. Was sich bis diese Stunde noch an Baulichkeiten daselbst vorfindet, repräsentiert einen leidlich modernen Privatbesitz, dem, mit Ausnahme zweier prächtiger alter Bäume, die die Auffahrt bewachen, jeder Hauch von Historischem fehlt.
Die Kirche,
die sich fast in Front der Amtsfreiheit auf dem triangelförmigen Marktplatze der Stadt erhebt, ist eine Kuppelkirche und stellt in ihrem Grundriß ein kurzes griechisches Kreuz dar. Sie gibt sich sauber von außen und innen, womit so ziemlich erschöpft ist, was sich zu ihrem Lobe sagen läßt. In den vier abgestumpften Ecken des Kreuzes erheben sich die vier Fenster, hoch und lichtvoll und langweilig, wie denn überhaupt alles von jener symmetrischen Anordnung ist, die mehr durch Nüchternheit stört, als durch Übersichtlichkeit erbaut. Im östlichen Kreuzstück der Altar, im nördlichen die Kanzel und beiden gegenüber zwei Emporen, in die sich, wenn ich recht berichtet bin, die Honoratioren der Stadt und die Beamten des Gestüts gewissenhaft teilen. Das letztere tritt uns hier noch einmal in seiner ganzen Distinguiertheit entgegen und trägt unterhalb seines Chors ein großes vielfeldriges Wappen, das mir, seitens meines Führers, einfach als das »Gestütswappen« bezeichnet ward. Es ist aber nur das preußische. Eine daneben oder darunter befindliche Inschrift ist von relativer Wichtigkeit, insoweit sie uns positive Anhaltspunkte für die Geschichte der Stadt und dieser Kirche gibt. Sie lautet: »Anno 1666 hat das Feuer durch Gottes Schickung das Schloß, Kirche und Stadt allhier verzehrt, und unter der hochlöblichen Regierung des durchlauchtigen Kurfürsten und Herrn, Herrn Friedrich Wilhelm, Markgraf zu Brandenburg, hat der durchlauchtige Fürst und Herr, Herr Friedrich, Landgraf zu Hessen-Homburg, Anno 1673 diese neue Kirche zu bauen angefangen. Anno 1686 ist abermal der neuste Teil der Stadt in Feuer aufgegangen; jedoch ist noch in demselben Jahre die Kirche von Johannes Michael Helmich, Pfarrer allhier, eingeweiht worden. 1694 hat der durchlauchtige und großmächtigste Kurfürst und Herr, Herr Friedrich III., das ganze Ambt erhandelt und Seine Exzellenz, Oberpräsident Freiherr Eberhard von Danckelmann als Amtshauptmann darin bestellt, welcher Anno 1696 den ganzen Kirchenbau zu Ende bringen läßt.«
Der »Spiegelberg«,
dem wir uns zuletzt zuwenden, ist eine reizend gelegene Vorstadt am andern Ufer der Dosse. Hier war es mutmaßlich, wo der Prinz von Hessen-Homburg jene eingangs erwähnten fünfundzwanzig Familien ansiedelte, die berufen waren, das bis dahin kaum über ein Dorfansehen hinausgewachsene Neustadt in einen Fabrikort umzuwandeln. Der Prinz war der Mann der Initiative, gewiß, aber wir werden seinem Verdienste kaum zu nahe treten, wenn wir, auch an dieser Stelle wieder, die Vermutung aussprechen, daß erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts all das von ihm Gepflanzte wirklich reichliche Früchte trug. Die Neustädter Glasindustrie hatte zu dieser Zeit ein Ansehen gewonnen, und besonders seine Spiegel bildeten einen nicht unerheblichen Exportartikel.
Was sich jetzt noch von Gebäuden auf dem »Spiegelberge« vorfindet, gehört nicht der Epoche des »Landgrafen«, sondern sehr wahrscheinlich den letzten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms I. an, wenigstens scheint die Bauweise, die man kurzweg als eine kümmerliche Nachahmung des Holländischen bezeichnen kann, darauf hinzuweisen. Die Glasschmelze, vor allem aber das Langhaus, in dem ehedem die Spiegelplatten belegt wurden – sie wirken wie bloße Schuppen, denen man bemüht gewesen ist mittelst roten Anstrichs ein etwas höheres Ansehn zu geben (ein Ansehn von dem was sie nicht sind), und erinnern dadurch an die derselben Zeit angehörigen Soldatenwesten, die gar keine Westen waren, sondern nur angenähte Tuchlappen. Am meisten tritt einem diese Dürftigkeit an dem hier errichteten reformierten Betsaal entgegen, der dasselbe Fachwerk und dieselbe rote Tünche zeigt und seine Bestimmung durch nichts anderes andeutet als durch einen Dachreiter in Form eines aus Schindeln zusammengeklebten Schilderhauses. Zu Häupten desselben ein Glöckchen.
Das Ganze fiel uns auf, wenn auch nur durch seine Wunderlichkeit. Wir traten deshalb dicht an die hohen, aus kleinen grünen Scheiben zusammengesetzten Fenster heran und sahen in den Betsaal hinein, der aus einem Katheder und sechs Bank- und Pultreihen bestand. Auf den Pulten lagen viele Gesangbücher aufgeschlagen, als habe eben erst eine Gemeinde diesen Betsaal verlassen. Und doch waren es über drei Jahre, seit man sich hier zum letzten Male versammelt hatte. Das Ganze berührte mich unheimlich, etwa wie ein angerichtetes Mahl, das von langer Zeit her seiner Gäste harrt, oder wie die leise Musik in Spukschlössern, drin Geigen unsichtbar zum Tanze spielen. Aber kein Tänzer kommt.