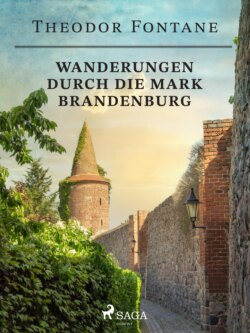Читать книгу Wanderungen durch die Mark Brandenburg - Theodor Fontane, Theodor Fontane - Страница 42
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gransee
ОглавлениеSteig auf die Warte dort, die nach dem Feld
Hinblickt, und sag uns, was du siehst.
Schiller
Die Trauerglocke läutet
Vom Dorfe her.
Wir wissen, was es deutet:
Sie ist nicht mehr.
Fouqué
Von Lindow kommend, fahren wir jetzt Gransee, der östlichsten Stadt der Grafschaft, zu. Von ihren früheren Tagen erzählt uns ein Baudenkmal, das sich bereits 1000 Schritte vor der Stadt erhebt:
Die »Warte« bei Gransee
Sie steht auf dem höchsten Punkte der Umgegend, dem »Warte- Berg«. Junge Fichten und dichtes Kusselwerk, drin der Sandhase sein Lager hat, bedecken ihn an seinen Abhängen, und nur der abgeplattete Gipfel ist kahl. Hier erhebt sich die »Warte«, von fernher einem modernen Fabrikschornsteine nicht unähnlich, bis man im Näherkommen den bedeutenderen Durchmesser erkennt. Es ist ein etwa 100 Fuß hoher Rundturm, aus Feldstein und sieben senkrecht stehenden Backsteinrippen derartig aufgeführt, daß bei der Aufmauerung immer erst die Rippen um einige Fuß erhöht wurden, ehe man wieder mit Feldstein zu füllen begann. Wie alt der Turm ist, stehe dahin. Ich möcht ihn frühstens in den Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts setzen.
Der gleichen Ansicht scheint nun freilich W. Alexis nicht gewesen zu sein, als er ebendiesen Warte-Turm in seinem berühmten Romane »Der falsche Waldemar« zum Schauplatz eines Hergangs aus dem Jahre 1348 machte. Diesen Hergang selbst erzählt er annähernd wie folgt.
Gransee hatte selbstverständlich seine Fehden mit dem benachbarten Adel, und zur Waldemar-Zeit waren es vorzugsweise die Winterfeldts und die Quaste, mit denen es sich bekriegte. Tile Quast wird eigens genannt, ebenso Tacke de Wons und Hans Lüddecke vom roten Haus. Im Jahre 1348 handelte sich's von seiten dieser drei um nicht mehr und nicht weniger als einen Überfall der Stadt; solcher war aber nur möglich, wenn es vorher glückte, den auf der Warte stationierten Stadtwächter, Mathis mit Namen, einzuschläfern. Dies zu bewerkstelligen, kam man überein, daß ein als Kärrner verkleideten Knecht, der ein Stückfaß Wein auf seinem Karren habe, die vorüberführende Straße passieren und am Fuß der Warte halten solle, wie wenn es sich um Ausbesserung eines Schadens an Rad oder Achse handle. Und so geschah es auch. Der Karren hielt. Mathis, der sich langweilen mochte, wie noch heute die Schildwachen tun, ging ohne Besinnen in die Falle, stieg die Wendeltreppe hinunter und bot sich an, bei dem anscheinend verunglückten Wagen mit zu helfen. Dabei fanden beide, daß der Wein für die Granseer viel zu stark sei. Sie spundeten also auf, tranken ein Erhebliches und füllten mit Wasser nach. Dies geschah aber erst ganz zuletzt, und Mathis fiel gleich danach in tiefen Schlaf.
Als er andren Tags bei schon hoch stehender Sonne wach ward und Umschau hielt, sah er den ganzen zwischen seinem Turm und der Stadt liegenden Plan von Bewaffneten überdeckt; in der Tat, der Überfall hatte bereits stattgefunden. Er war aber doch insoweit mißglückt, als die Eingedrungenen wieder hinausgedrängt und einige von ihnen sogar zu Gefangenen gemacht worden waren. Unter diesen Hans Lüddecke vom roten Haus.
Die Ratmannen ließen nun keine Zeit vergehen, über diesen (Hans Lüddecke) zu Gericht zu sitzen, aber nicht bloß über ihn, sondern auch über ihren eignen Turmwart, dessen Unzuverlässigkeit alle Not und Gefahr verschuldet hatte. Man sprach Tod »von Rechts wegen«, einigte sich aber schließlich dahin, daß beide nach der »Warte« gebracht und ihnen zugestanden werden solle, hoch oben auf der Plattform miteinander zu kämpfen. Wer Sieger bleibe, der solle frei sein, wer aber hinabgeworfen würde, der habe seine Strafe nach »Gottes Willen«.
Und hiernach wurde verfahren. Hans Lüddecke und Wächter Mathis kamen in den Turm, und die halbe Bürgerschaft zog mit hinaus, um Zeuge eines Ringkampfes und eines Gottesurteiles zu sein. Aber wer beschreibt ihr Staunen, als sie bald danach die Verurteilten friedfertig auf der Platte des Turmes erscheinen und, statt miteinander zu kämpfen, sich zu einem aus Mathis' Vorratskammer herbeigeschafften Nachtmahle niedersetzen sahen. Diese gute Laune freute selbst die Granseer, und um so mehr, als sie sich unschwer das Ende davon berechnen konnten. In der Tat, als der fünfte Tag heraufzog, sah es schlimm aus in den Vorräten und noch schlimmer in den Herzen der beiden Gefangenen. Aber auch hier wieder hieß es, »als die Not am größten, war die Hülfe am nächsten«, und ehe noch die Sonne in Mittag stand, blitzte es am Waldrande hin von Rittern und Reisigen, und ein nach Hunderten zählender bewaffneter Zug wandte sich an der Warte vorüber der Stadt zu. Der aber, der erschien, war Waldemar. Vor ihn jetzt kam der Streit und Hans Lüddecke, Urfehde schwörend, erhielt Leben und Freiheit zurück. Mathis dagegen verschwand in dem ihm zukommenden Dunkel.
So die Geschichte von der »Warte« bei Gransee, eine bloße Fiktion, die sich jedoch zur Historie bereits zu verdichten anfängt und nach »abermals fünfhundert Jahren« andern Historien einigermaßen ebenbürtig sein wird. Und nicht zu unserem Nachteil. Denn auch die dichterische Tat belebt die Schauplätze der von ihr, der Dichtung, gebornen Ereignisse und reiht sie mehr oder minder in die wirklichen »historischen Stätten« ein. Die »Warte« bei Gransee ist in diesem Augenblicke schon eine andre, als sie vor fünfzig Jahren war, und selbst das trigonometrische Dreigestell, das sich neuerdings auf jener Plattform eingebürgert hat »auf der Hans Lüddecke und Türmer Mathis miteinander kämpfen sollten«, hat ihr nichts Erhebliches von ihrem romantischen Schimmer zu nehmen gewußt.
Wir aber kehren nunmehr auf unsre Lindower Straße zurück, um in raschem Trabe der Stadt zuzufahren, an deren Eingang uns freilich ein neuer Aufenthalt erwartet. Zwei Tore nebeneinander! Warum zwei Tore? Diese Frage hält uns fest.
Das Waldemar-Tor
Warum zwei Tore? F. Knuths Geschichte von »Gransee« berichtet darüber: »Alle Städte, die dem Falschen Waldemar ihre Tore geöffnet und dadurch sich zu ihm bekannt hatten, wurden, als der bayersche Markgraf wieder herrschte, dahin bestraft, daß sie die Tore zumauern mußten, durch die der falsche Waldemar eingezogen war. Diese zugemauerten Tore hießen denn auch im Volksmunde ›Waldemar-Tore‹. Hart neben ihnen waren inzwischen neue, reichgegliederte, mit Türmen und Zinnen geschmückte gotische Tore gebaut worden, die nun, jahrhundertelang, den Verkehr vermittelten, bis das neuerblühende Leben der Städte den verhältnismäßig schmalen Eingang der gotischen Portale störend zu empfinden anfing. Da entsann man sich der zugemauerten Tore, nahm den fünfhundertjährigen Bann von ihnen, brach die Steine aus dem alten Rundbogen wieder heraus und schuf so dem Leben und Verkehr eine doppelte Straße.«
W. Schwartz in seinen »Sagen und alten Geschichten der Mark Brandenburg« erzählt es anders. Nach ihm würden die sogenannten Waldemar-Tore als »Wenden-Tore« anzusehen sein, durch die man deutscherseits die als unrein betrachtete wendische Bevölkerung vertrieben und die Tore dann vermauert habe. Hiermit stimmt auch überein, daß noch, bis ins vorige Jahrhundert hinein, in allen Dörfern, wo Wenden und Deutsche zusammenwohnten, nur die letztren sich der eigentlichen Kirchentüren bedienen durften, während die Wenden gezwungen waren, durch eine kleine, für sie besonders angelegte Seitentür in die Kirche einzutreten.
In Gransee wurde 1818 schon das Waldemar-Tor – ein Name, den ich beibehalte – wieder geöffnet und begann seinem Nachfolger und Nachbar Konkurrenz zu machen, eine Tatsache, die der kleinen Gemeinde der »Falschen-Waldemar-Schwärmer« als vielleicht von symbolischer Bedeutung erscheinen wird.
Wir unsrerseits aber, indem wir den Jakob Rehbock (trotzdem er in der Fürstengruft zu Dessau ruht) für das nehmen, was er war, meiden mit Geflissentlichkeit den Waldemar-Bogen und bewerkstelligen unsre Einfahrt durch das stattliche Portal des »Ruppiner Tores«, das, wenn auch zurückstehend neben dem berühmten Uenglinger Tor in Stendal, nichtsdestoweniger der Teilnahme wert war, die Friedrich Wilhelm IV. ihm angedeihen ließ, als er in den vierziger Jahren an Superintendent Kirchner schrieb: »An diesem Tore wird kein Stein gerührt, ohne daß ich zuvor Kenntnis davon erhalte.«
Das Tor liegt hinter uns, und unser Wagen lärmt jetzt die Hauptstraße hinauf, an deren linker Seite die beiden Plätze der Stadt und auf ihnen die beiden vorzüglichsten Sehenswürdigkeiten derselben: die Marienkirche und das Luisen-Denkmal, gelegen sind. Ehe wir diese jedoch aufsuchen, benutzen wir zuvor eine kurze Rast in Klagemanns Hôtel, um mit Hülfe des Wirtes einen guten Trunk und mit Hülfe seiner Gäste die Geschichte von Gransee »frisch vom Fasse« zu schöpfen.
Die Geschichte geht weit zurück in der Zeiten Lauf, aber erst um 1262 finden wir einen Brief, in dem Markgraf Johann den Granseern das »Recht seiner alten Stadt Brandenburg« verleiht. Es fehlt nicht absolut an Diplomen und Pergamenten aus dieser und der folgenden Zeit, das meiste jedoch ist verlorengegangen, und die Geschichte der Stadt – in ihren Hauptzügen der aller übrigen Grafschaftsstädte nah verwandt – erzählt sich rasch.
Es ist das alte Lied: erst großes, allgemeines Dunkel, nur hier und da durch ein Streiflicht erhellt; dann Kirchen- und Klösterbau; dann Säkularisierung; dann Schweden und die Pest; dann ein Dutzend Feuersbrünste mit Hinrichtung dieses oder jenes Brandstifters; dann Beglückung der Stadt durch ein paar Garnison- oder Invalidencompagnien, und in der Regel damit zusammenfallend: Benutzung alter Klostermauern zu Schul-, Kasernen- und Gefängniszwecken. In dieser Aufzählung ist nicht nur die Geschichte der Stadt sondern zugleich auch die Charakteristik der einzelnen Jahrhunderte gegeben, wobei sich's trifft daß das siebzehnte immer als das traurigste, das achtzehnte immer als das prosaischste auftritt.
Die große Zeit Gransees war wohl (wie für so viele Städte unsrer Mark) das sechzehnte Jahrhundert, die Joachimische Zeit. Damals gedieh alles, und das Kleinbürgertum wuchs fast über sich hinaus. Eine achtzehn Fuß hohe Mauer, mit fünfunddreißig Wachttürmen besetzt umzirkte die Stadt, aus deren Mitte die schon genannte Marienkirche aufstieg und über Mauer und Wachttürme hinweg weit ins Ruppinsche und Uckermärkische hineinsah. Es war eine feste Stadt, vielleicht die festeste der Grafschaft. Gräben und Wälle blieben bis in den Anfang des vorigen Jahrhunderts, wo sie applaniert und zu Anlagen umgeschaffen wurden, so daß damals, wohl der Zahl der Häuser entsprechend, 321 Gärten die stehengebliebene Stadtmauer umgaben. Ob diese Zahl dieselbe geblieben ist, vermag ich nicht anzugeben, aber auch jetzt noch erschließt einem ein Rundgang um Gransee, besonders um seine Nordhälfte, die ganze landschaftliche Lieblichkeit einer kleinen märkischen Stadt. Nach der einen Seite hin, in breiter Fläche, Wasser, Wald und Wiese, nach der andern aber, im Schatten alten Mauerwerks, eine stattliche Reihe von Blumenbeeten und, eingeschoben in diese, jener von weißen und schwarzen Kreuzen überragte Garten, der beflissen ist, uns mit Fliederduft und Vogelsang über die Bitterkeit des Scheidens hinwegzutäuschen.
Aber dieser »Gang um die Stadt« war bestimmt, erst gegen Abend und bei niedergehender Sonne zu mir zu sprechen. Noch war heißer Mittag, und wo hätt ich zu dieser Stunde besser Schutz gefunden als in der dämmerkühlen Kirche der Stadt.
Die Marienkirche,
deren Pfeiler bis in den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zurückdatieren, ist ein ursprünglich romanischer Bau, mit Gewölben aus der gotischen Epoche. Was diese Kirche, die von keiner in der Grafschaft übertroffen wird, auch schon äußerlich auszeichnet, ist die reiche Verwendung des vierblättrigen Kleeblatts. Allerdings begegnet man diesem Ornament innerhalb der Backsteingotik unserer Mark an den verschiedensten Stellen, aber nirgends in gleicher Überschwenglichkeit wie hier. Nicht nur band- und bortenartig tritt es uns an Fries und Strebepfeilern entgegen, sondern die betreffenden Bänder und Borten verbreitern sich auch zu ganzen Flächen, so daß tapetenartige Wirkungen erzielt werden, ähnlich denen an modernen Berliner Bauten, wo man mit Stein, als ob es sich um eine Tapisseriearbeit handle, Muster und Figuren herzustellen beginnt.
Die Marienkirche hat zwei Türme, die des Vorzugs genießen, beide fertig zu sein, und sich nur dadurch unterscheiden, daß die Spitze des einen völlig massiv, die des andern als eine bloße Holzkonstruktion in die Höhe steigt. Als Grund für diese Verschiedenheit wird diplomatische Rücksicht angegeben, und zwar Rücksicht auf die rivalisierenden Mächte der Maurer- und Zimmermeister. Was dem einen recht war, war dem andern billig.
In dem nach rechts hin gelegenen steinernen Turme befinden sich die »vier Glocken mit dem harmonischen Geläut«. Bei dem Brande von 1711 stürzten die damals vorhandenen in das Schiff der Kirche nieder, und der Glockengießer Johann Jacobi zu Berlin goß aus dem zusammengeschmolzenen Gut die jetzigen vier. Zwei davon sind intereßlos, aber die erste und dritte zeichnen sich durch ihre Inschrift aus.
Die erste, bei sechzehn Fuß Umfang, hat folgende Umschrift: »Quum dirissimum ac satis fatale incendium, incuria perditi fabri, die XIX. Junii anni MDCCXI, exortum urbem totam cum trecentis aedibus privatis ac sacris, simul omnibus et publicis deperderet, haec ego campana die XXX. Octobris MDCCXI reliquiis facta a J. Jacobi.« Also etwa: »Nachdem eine höchst schreckliche, verhängnisvolle Feuersbrunst, welche durch die Nachlässigkeit eines verruchten Schmidts den 19. Juni 1711 ausbrach, die ganze Stadt mit 300 Bürgerhäusern samt Kirchen und öffentlichen Gebäuden zugrunde gerichtet hatte, bin ich, diese Glocke, am 30. Oktober 1711 aus den Überbleibseln hergestellt durch Johann Jacobi.«
Die dritte Glocke, bei neun Fuß Umfang, bringt Reimzeilen. Sie lauten:
Gleiche Glut zerstörte mich,
Gleiche Glut erneute mich
Wie die andern zweene;
Drum soll mein Getöne,
Gott, nächst ihnen, dir auch singen
Und Dankopfer bringen.
J. Jacobi goß mich in Berlin 1711.
Das Innere der Kirche bietet weniger, als man erwarten sollte, weil das mehrerwähnte Feuer von 1711 den ganzen Inhalt ausbrannte. Manches wurd aber doch gerettet.
Etwas davon zeigt der Altar. Dieser selbst ist ein Rokokobau (1739) von den üblichen Formen; als Bild aber ist in die von korinthischen Säulen eingefaßte Wand eine bunte mittelalterliche Holzskulptur eingelassen, so daß der Schrein jetzt eine wunderliche Stilvermählung aus dem fünfzehnten und achtzehnten Jahrhundert zeigt.
Ein andres Überbleibsel aus mittelalterlicher Zeit ist eine Reliquienbüchse, die, durch ein glückliches Ungefähr, erst gerettet und dann aufgefunden wurde. Sie befand sich in einem aus Steinen aufgeführten Altar einer Seitenkapelle, der, weil massiv, dem Feuer widerstand. Auf diesem Altar nahm Anfang der fünfziger Jahre Superintendent Kirchner eine eingelegte Steinplatte wahr, die hohl klang, wenn man daraufklopfte. Dies bestimmte den Superintendenten, die Platte herausnehmen zu lassen. Was er vermutet hatte, bestätigte sich. Unter dem Sandstein war eine Öffnung, von der aus, röhrenartig, ein Kanal auslief, darin weitere Nachforschungen die vorerwähnte Reliquienbüchse entdeckten. Sie hat die Form einer gedrückten Kugel, ist faustgroß, von Lindenholz und zeigt eine mittelgroße Öffnung, die mittelst eines einfachen Deckels geschlossen wird. In dieser Büchse .befanden sich, außer einem Stückchen Mumie, drei Splitter vom Kreuze Christi in ein Stückchen Seidenzeug gewickelt, zugleich auch eine Urkunde mit dem Sekretsiegel des Bischofs von Havelberg. (Büchse und Inhalt sind zur Zeit in Händen des Superintendenten Kirchner in Walchow.)
Von kaum geringerem Interesse sind zwei Grabsteine, die den außergewöhnlichen Grad ihrer Wohlerhaltenheit einem ähnlichen Glücksumstande verdanken. Sie lagen 1711, als das große Feuer ausbrach, wahrscheinlich in Nähe des Altars. Die Flammen und selbst das niederstürzende Geröll hatten ihnen wenig anzuhaben vermocht, und als zwanzig Jahre später zur Wiederherstellung des Kircheninnern geschritten wurde, kam den Werkleuten der glückliche Gedanke, die bei dem Aufräumen mit aufgerissenen Grabsteine bei Pflasterung und Fliesenlegung der Kirche nach Möglichkeit zu benutzen. Als bloße Fliese war aber die glatte Rückseite des Grabsteins besser zu verwenden als seine Bildseite, weshalb Bild und Inschrift nach unten kamen. Und so wurden sie gerettet. Neuerdings aus dem Mittelgange, wo sie lagen, wieder aufgenommen, hat man sie nördlich in die Kirchenwand eingemauert. Es sind zwei Bellins, Vater und Sohn. Der Grabstein des Vaters zeigt ein gutes Ritterbild mit vier Wappen in den Ecken und folgende Inschrift: »Anno 1582, den Tag Mariä Lichtmeß, ist der edle, gestrenge, ehrenfeste Hermann Bellin, Erbseß XV. Markow, in Gott seliglich entschlafen, welcher Seele Gott gnädig sei.« – Der Grabstein des Sohnes, auch Hermann Bellin, ist klein und von geringerem Interesse.
Neben diesen Epitaphien der Bellins, Vater und Sohn, erhebt sich noch ein dritter, um 150 Jahre jüngerer Grabstein, und zwar der des Inspektors oder Superintendenten Ernst Germershausen, eines Mannes von einer gewissen städtischen und (weil typisch) auch kulturhistorischen Bedeutung, weshalb wir hier eingehender bei ihm verweilen.
Ernst Germershausen
folgte 1704 seinem Vorgänger Andreas Seehausen im Amt und verwaltete es achtundzwanzig Jahre. In die Zeit seiner geistlichen Oberherrschaft fällt das große Feuer von 1711, das 300 Häuser und in ihrem Innern auch die Kirche zerstörte. Mit dem Magistrate lag er in beständiger Fehde, was auf den Wiederaufbau der Kirche nachteilig wirkte. Die Stadtbehörde verweigerte beispielsweise die Lieferung von Holz, infolgedessen die Kirche drei Jahre lang ohne Dach blieb. Beiläufig eine Strafe, die diejenigen, die sie verfügten, mit traf, wenn sie nicht vielleicht »aus Rache« auch die Predigt versäumten. In der Magistratsregistratur ist noch ein starkes Aktenbündel vorhanden, das Kunde gibt von der gegenseitigen Erbittertheit.
Aus Predigten, die G. hinterlassen, erkennt man ihn als einen sehr eigenartigen Herrn. So findet sich in einem Leichensermon aus dem Jahre 1728 folgende sonderbare Bemerkung über Ebbe und Flut: »Die Lästerer der Religion geben vor, Moses habe die Juden bloß aus Hochmut und Ehrgeiz durchs Rote Meer in die Wüste geführt, um über sie zu herrschen, und habe des Meeres Ab- und Zufluß verstanden. Allein, solche Spötter haben keinen Begriff von der Seefahrt, da den geringsten Schiffsleuten bekannt ist, daß Ebbe und Flut in der Welt nirgend existiert als in der Nordsee, am heftigsten in Schottland, weshalb man meint, daß dort der Schlund sei, wo das Meer, als wenn es Othem holete, das Wasser gleichsam verschlucke und wieder von sich stoße, da, je weiter von Schottland, diese Ebbe und Flut desto weniger zu spüren.«
Er konnt aber auch besser sprechen. So beispielsweis in einer andern Leichenrede, die er im selben Jahre hielt. Sie begann: »Am 6. Mai 1728 starb in seinem vierundachtzigsten Jahre der vorachtbare und wohlvornehme Herr Daniel Grieben senior. Er trat dreimal in den Stand der heiligen Ehe und hinterläßt sechzehn Kinder, sechsundfünfzig Enkel und acht Urenkel. Sein Leben und Wandel betreffend, so hat er sich als einen christlichen und gottseligen Bürger wohl aufgeführet, Gottesdienste, selbst in der Wochen, nie versäumet und mit gebührender Andacht das heilige Abendmahl fleißig gebrauchet; seine Kinder und Gesinde zur Gottesfurcht gehalten und wohl erzogen, daß auch, Gott sei Dank, unter solcher starken Zahl kein Ungeratenes vorhanden. Er gab einen guten Haushalter ab; gegen den Nächsten war er mitleidig, so daß er in der Not mit Geld und Getreide jedermann ohne jeden Eigennutz gern gedienet. Und da ihn Gott im Zeitlichen reichlich gesegnet, hat er sich durch solches weder zu Stolz und Hoffart noch zu Verschwendung bewegen lassen, sondern ist nach wie vor in Gottesfurcht Demut und Fleiß verblieben. Viel Menschen hat er mit Vormundschaft und Zurechtweisung ihres Vermögens gedienet und seine Leibes- und Gemütskräfte Gott zu Ehren und dem Nächsten zu Nutz wohl angewendet.«
Das sind Kernworte, die auch den ehren, der sie sprach. Seine beständigen Streitigkeiten mit der Stadtbehörde beweisen nicht allzuviel gegen ihn. Sie scheinen (wenn sie überhaupt dazu angetan sind, einen Schatten auf seinen Charakter zu werfen) lediglich in einem hochgespannten Selbstbewußtsein ihren Grund gehabt zu haben. Und zu diesem Selbstbewußtsein war er in dem damaligen Gransee vielleicht berechtigt. Er war gelehrt und charaktervoll, in Welt und Büchern gleich erfahren und ragte mutmaßlich um Haupteslänge über den »Magistrat« hinaus. Um einen Kopf größer sein ist aber an und für sich schon ein Verbrechen, und es zeigen, ein doppeltes. Seine von ihm selbst verfaßte Grabschrift gibt uns, ungewollt, zugleich ein Lebens- und Charakterbild:
Memoria
Ernesti Germershausen, Gransoviensium praesulis,
Cui Magdeburgum vitam, Hamburgum fortunam,
Maria Germanicum, Atlanticum, Gaditanum, Ligusticum,
Tyrrhenum experientiam,
Urbes Olysippum, Gades, Malaga, Alicante, Genua,
Livorno, Pisa, Florentia et ipsa
Roma prudentiam,
Lichterfelda et Gransoviense territorium
Honores conciliaverunt.
Quibus cum (33) annos et quod excurrit praefuisset,
Placide obiit die (6 Decembris Anni MDCCXXXII).
Cujus anima requiescat in pace.
Zum Gedächtnis
von Ernst Germershausen, Inspektor zu Gransee,
Dem Magdeburg das Dasein, Hamburg Vermögen,
Das Deutsche, Atlantische, Spanische Meer,
Das Tyrrhenische und auch das Ligurische Erfahrung,
Die Städte Lissabon, Cádiz, Malaga, Alicante, Genua,
Livorno, Pisa, Florenz und selbst
Rom Weisheit,
Die Bezirke von Lichterfelde und Gransee aber
Amt und Würde gaben,
Starb, nachdem er sie 33 Jahre und darüber verwaltet, sanft
Den 6. Dezember 1732.
In Frieden ruhe seine Seele.
Von der Marienkirche fort wenden wir uns jetzt der andern Sehenswürdigkeit der Stadt zu. Es ist:
Das Luisen-Denkmal
O welche Reise!
Wie traurig leise
Durchzogen wir der schwarzen Fichten Nacht.
Es fielen unsre Tränen in den Sand;
Sie gab einst Schönheit diesem Land.
Achim von Arnim
Eh ich das Denkmal selbst beschreibe, geh ich die Situation.
Am 19. Juli 1810, neun Uhr früh, war die Königin zu Hohenzieritz gestorben. Die Leiche verblieb daselbst noch sechs Tage. Am 24. wurde sie in Silberstoff gekleidet und in einem schwarz drapierten Zimmer in Parade ausgestellt. Am 25., in glühender Sonnenhitze, begann die Überführung; Gransee sollte an diesem Tage noch erreicht werden. So war der Zug:
Oberstallmeister von Jagow und Schloßhauptmann von Buch;
herzoglich mecklenburgisches Forstpersonal;
Détachement erneut mecklenburgischer Kavallerie;
mecklenburgischer Hofstaat samt den strelitzischen Ministern;
der Herzog Karl von Mecklenburg (jüngster Bruder der Königin) und der Oberhofmeister Baron von Schilden;
der auf Federn ruhende, an den inneren Seiten mit Polstern versehene Leichenwagen;
die Oberhofmeisterin Gräfin von Voß;
zwei preußische Kammerherren;
die Kammerfrauen der Königin;
Détachement mecklenburgischer Kavallerie.
An der preußischen Grenze, bei Fischerwall, dort, wo jetzt am Rande des Waldes ein einfacher Deckstein steht, wurde der Trauerzug von der Leib-Eskadron des Regiments Garde du Corps, von dem Landrat des Ruppiner Kreises, späterem Grafen von Zieten, und einer Deputation der Ritterschaft erwartet. In allen Ortschaften, welche von dem Zuge berührt wurden, wie auch in allen denen, welche bis auf eine Meile von der Landstraße entfernt lagen, wurde mit allen Glocken geläutet. So schritt man auf Gransee zu. Hier war bereits vorher, von Berlin aus, ein gotisch verziertes, mit schwarzem Tuch bekleidetes Langzelt eingetroffen, das man mit Hülfe von Vorhängen in drei Abteilungen geteilt hatte. In der vordersten standen die Wachtposten der Garde du Corps, in der zweiten der Leichenwagen; in der dritten befanden sich die Personen des Hofes.
An der Stadtgrenze von Gransee, bei der sogenannten Baumbrücke, wurde der Zug von den städtischen Behörden empfangen und auf jenen oblongen Platz geleitet, der jetzt den Namen » Luisen-Platz« führt. Die Stelle, wo der Leichenwagen inmitten des Zeltes stand, ist bis heute durch ein paar eiserne Fackelhalter (hart links neben der Straße) markiert. Am 26. Juli früh setzte sich der Kondukt, auf Oranienburg zu, wieder in Bewegung; am 27. traf er in Berlin ein.
Zur Erinnerung an die Nacht vom 25. auf den 26. wurde, seitens der Stadt Gransee wie des Ruppiner Kreises, das » Luisen-Denkmal« errichtet. Es ist von Eisen; einzelnes vergoldet. Schinkel entwarf die Zeichnung; die Berliner Königliche Eisengießerei führte sie aus.
Dies Denkmal nun, dessen Beschreibung wir uns in nachstehendem zuwenden, besteht aus einem Fundament und einem sockelartigen Aufbau von Stein, auf dem ein Sarg ruht. Über diesem Sarg, in Form eines Tabernakels, erhebt sich ein säulengetragener Baldachin. Die Verhältnisse des Ganzen sind: dreiundzwanzig Fuß Höhe bei dreizehn Fuß Länge und sechs Fuß Breite. Der Sarg, in Form einer Langkiste mit zugeschrägtem Deckel, hat seine natürliche Größe; zu Häupten ruht eine vergoldete Krone; an den vier Ecken wachsen vier Lotosblumen empor. Die Inschriften am Kopf- und Fußende lauten wie folgt: »Dem Andenken der Königin Luise Auguste Wilhelmine Amalie von Preußen.« – »Geboren den 10. März 1776, gestorben den 19. Julius 1810. Nachts den 25. Julius stand ihre Leiche hier.« Die Inschriften zu beiden Seiten des Sockels sind folgende. Links: »An dieser Stelle sahen wir jauchzend ihr entgegen, wenn sie, die Herrliche, in milder Hoheit Glanz mit Engelfreudigkeit vorüberzog.« Rechts: »An dieser Stelle hier, ach, flossen unsre Tränen, als wir dem stummen Zuge betäubt entgegensahen; o Jammer, sie ist hin.«
Die weiteren Inschriften, die der Gesamtbau trägt, befinden sich teils am Fundament, teils an der Innenseite jener großen Eisenplatten, die das Schrägdach des Baldachins bilden. Am Fundament steht: »Von den Bewohnern der Stadt Gransee, der Grafschaft Ruppin und der Prignitz.« Die großen Eisenplatten enthalten nur ein Namensverzeichnis, und zwar die Namen derjenigen, die sich um die Errichtung dieses Denkmals besonders verdient gemacht haben. Es sind: Joh. Friedrich Klagemann, Burgemeister; Karl Heinrich Borstell, Kämmerer; Karl Wilhelm Metzenthin, E. Gottfried Koch, Joh. Andreas Werdermann, Johann Jakob Scheel, Ratsmänner; Johann Jakob Gentz, Vorsteher der Stadtverordneten; Friedrich Christian Ludwig Emil von Zieten auf Wustrau, Landrat; Karl Friedrich Schinkel, Baumeister.
Am 19. Oktober 1811 wurde das Monument im Beisein des damals zehnjährigen Prinzen Karl von Preußen enthüllt. Sooft der König später, bei Gelegenheit seiner Besuchsreisen nach Neustrelitz, Gransee passierte, ließ er den Wagen an dieser Stelle halten. Am Abend des 19. Juli 1860, also am funfzigjährigen Todestage der Vollendeten, wurde, bei Fackelschein und unter dem Geläut aller Glocken, eine liturgische Andacht an ebendiesem Denkmal abgehalten. Nicht nur Stadtbewohner, auch Angehörige des Kreises waren in großer Zahl erschienen.
Und wie Gransee durch jenes Denkmal sich selber ehrte, so glänzt auch sein Name seitdem in jenem poetischen Schimmer, den alles empfängt, was früher oder später in irgendeine Beziehung zu der leuchtend-liebenswürdigen Erscheinung dieser Königin trat. Die moderne Historie weist kein ähnliches Beispiel von Reinheit, Glanz und schuldlosem Dulden auf, und wir müssen bis in die Tage des früheren Mittelalters zurückgehn, um Erscheinungen von gleicher Lieblichkeit (und dann immer nur innerhalb der Kirche) zu begegnen. Königin Luise dagegen stand inmitten des Lebens, ohne daß das Leben einen Schatten auf sie geworfen hätte. Wohl hat sich die Verleumdung auch an ihr versucht, aber der böse Hauch vermochte den Spiegel nicht auf die Dauer zu trüben. Mehr als von der Verleumdung ihrer Feinde hat sie von der Phrasenhaftigkeit ihrer Verherrlicher zu leiden gehabt. Sie starb nicht am »Unglück ihres Vaterlandes«, das sie freilich bitter genug empfand. Übertreibungen, die dem einzelnen seine Gefühlswege vorschreiben wollen, reizen nur zum Widerspruch.
Das Luisen-Denkmal zu Gransee hält das rechte Maß: es spricht nur für sich und die Stadt und ist rein persönlich in dem Ausdruck seiner Trauer. Und deshalb rührt es.