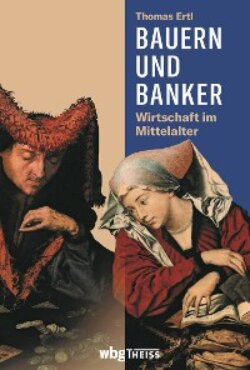Читать книгу Bauern und Banker - Thomas Ertl - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Transformationen
ОглавлениеDas frühe Mittelalter (500–1000)
Das frühe Mittelalter von 500 bis 1000 ist eine für die Wirtschaftsgeschichte wichtige Epoche, weil sich in dieser Zeit umfangreiche Transformationen der Wirtschafts- und Sozialordnung vollzogen haben und weil diese Veränderungen von der Geschichtswissenschaft seit über einhundert Jahren widersprüchlich bewertet worden sind. Im Zusammenspiel mit anderen Erklärungsmustern spielten wirtschaftsgeschichtliche Argumente in diesen Diskussionen stets eine prominente Rolle. Zwei zusammenhängende Fragen stehen dabei meist im Mittelpunkt: Wie vollzog sich der Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter und wie sahen die Grundzüge der frühmittelalterlichen Wirtschaft aus? In den letzten Jahrzehnten hat sich die Bewertung dieser Fragen geändert: An die Stelle der Zäsur trat die Transformation und an die Stelle des Niedergangs trat der Wandel. Problematisch geworden ist sogar die Periodisierung selbst, denn Spezialistinnen und Spezialisten dieser Epoche des Übergangs betrachten die Zeitspanne vom 4. bis zum 9. Jahrhundert mit guten Gründen als eine eigenständige, »expandierende« Epoche.
Kontinuitäten und Diskontinuitäten sind freilich nur im historischen Rückblick erkennbar, weshalb ihre Bewertung stets von einer selektiven Wahrnehmung geprägt ist. Dies gilt ganz besonders für den Übergang von der Antike zum Mittelalter. Hinzu kommt eine selbst für mittelalterliche Verhältnisse spärliche Quellenlage. Seit dem 5. Jahrhundert ging die Schriftlichkeit im westlichen Europa zurück. Erst aus der karolingischen Zeit sind schriftliche Zeugnisse wie Urkunden, Urbare (das Urbarium ist ein Verzeichnis über die Besitzrechte einer Grundherrschaft und die zu erbringenden Leistungen ihrer Untertanen [Grundholden] und somit eine bedeutende Wirtschafts- und Rechtsquelle der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Agrarverfassung) und historiografische Texte wieder in größerem Umfang erhalten – diese Texte der Karolingerzeit überformten zudem die ältere Überlieferung.
Während sich im westlichen Europa die Gesellschaften der römischen Provinzen Italiens, Galliens, Germaniens und der iberischen Halbinsel aufgrund der Ausbreitung des Christentums und der Integration neuer Volksgruppen nachhaltig veränderten, bestand im Südosten das römische Imperium in Gestalt des byzantinischen Reiches weiter. Doch auch hier wandelte sich die Bevölkerung nach dem Zuzug slawischer und anderer Gruppen. Der Norden und der Osten des europäischen Kontinents wurden durch Missionierung, Handel und Kriege zunehmend mit den politischen und wirtschaftlichen Zentren verbunden. Seit dem 7. Jahrhundert schufen die Araber neue Herrschafts- und Wirtschaftsformen im Nahen Osten und darüber hinaus. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief in diesen Großregionen sehr unterschiedlich. Selbst innerhalb der einzelnen Räume kann von einer einheitlichen Entwicklung nicht die Rede sein. Die kleinräumigen Entwicklungspfade divergierten so stark, dass sogar die Frage gestellt wurde, ob es überhaupt sinnvoll ist, von einer einzigen großen Transformation zu sprechen.
Das Ergebnis der verschiedenen Wandlungsprozesse war die Entstehung einer mittelalterlichen Welt, deren Gesellschafts- und Wirtschaftsform häufig als Feudalismus bezeichnet wird. Der Begriff ist unscharf, wird häufig zur Abgrenzung vom Kapitalismus verwendet und weist zwei Dimensionen auf. Einerseits ist damit das Lehenswesen gemeint, also die Beziehung zwischen einem landbesitzenden Herren (dominus; einem Fürsten, hohen Geistlichen oder Adeligen) und einem von ihm abhängigen Mann (vasallus), die durch die Übergabe (Leihe) von Land (feudum oder beneficium) oder staatlichen Hoheitsrechten gegen Dienst und Herrschaftsteilhabe gekennzeichnet ist. Über Entstehung und Ausgestaltung des Lehenswesens wird in der aktuellen Forschung heftig und kontrovers diskutiert. Andererseits bezeichnet Feudalismus die Herrschaft einer grundbesitzenden Klasse über die abhängige Landbevölkerung im Rahmen der Grundherrschaft. Dieser Begriff ist in den letzten Jahren ebenfalls in die Kritik geraten. Das feudale Produktionssystem – bestehend aus landbesitzenden Herren oder Institutionen und ausgebeuteten Bauern – existierte nicht nur in Europa und nicht nur im Mittelalter. Bis weit in die frühe Neuzeit hinein dominierten auf Grund- und Bodeneigentum beruhende ländliche Herrschafts- und Wirtschaftsverhältnisse alle anderen Wirtschaftssektoren, und zwar in allen Ländern der Erde.
Feudale Verhältnisse wirken somit auf doppelte Weise der allgemein üblichen Definition eines modernen Staates entgegen: Es gab keine Zentralregierung, die das Gewaltmonopol ausübte und von allen Untertanen Steuern erhob, und es existierte kein rechtlich homogenes Staatsvolk, da der Großteil der bäuerlichen Bevölkerung nicht vom König, sondern von Grundherren abhängig war. Wirtschaftlich bedeutet dies, dass es bis zum späten Mittelalter kaum freie Lohnarbeit gab, weil viele Bauern Land bewirtschafteten, das sich nicht in ihrem Eigentum befand. Für die Nutzung mussten sie Abgaben in Form von Geld und Naturalien sowie Frondienste (Arbeitsdienste) leisten. Öffentliche Aufgaben und Befugnisse wurden in diesem System von vielen kleinen und großen Herrschaftsträgern auf unterschiedlichen Ebenen – von der kleinen Grundherrschaft bis zum großen Königreich – durchgeführt und ausgeübt.