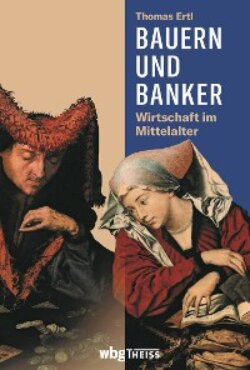Читать книгу Bauern und Banker - Thomas Ertl - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Wandlung der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte in den letzten einhundert Jahren
Оглавление| Thesen und Themen | Pirenne 1933 | Ertl 2021 |
| frühes Mittelalter | autarke Grundherrschaften ohne Handel, starker Bruch mit der Antike | Grundherrschaften mit Marktanbindung, Adaption spätrömischer Traditionen |
| Handel im Mittelmeer nach der islamischen Expansion im 7./8. Jh. | die abendländische Schifffahrt ist »ganz und gar tot« | Handel geht reduziert weiter und nimmt bald wieder Fahrt auf. |
| Europa | Blick nur auf Westeuropa, Betonung der Kerngebiete | interkulturelle und globale Aspekte, Betonung der Divergenzen |
| Schwerpunktsetzung | Konzentration auf Fernhandel und Luxusgüter | Versuch einer Balance der Wirtschaftssektoren |
| Innovationskraft der Wirtschaft | kapitalistischer Fernkaufmann | Innovationspotenzial und Kommerzialisierung in allen Sektoren |
| Zünfte | wettbewerbs- und innovationsfeindlich, protektionistisch | gleichermaßen hemmend und fördernd für wirtschaftliche Innovationen |
| Institutionen als Rahmenbedingungen | keine explizite Rolle | eine Erklärungshilfe |
| Spätmittelalter | soziale Unruhen, Kapitalismus und Merkantilismus | unterschiedliche Erklärungen für die wirtschaftliche Neuordnung, Demografie und Klima wichtig |
| Erkenntnisinteresse | der bürgerliche Kaufmann als wagemutiger Unternehmer | die Folgen für den Menschen (Lebensstandard, Konsum, Ungleichheit, Klimawandel) |
| Narrativ | kohärente Aufstiegserzählung | Wirtschaftsgeschichte als Teil einer Gesellschaftsgeschichte sowie als Forschungsgeschichte |
Henri Pirennes Buch ist ein Klassiker der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich einige Interpretationen verändert, neue Themen sind hinzugekommen und die kulturgeschichtliche Einbettung der Wirtschaft hat sich verstärkt. Obwohl der Umfang der Spezialforschung und der edierten Quellen massiv zugenommen hat, ist unser heutiges Gesamtbild der mittelalterlichen Wirtschaft weiterhin von Arbeiten wie jener von Pirenne geprägt.
Der Blick zurück dient unter anderem der Deutung und Bewertung von Gegenwart und Zukunft. Die interessengeleitete Verflechtung des Mittelalters mit der Gegenwart zeigt sich unter anderem in der Vielfalt der vorhandenen Mittelalterbilder. Dies gilt auch für die Wirtschaftsgeschichte als Teil der historischen Wissenschaften. Die wirtschaftliche Entwicklung des Mittelalters spielte im ökonomischen Denken des 20. Jahrhunderts häufig eine ambivalente Rolle, eingebettet in einen allgemein verbreiteten Beurteilungskatalog der Epoche. Dabei werden in der Regel zwei Bewertungskriterien miteinander kombiniert, was zu vier vorherrschenden Deutungen des Mittelalters im Vergleich zur Moderne führt:
| Verhältnis | Zitierte Autoren |
| ähnlich und positiv | Friedrich August von Hayek |
| ähnlich und negativ | Frühneuzeitforschung, Bas van Bavel |
| anders und positiv | Jacques Le Goff, Karl Polanyi, Thomas Piketty |
| anders und negativ | Werner Sombart |
Beurteilungsmatrix des Mittelalters in der Moderne. Die Tabelle zeigt die vorherrschenden Sichtweisen auf das Mittelalter und ordnet sie einigen Autoren zu, die auf den nächsten Seiten zitiert werden. Es handelt sich um eine subjektive Auswahl.
Bei der negativen Interpretation der Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters dominiert das Bild von Rückständigkeit und Stagnation. Ähnlichkeit oder Andersartigkeit spielen dabei meist eine untergeordnete Rolle und hängen hauptsächlich vom veranschlagten Grad der Rückständigkeit ab. Eine besondere Betonung der Rückständigkeit erzeugt meist das Bild der mittelalterlichen Andersartigkeit, wie Werner Sombart es in seinen Studien zur Entstehung des Kapitalismus gezeichnet hat. Der frühneuzeitlichen Wirtschaftsgeschichte, die sich mit dem Aufstieg des Fiscal-military State (womit ursprünglich Großbritannien gemeint war: Dessen erfolgreiches Finanzsystem gestattete es, besser ausgerüstet und länger Krieg zu führen als die konkurrierenden Kontinentalmächte.) und der Great Divergence (d. h. der ökonomischen Ungleichheit: Sie ermöglichte es Europa, sich wirtschaftlich schneller und nachhaltiger zu entwickeln als andere Teile der Welt.) beschäftigt, dient das europäische Mittelalter häufig als negative Folie und als Epoche, in der die modernen Entwicklungen möglicherweise ihre Wurzeln, allerdings noch keine festen Konturen angenommen haben. Häufig stehen solche Interpretationen im Zusammenhang mit malthusianischen Ansätzen und gehen davon aus, dass die vormoderne Bevölkerung stets schneller wuchs als die wirtschaftliche Entwicklung.
Die Divergenzen bei einer positiven Sichtweise sind stärker ausgeprägt und haben zudem größere Relevanz für die Bewertung ökonomischer Prozesse der Gegenwart. Diese Ansätze betonen in der Regel nicht die Stagnation der landwirtschaftlichen Produktion, sondern die Dynamik der kommerziellen Entwicklung. Methodisch stehen diese Interpretationen in der Tradition von Adam Smith und werden daher smithianische Theorien der Kommerzialisierung genannt. Die Gegenwartsbezogenheit dieser Narrative will ich anhand von zwei Schlüsselwerken veranschaulichen, die beide im Jahr 1944 erschienen sind. Friedrich August von Hayek ließ in The Road to Serfdom den Weg hin zur freien Marktwirtschaft im europäischen Mittelalter beginnen. Insbesondere die italienischen Kaufleute hätten einen wirtschaftlichen Individualismus ausgebildet, der später zum Kennzeichen der europäischen Kultur und Wirtschaft geworden sei. Wo hingegen das Prinzip der persönlichen Freiheit aufgegeben werde, entstehe zwangsläufig die Tyrannei des Staates über das Individuum, verbunden mit einer zentralen Wirtschaftsplanung – in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowohl im Faschismus als auch im Sozialismus verwirklicht. Freiheit und Rechtsstaat könnten daher, so Hayek, nur in einer Marktwirtschaft gedeihen. Der sich selbst regulierende Markt, der seine Wurzeln im späten Mittelalter habe, bleibt für die Anhänger einer (neo-)liberalen Wirtschaftspolitik bis heute der beste Garant von Wohlstand und Freiheit. Vergessen wird dabei häufig, dass im Mittelalter keine freie Marktwirtschaft existierte und dass die neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik seit den 1980er-Jahren neue soziale Verwerfungen hervorgebracht hat.
Karl Polanyi entwarf in Great Transformation (1944) ebenfalls eine positive Bewertung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Mittelalter. Sein Interesse gilt vorrangig der großen Umwandlung der Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert aufgrund von Industrialisierung und Marktwirtschaft. Im Zuge dieses Prozesses seien Land und menschliche Arbeitskraft in frei handelbare Güter verwandelt worden. Das Ergebnis war demnach eine Verselbstständigung oder »Entbettung« der Wirtschaft gegenüber der Gesellschaft. Dagegen sei die Wirtschaft vor der Industriellen Revolution in die Gesellschaft eingebettet gewesen. Das Ackerland und die Arbeitskraft der Landbewohner seien keine frei verfügbaren Waren, sondern im Rahmen von grundherrschaftlichen Rechten und Pflichten fixiert gewesen. Wirtschaft und soziales Leben hätten eine Einheit gebildet, in der die Verteilung von Gütern allen ein Auskommen gesichert habe. Das freie Spiel der Marktkräfte habe dieses Verhältnis nach 1800 gelockert, die soziale Ungleichheit verstärkt sowie physische und moralische Schäden bei der besitzlosen Klasse hervorgerufen. Einen Ausweg sah Karl Polanyi in der Rückkehr zu einem Wirtschaftssystem, das die Faktoren Arbeit, Boden und Geld wieder dem Zugriff des Marktes entzieht und demokratisch kontrolliert. Im Zeitalter der neoliberalen Wirtschaftspolitik wird diese kapitalismuskritische Diagnose seit den 1980ern verstärkt rezipiert. Mariana Mazzucato zeigt in The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (2013), dass der Erfolg der amerikanischen Wirtschaft der letzten Jahrzehnte keineswegs das Ergebnis eines freien Marktes war, sondern dass der Staat mittels öffentlicher Investitionen in Technologie und Innovation den Grundstein dafür gelegt hat. Bas van Bavel vertritt in The Invisible Hand? (2016) die Ansicht, dass die Kontrolle der Faktoren Boden und Arbeit durch die wirtschaftlichen Eliten in verschiedenen Zeitaltern zur Krise des kapitalistischen Systems geführt habe – dies sei im italienischen Spätmittelalter ebenso zu beobachten wie in den westlichen Staaten der Gegenwart. Auch Thomas Piketty beschreibt in Capital and Ideology (2020) die Überwindung der vormodernen dreifunktionalen Gesellschaft als einen vorrangig negativen Prozess, der die Unterschiede zwischen Reich und Arm im 19. Jahrhundert dramatisch vergrößert habe. In diesen und vielen anderen Studien dient die mittelalterliche oder vormoderne Wirtschaft als Referenzsystem, an dem gegenwärtige Entwicklungen gemessen werden.
Die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte nimmt mit ihren Beiträgen zur Welt des Mittelalters daher teil an der großen Debatte darüber, in welcher Gesellschaft die Menschen in Zukunft leben wollen. Letztlich ging es in der Vergangenheit und geht es in der Zukunft um die gerechte oder angemessene Verteilung der Ressourcen. Doch was ist gerecht und angemessen? Bereits im Mittelalter versuchten die Menschen, diese Frage zu lösen und die ihnen von Machtverhältnissen und Umweltbedingungen gestellten Herausforderung zu bewältigen – und wie in der Gegenwart wurde diese Suche von Unterdrückung und Ausbeutung sowie von Ausgleich und Kompromissen geprägt. Eins steht dabei fest: Bereits im Mittelalter strebten die Menschen, egal ob sie Bauern oder Banker waren, nach Freiheit und Wohlstand.