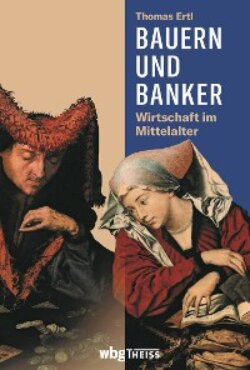Читать книгу Bauern und Banker - Thomas Ertl - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die frühmittelalterliche Wirtschaft in Westeuropa
ОглавлениеDie Grundlagen für die mittelalterliche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung wurden in der Spätantike gelegt. Seit dem 3. Jahrhundert sank im weströmischen Reich die Bevölkerungszahl aufgrund von Kriegen und Seuchen. Die Anzahl der landwirtschaftlichen Großbetriebe (Latifundien) nahm zu. Bewirtschaftet wurden sie von Sklaven oder von Kleinpächtern (Kolonen), die zwar persönlich frei waren, aber aus steuerrechtlichen Gründen an die Scholle gebunden wurden. Gleichzeitig ging die Geldwirtschaft zurück und die Städte schrumpften. Die Einwohnerzahl Roms sank von bis zu einer Million im 2. Jahrhundert auf 100.000 im 6. und 30.000 im 7. Jahrhundert. Die Steuerquote stieg dagegen an und erreichte in Ägypten bis zu einem Drittel der Einnahmen eines bäuerlichen Betriebs, während sie im 4. Jahrhundert in vielen Regionen des Imperiums noch circa 20 Prozent betragen hatte. Die wirtschaftlichen Verhältnisse variierten jedoch stark von Region zu Region. Die germanischen und anderen nicht-römischen Völker hatten diese Entwicklung teilweise beschleunigt, indem sie sich auf Reichsgebiet niedergelassen, Land und Steueranteile erhalten und wesentliche Teile des Militärdienstes übernommen hatten. Dies beschleunigte die Regionalisierungstendenzen im Reich unter anderem durch die Dezentralisierung der Soldatenrekrutierung.
Europa im frühen Mittelalter. Die Karte zeigt die großen Herrschaftsbereiche des 9. Jahrhunderts, wobei diese in Wirklichkeit keine festen Grenzen hatten. Insbesondere die Herrschaft der Waräger in Osteuropa (Kiewer Rus) bestand aus verschiedenen Zentren und nicht aus klar abgegrenzten Gebieten. Als Waräger werden jene aus Skandinavien stammenden Händler und Krieger bezeichnet, die seit dem 8. Jahrhundert im Gebiet von Dnepr, Düna, Wolga und Don bis ins Kaspische und Schwarze Meer nachgewiesen sind. Bei den eingezeichneten Orten handelt es sich vorrangig um bedeutende Städte und Herrschaftszentren (○) wie Rom und Konstantinopel oder um wichtige Handelsorte () wie Marseille oder Haithabu oder um die im Text erwähnten Klöster und Kirchen mit großen Grundherrschaften (Δ). Haithabu war eine bedeutende Siedlung der Wikinger und gilt als Hauptumschlagsplatz für den Fernhandel zwischen Skandinavien, Westeuropa, dem Nordseeraum und dem Baltikum. Die Stadt wurde um 770 gegründet und 1066 endgültig zerstört. Die Pfeile zeigen die Hauptwege des Sklavenhandels des 10. Jahrhunderts.
Die mittelalterliche Wirtschaft entfaltete sich aufgrund dieser Prozesse in einem neuartigen politischen Rahmen. Die barbarischen Könige und Heerführer sahen sich nach der Errichtung ihrer Reiche auf römischem Boden als Nachfolger der römischen Kaiser und eigneten sich die kaiserlichen Ländereien an. Auch schriftliche Verwaltungspraktiken wie die gesta municipalia, die städtischen Dokumentenregister, und Steuerlisten wurden von den germanischen Königen und ihren Verwaltungen zunächst weitergeführt. Gleichzeitig übertrugen die Könige, die häufig einer einflussreichen und selbstbewussten Führungsschicht gegenüberstanden, immer mehr Krongüter an die Kirche und den Adel, um sich auf diese Weise ihre Loyalität zu sichern. Die dauerhafte Entfremdung dieser Güter ließ sich nicht aufhalten, obwohl Karl Martell und andere dem entgegenzutreten versuchten. Entsprechend passten sich die staatlichen Strukturen in den frühmittelalterlichen Königreichen auf ehemals römischem Boden sukzessive den veränderten Gegebenheiten an: Die Könige besaßen keinen Verwaltungsapparat, der ihnen den Zugriff auf das gesamte Land und alle Untertanen erlaubt hätte. Finanziert wurden die Königsherrschaft und das Militär nur noch teilweise aus Steuern, daneben aber durch Einnahmen aus den königlichen Grundherrschaften (Domänen), okkasionellen Abgaben, Strafen und Zöllen, der Vergabe von Land sowie durch Kriegsbeute. Die Mediatisierung der Staatsgewalt, die in der Spätantike im weströmischen Reich begonnen hatte, setzte sich fort. Allerdings herrscht in der Frühmittelalterforschung kein Konsens darüber, ob das römische Steuersystem gänzlich untergegangen war, ob die Kirche es zumindest teilweise übernommen hatte oder ob die karolingischen Polyptycha des 9. Jahrhunderts sogar als eine Fortsetzung der antiken Steuerregister zu deuten sind. Als Polyptycha (von altgriechisch »vielfach gefaltet«) werden Besitz- und Abgabenverzeichnisse karolingischer Klöster bezeichnet.
Zweifellos lebten administrative Strukturen zur Finanzierung der Herrschaft und zur Rekrutierung des Heeres sowie einzelne Abgaben, die im römischen Imperium von der Bevölkerung geleistet wurden, in veränderter Form in den frühmittelalterlichen Grundherrschaften weiter.
Am Übergang zum Mittelalter ging der Wohlstand weiter Teile der Bevölkerung zurück, sowohl der Bauern als auch der Eliten. Es kam zudem zu einer Ruralisierung, einer Bevölkerungsverschiebung von der Stadt auf das Land. Viele Städte schrumpften und ihre ehemals öffentlichen Flächen füllten sich mit privaten Bauwerken oder wurden landwirtschaftlich genutzt. Auf dem Land entstanden kleine Dörfer und Weiler. Zeugnisse für diese Wandlungsprozesse sind indes selten und hauptsächlich archäologischer Natur, beispielsweise der Rückgang von Funden hochwertiger Keramik oder das vermehrte Aufkommen simpler Holz- und Grubenhäuser. Alle Regionen waren von diesem Wandel berührt – besonders Italien, das im 6. Jahrhundert in der Folge der Gotenkriege und der Reichsgründung der Langobarden politisch fragmentiert und wirtschaftlich ruiniert wurde. Kriege und Gewaltexzesse prägten die Geschichte des fränkischen Reichs seit dem 6. Jahrhundert. Doch König, Kirche und Aristokratie im Frankenreich gelang es besser als den Eliten in anderen germanischen Königreichen, die ländlichen Regionen zu durchdringen und auf dieser Grundlage Militärorganisation und Münzprägung lokal zu verankern. Der Zugriff auf die landwirtschaftlichen Ressourcen und die räumliche Ausweitung von Rodungen wurden auf diese Weise ebenfalls vorangetrieben. Aus der wachsenden Schicht reicher Grundherren bildete sich eine Reichsaristokratie mit fränkischer Identität.
In diesem politischen Rahmen entstand die mittelalterliche Grundherrschaft – allerdings gehen die Meinungen über deren Ausbreitung und Formenvielfalt in der Forschung weit auseinander. Der Begriff Grundherrschaft bezeichnet die rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen einem Grundherrn und den Personen, die auf seinem Land wohnen und arbeiten. Die Bauern standen in sehr unterschiedlichen Abhängigkeitsverhältnissen zum Grundherrn. Für die Überlassung von Land hatten sie verschiedene Abgaben zu leisten und waren teilweise zu Frondiensten verpflichtet. Die Abgaben in Geld und Naturalien sowie die Frondienste waren stark von lokalen Gegebenheiten geprägt. Die Gesamtheit der abhängigen Bauern bildete zudem keine homogene soziale Gruppe, sondern setzte sich aus Freien, Halbfreien und Unfreien zusammen, die unterschiedliche Leistungs- und Abgabepflichten hatten und verschiedene Funktionen in der Grundherrschaft ausübten. Selbst innerhalb des fränkischen Reichs war die Formenvielfalt so groß, dass Ludolf Kuchenbuch den Vorschlag machte, auf den Begriff Grundherrschaft gänzlich zu verzichten. Vermutlich lässt sich der Begriff jedoch weiterhin sinnvoll gebrauchen, vorausgesetzt, dass damit nicht eine bestimmte Herrschafts- und Betriebsform verstanden wird.
Die zweigeteilte (bipartite) Grundherrschaft, Villikation genannt, bestand aus dem Salland (Herrenland) und abhängigen Bauernstellen (Mansen / Hufen / Huben). Das Salland wurde von Hörigen bewirtschaftet, die auf dem Hof des Grundherrn wohnten, während das Hufenland stückweise an Bauern und ihre Familien ausgegeben wurde. Die Hufenbauern bewirtschaften diese Güter selbstständig und leisteten dafür Abgaben; zusätzlich waren sie zu Frondiensten auf dem Salland verpflichtet. Beauftragte des Grundherrn, Meier genannt (villicus), sorgten für die Übergabe der Abgaben aus den verstreut liegenden Hufen, gehörten sozial aber ebenfalls der bäuerlichen Schicht an. Eine feste, generationenübergreifende Hierarchie von Meiern und Funktionsträgern hatte sich in den Dörfern der abhängigen Bauern noch nicht gebildet. An den Fronhöfen arbeiteten hörige Handwerker für den Bedarf des Hofes und teilweise wohl auch für den örtlichen Markt. Frauen und Mädchen verrichteten in eigenen Tuchwerkstätten (genitium / Gynäceum) Spinn- und Webarbeiten für die Grundherrn. In der bayerischen Grundherrschaft Staffelsee gab es beispielsweise eine Tuchmacherei, in der 24 Frauen arbeiteten.
Die überlieferten Urkunden von Klöstern wie beispielsweise St. Gallen sowie die Besitz- und Abgabenverzeichnisse (Polyptycha) karolingischer Klöster wie Saint-Germain-des-Prés bei Paris, Saint-Remi in Reims, Montier-en-Der bei Saint-Dizier, Sankt-Peter in Gent und Prüm in der Eifel bilden die ältesten Zeugnisse für diese Form der Grundherrschaft mit Salland und Hufenland. Über die Verbreitung der Villikation gehen die Ansichten abermals auseinander. Ein Teil der Forschung vermutet, dass die klassische Villikation auf bestimmte Regionen des Frankenreichs mit guten Böden für den Getreideanbau und günstigen Siedlungsverhältnissen beschränkt geblieben ist. Dagegen wurde eingewandt, dass es vermutlich wenig sinnvoll ist, die frühmittelalterliche Grundherrschaft in Zonen mit unterschiedlichen Agrarverfassungen einzuteilen, weil Mischformen die Regel waren. Solche Mischformen wurden bereits innerhalb einer Grundherrschaft praktiziert, beispielsweise vom Kloster Werden, das zwar Sal- und Hufenland besaß, von den Bauern auf entfernten Höfen hingegen hauptsächlich Abgaben erhielt und keine Frondienste forderte.
Der weltliche Adel bezog seine Natural- und Geldeinkünfte ebenfalls aus großen und kleinen Grundherrschaften. Da Urbare des Adels erst seit dem 13. Jahrhundert überliefert sind, ist die Erforschung der weltlichen Grundherrschaft im frühen und hohen Mittelalter auf andere Quellen wie Traditionsurkunden (Schenkungs- oder Tauschurkunden) oder Chartulare, in denen Urkundeneingänge an einen bestimmten Empfänger gesammelt wurden, angewiesen.
Im Capitulare de villis (um 800) entwarf Karl der Große ein Reformprogramm für die königlichen Grundherrschaften, auf deren Erträge er bei seinen ständigen Reisen durchs Land angewiesen war. Das Kapitular widmet sich vor allem dem Wein- und Obstbau sowie der Viehzucht. Detailliert werden einzelne Arbeitsabläufe beschrieben, um die Erträge der Betriebe zu steigern und die Versorgung des Hofes zu gewährleisten. Im 70. Kapitel werden 73 Nutzpflanzen und 16 verschiedene Obstbäume genannt, die angepflanzt werden sollten, falls es die klimatischen Gegebenheiten zulassen würden. Über die Aufgaben der königlichen Verwalter heißt es unter anderem:
»17. Für jeden Gutshof in seinem Amtsbezirk soll der Amtmann Pfründner bestellen, die Bienen für uns zu warten 18. Bei unseren Mühlen halte man der Größe der Mühle entsprechend 100 Hühner und 30 Gänse, auf den Vorwerken mindestens 50 Hühner und 12 Gänse 19. Bei den Scheunen auf unseren Haupthöfen halte man mindestens 100 Hühner und 30 Gänse, auf den Vorwerken mindestens 50 Hühner und 12 Gänse. 20. Jeder Amtmann lasse während des ganzen Jahres reichlich Gutserzeugnisse zum Fronhof bringen und besichtige sie außerdem drei- bis viermal im Jahr oder noch öfters.«
Ob dieses Kapitular ein unrealistisches Idealbild darstellte oder die Entwicklung der karolingischen Grundherrschaft wirklich beeinflusste, ist strittig.
Außerhalb des Kernbereichs fränkischer Herrschaft entwickelte sich die Struktur der Landwirtschaft jeweils abhängig von den topografischen, klimatischen und sozialen Verhältnissen. In Südfrankreich und Italien bewirtschafteten die Grundherren häufig kein eigenes Herrenland und die Bauern schuldeten keine Frondienste, sondern einen festen Anteil der Erträge (Teilbausystem) oder festgelegte Abgabemengen. Selbst in den Kernräumen des Frankenreichs nördlich der Alpen existierten neben den Villikationen Grundherrschaften, die vorrangig auf Abgaben abhängiger Bauern in Naturalien und Geld beruhten. Daneben gab es stets freie Bauern, die zwar kaum in den Quellen auftauchen, aber einen beträchtlichen Teil aller Bauern ausmachten. Einige von ihnen wurden von den adligen und kirchlichen Grundherren, die ihre Grundherrschaften ausdehnen wollten, bedrängt und unterdrückt. Die Klagen der Bauern wurden in unterschiedlichen Quellen überliefert. Insbesondere an den Rändern des fränkischen Reichs wie in Spanien oder Friesland, außerdem in abgelegenen Rodungs- und Gebirgszonen stellten die persönlich freien Bauern die Mehrheit der Bauernschaft. Die Ausbreitung der Landwirtschaft im südlichen Frankreich und in Katalonien erfolgte im 9. und 10. Jahrhundert durch solche freien Bauern, die in kleinen Siedlungen zusammenlebten. Bisher ungelöst ist die damit verbundene Frage, ob die landwirtschaftlichen Innovationen des frühen Mittelalters eher auf die großen bipartiten Grundherrschaften oder auf die kleineren Betriebe freier Bauern zurückgehen.
Der großen Bandbreite der persönlichen Rechtsverhältnisse entsprachen sehr unterschiedliche ökonomische Verhältnisse. Am unteren Ende der Skala standen rechtlose Sklaven, die auf den Herrenhöfen lebten und arbeiteten. Ihre Zahl nahm ab, weil viele von ihnen von den Grundherren eigene Bauernhöfe erhielten und so zu behausten Sklaven (servi casati) wurden. Mit ihrer wirtschaftlichen Teilautonomie verbesserte sich ihre Rechtsstellung und dieser Prozess näherte die ehemaligen Sklaven den persönlich freien, aber schollengebundenen Bauern (Kolonen) sowie den abhängigen Bauern (Grundholden, Hörige) an. Aus den Sklaven der Spätantike (lat. servus) wurden im frühen Mittelalter unfreie Bauern, in der deutschsprachigen Forschungsliteratur als Hörige oder Leibeigene (engl. serf) bezeichnet. Die Meinungen über diesen Prozess und die weitere Existenz rechtloser Sklaven im hohen und späten Mittelalter gehen jedoch auseinander. Obendrein stellt sich die Frage, ob zwischen Sklaven, unfreien und freien Bauern tatsächlich eine klare rechtliche Grenze vorhanden war oder doch eher ein sozialer Raum mit Zwischenformen. Weitgehender Konsens herrscht darüber, dass im frühen Mittelalter eine »Vergrundholdung« oder »Verbäuerlichung« einsetzte, die die unterschiedlichen sozialen Gruppen der abhängigen Personen bis zum 11. Jahrhundert in einem Bauernstand vereinte, wobei diese Entwicklung die rechtlichen, sozialen oder wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den bäuerlichen Haushalten niemals nivellierte. Ein Bauernstand mit einheitlichen Lebensformen existierte nur in den Köpfen von Gelehrten und Dichtern, wenn diese über die sozialen Stände schrieben und sich dabei – meist vorurteilsbeladen und zum Amüsement des adligen oder bürgerlichen Publikums – über die Bauern ausließen.
Die Beziehung zwischen Grundherren und Bauern wurde vom Gewohnheitsrecht geprägt, sodass der Grundherr die Abgaben nicht willkürlich festsetzen konnte, die Bauern hingegen in der Regel bereit waren, die vorhandene Abgabenlast zu akzeptieren. Probleme und Widerstände ergaben sich meist in Momenten, in denen in die herrschenden Verhältnisse eingegriffen wurde. So wird im Kapitular von Pîtres im Jahr 864 von Bauern berichtet, die gewisse Fuhrdienste verweigerten, weil diese nicht von alters her (ex antiqua consuetudine) gefordert worden waren. Die Stellung vieler Bauern erlangte spätestens im 9. Jahrhundert zudem größere Rechtssicherheit wegen der Erblichkeit von Nutzungsrechten. Bauern, die das ihnen übertragene Land rechtlich gesehen nur bis auf Widerruf des Grundherrn nutzten, konnten ihren Hof samt Ackerland in der Praxis nicht nur über Generationen innerhalb der Familie behalten, sondern ihr Land oder Teile davon verkaufen bzw. die eigene Landwirtschaft durch den Kauf weiterer Äcker erweitern. Meist setzte dies allerdings die Zustimmung des Grundherrn voraus. Bis in die Neuzeit hinein blieb das Verhältnis zwischen Grundherren und Bauern von dieser Suche nach für beide Seiten erträglichen Kompromissen bestimmt. Aufgrund des Wandels klimatischer, ökonomischer und regionaler Rahmenbedingungen saß mal die eine Seite und mal die andere am längeren Hebel.
Schon im frühen Mittelalter begann ein Prozess der landwirtschaftlichen Expansion, der sich unter anderem an Rodungen und einer Erweiterung der landwirtschaftlich genutzten Flächen erkennen lässt. Der Einsatz des schweren Pflugs (Räderpflug), der die gepflügten Schollen nicht nur ritzt, sondern umwendet, die Anschirrung von Pferden mit dem Kummet (Pferdehalsgeschirr) und die Dreifelderwirtschaft waren technische und organisatorische Hilfsmittel in manchen Grundherrschaften nördlich der Alpen. Die Überschussproduktion wurde bereits seit dem 7. Jahrhundert auf lokalen Märkten und in nahen Städten verkauft, sodass die frühmittelalterlichen Grundherrschaften keine autarken Wirtschaftseinheiten bildeten.
Die Erträge blieben indes gering. Das Verhältnis von Saat zu Ernte liegt heute zwischen 1:20 und 1:30. Damals lag das Verhältnis zwischen 1:2 und 1:5, was bedeutet, dass von einem ausgesäten Getreidekorn zwischen zwei und fünf Körner geerntet wurden. In schlechten Erntejahren führte dies unweigerlich zu Mangelkrisen und Hungersnöten. Im Jahr 792 / 93 erließ Karl der Große deshalb Höchstpreise für Getreide, um in einer Zeit des Mangels die Versorgung zu sichern. Trotz solcher Maßnahmen berichten die karolingischen Chronisten allein im 9. Jahrhundert in 26 verschiedenen Jahren von regionalen Hungersnöten.
Innerhalb der heterogenen bäuerlichen Gesellschaft (peasant society) des frühen Mittelalters bildeten die bäuerlichen Haushalte eine Produktions- und Konsumgemeinschaft, die in Abhängigkeitsverhältnissen und in Bereichen der Eigenständigkeit gleichermaßen verankert war. Aufgrund der Quellenlage ist es in der Regel nur indirekt möglich, etwas über das bäuerliche Alltagsleben und die bäuerliche Mentalität im frühen Mittelalter zu erfahren. Die schriftlichen Zeugnisse über Bauern stammen nämlich ausschließlich aus Fremdzeugnissen, verfasst von den kirchlichen Grundherren oder von Theologen, in deren Traktaten und Heiligenviten die ländliche Bevölkerung Erwähnung fand. Dennoch zeigen die Quellen, dass die Angehörigen der bäuerlichen Schichten bereits im frühen Mittelalter mobil waren – sowohl geografisch, etwa durch das Verlassen einer Grundherrschaft, als auch sozial, etwa aufgrund von Heirat oder von Funktionen in der grundherrschaftlichen Verwaltung. Über das Ausmaß dieser Mobilität wird weiterhin diskutiert. Was die Mentalität der Bauern betrifft, so sind wohl viele übliche Vorurteile (konservatives Weltbild, Friedfertigkeit, Sesshaftigkeit und Aberglaube) falsch oder zumindest nicht belegbar. Dagegen zeigen verschiedene überlieferte Texte, dass die Bauern versuchten, ihren Besitzstand zu wahren oder zu verbessern, dass sie dem Familienverband große Bedeutung beimaßen und dass sie ihre persönliche Freiheit mit Vehemenz verteidigten. In der Vita des heiligen Gerald von Aurillac (855–909) aus dem 10. Jahrhundert begegnet der Heilige einer Bauersfrau am Pflug:
Monatsbild-Zyklus einer karolingischen Handschrift von circa 818. Die Monatsbilder orientierten sich nicht nur in dieser Handschrift am bäuerlichen Leben. Das ist nicht erstaunlich, da im frühen Mittelalter über 90 Prozent der Bevölkerung auf dem Lande lebten, und selbst die adlige und kirchliche Oberschicht vom agrarischen Leben und Arbeitsrhythmus geprägt war. Die Monatsbilder sind für die wirtschaftsgeschichtliche Forschung zudem wichtig, weil sie die jahreszeitspezifischen Arbeiten darstellen.
»Während er einst einen öffentlichen Weg entlangschritt, führte auf einem angrenzenden kleinen Acker eine Bauersfrau den Pflug. Er fragte sie, warum sie als Frau sich diese Männerarbeit zumute. Sie antwortete, ihr Mann sei schon länger krank, die Zeit der Aussaat verrinne, sie sei allein und habe niemand zur Hilfe. Und da jener ihr Unglück bemitleidete, ließ er ihr Geldstücke geben, … damit sie sich für einige Tage einen Bauer anwerben und fortan von der Männerarbeit ablassen konnte.«
Diese Quellenstelle zeigt zweierlei: Selbst im Leben von Bauern spielte Bargeld eine Rolle. Wichtiger noch: Bauersfrauen arbeiteten nicht ausschließlich im Haushalt. Vermutlich übernahmen Frauen nicht nur in Notsituationen Arbeiten auf dem Feld. Geschrieben wurde darüber nur in Ausnahmefällen – und wenn, dann nicht zur Würdigung von Frauenarbeit, sondern um die traditionellen Geschlechterrollen zu festigen.
In den Debatten um die Kontinuität oder Diskontinuität zwischen Antike und Frühmittelalter spielt die Funktionsweise der Grundherrschaft eine wichtige Rolle. Historikerinnen und Historiker, die eine starke Kontinuität betonen, vertreten unter anderem die These, dass Herrschaft und Wirtschaft in Westeuropa bis zum Jahr 1000 stark den antiken Traditionen verpflichtet gewesen seien: politisch dank der Fortdauer eines starken Königtums mitsamt einer effizienten Verwaltung und wirtschaftlich durch den intensiven Einsatz von Sklaven. Dies habe sich erst um das Jahr 1000 geändert und den Beginn des »zweiten Feudalzeitalters« im 11. Jahrhundert markiert (Marc Bloch). Eine solche Sichtweise unterstreicht zu Recht, dass die grundherrschaftlichen Strukturen in Europa vielgestaltig waren und das Villikationssystem sicherlich nicht als alleiniger Maßstab gelten kann. Andererseits werden die vielen Belege für die Ausbreitung der mittelalterlichen Grundherrschaft und die darauf beruhende agrarwirtschaftliche Erfolgsgeschichte des Frühmittelalters unterschätzt. Zudem wird nicht unterschieden zwischen der antiken Sklaverei und frühmittelalterlichen Formen der Minder- und Unfreiheit. Für die Einschätzung des politischen und wirtschaftlichen Wandels bleibt indes die Vermutung anregend, dass sich im 11. Jahrhundert ein Prozess herrschaftlicher Verdichtung vollzog. Bei der wissenschaftlichen Interpretation dieser Entwicklung wurde von der Forschung entweder die Usurpation öffentlicher Rechte durch den Adel (seigneurie banale) oder die Etablierung der autogenen Adelsherrschaft stärker betont. Ob diese Veränderungen ausreichen, um von einer feudalen Revolution um die Jahrtausendwende zu sprechen, ist fraglich. Überzeugender erscheint die Annahme, dass die langsame Transformation von den antiken zu den mittelalterlichen Herrschaftsformen und Agrarstrukturen in der Spätantike begann und bereits im frühen Mittelalter zu einer langsamen Verdichtung von Herrschaftsverhältnissen sowie zur wirtschaftlichen Effizienzsteigerung agrarischer Betriebe führte – jedoch in regional sehr unterschiedlichen Formen und Ausmaßen. Um das Jahr 1000 ereignete sich demzufolge keine feudale Revolution, sondern eine weitere Transformation der Verhältnisse – möglicherweise in manchen Regionen in beschleunigter Geschwindigkeit.
Aus anderer Perspektive bildeten der Wandel staatlicher Strukturen für Chris Wickham in seiner Arbeit Framing the Early Middle Ages (2005) den Ausgangspunkt für die sozioökonomische Transformation zwischen Spätantike und Frühmittelalter. Das frühe Mittelalter ist aus seiner Sicht von schwachen staatlichen Strukturen, einer militarisierten und wenig begüterten Aristokratie sowie einem Rückgang des Fernhandels gekennzeichnet. Dies habe die Herrschaft der Eliten über Gruppen kleiner Grundbesitzer und Pächter verringert und deren Autonomie erhöht. Seit dem 8., vor allem aber seit dem 9. Jahrhundert sei die Macht der Aristokratie wieder angewachsen und der ökonomische Handelsspielraum der Bauern sei wieder stärker eingeschränkt worden. Auch in der Interpretation von Chris Wickham setzten sich im hohen Mittelalter neue Formen herrschaftlicher Verdichtung durch. Der Weg dorthin unterscheidet sich hingegen stark von den Thesen der zuvor genannten Forschungsrichtung. Anregend bleibt in beiden Ansätzen der Versuch, die Geschichte der politischen Macht eng mit der Wirtschaftsgeschichte zu verknüpfen.
Die Frühmittelalterforschung streitet also weiterhin über Fragen der Kontinuität und Zäsur und interessiert sich dabei insbesondere für die frühmittelalterliche Adaption antiker Traditionen. Im Bereich der Grundherrschaft ist hierbei bemerkenswert, dass öffentliche Abgaben wie das Bereitstellen von Pferden, Transportdienste, Holzlieferungen etc. sowie die Rekrutierung von Wehrpflichtigen über die Epochengrenze hinweg auf der Grundlage von Grundbesitz und Rechtsstand erfolgten und folglich spätrömischen Traditionen verpflichtet blieben. Nun wurden diese Abgaben vorrangig im Rahmen der Grundherrschaften erhoben. Die öffentlichen Leistungen (munera publica) der römischen Bürger wurden von den Diensten (servitia) der Bauern abgelöst und der frühmittelalterliche mansus (Flächenmaß) wurde zur Grundlage einer an den Grundbesitz gebundenen Wehrpflicht. Davon profitierten einerseits das Königtum durch die Aushebung der Soldaten, andererseits hauptsächlich jedoch die Grundherren. Selbst die Wehrersatzleistungen von Personen, die nicht in den Krieg zogen, wurden von den Grundherren meist als Geldleistungen eingezogen. Ob der Grundherr das Geld behielt oder an den König weitergab, ist umstritten. Das Fortleben antiker Institutionen im Rahmen der frühmittelalterlichen Grundherrschaft ist damit ein anschauliches Zeugnis des Transformationsprozesses zwischen Antike und Mittelalter, der unter anderem eine neue Form der Herrschaftsausübung hervorbrachte, die einen öffentlichprivaten Charakter hatte. In diesem Rahmen ist das Lehenswesen als Übertragung von Herrschaftsrechten in römischer Tradition zu sehen, da bereits der spätrömische Staat die Steuererhebung in den Provinzen an Steuerpächter bzw. Land an die in Grenzgebieten stationierten Truppen übertrug. Beides führte zu einer »Dezentralisierung der staatlichen Finanzverwaltung« (Stefan Esders). Die frühmittelalterlichen Könige versuchten die militärischen und adligen Führungsschichten an sich zu binden, indem sie ihnen Landbesitz und Einkünfte übertrugen oder deren Herrschaften als königliche Übertragungen interpretierten. Die Formen dieser Übertragungen waren vielgestaltig, entsprachen aber in der Regel nicht dem späteren Lehnswesen. Die Bindung der Elite an den König war örtlich und zeitlich ebenfalls unterschiedlich erfolgreich. Viele mächtige Grund- und Kriegsherren betrachteten die eigenen Herrschaftsrechte über Land und Leute nicht als königliche Übertragung, sondern als autochthone Herrschaft.
Die Einschätzung des Lehenswesens als Vertrag zwischen Fürsten und Adel sowie als Grundlage der politischen und wirtschaftlichen Ordnung hat sich in den letzten Jahrzehnten freilich dramatisch gewandelt. Im Jahr 1994 veröffentlichte Susan Reynolds ihre bahnbrechende Studie Fiefs and Vassals und vertrat darin die These, dass das Lehnswesen eine gelehrte Erfindung frühneuzeitlicher Juristen gewesen sei. In den letzten 25 Jahren wurde intensiv über diese These diskutiert. Während über viele Details heute noch heftig gestritten wird, hat sich als neue Überzeugung allgemein etabliert, dass sich das klassische Lehenswesen (Ausgabe von Land gegen militärische Dienstleistung) erst im 12. Jahrhundert voll ausgebildet hat. Im frühen Mittelalter wurden soziale Beziehungen zwar ebenso bereits auf der Grundlage von Besitzübertragungen gefestigt. Dies ist in jedoch vielen unterschiedlichen Formen geschehen und hatte häufig den Charakter von Pachtverträgen.
Die ältere wirtschaftshistorische Forschung zeichnete auch vom frühmittelalterlichen Handel gewöhnlich ein Bild des Niedergangs. Häufig wurde der Fall Roms mit einem Ende des internationalen Handels gleichgesetzt. Vertreter einer größeren Kontinuität zwischen Spätantike und Frühmittelalter votierten für einen allmählichen Rückgang des Handels, kamen aber dennoch zu einem ähnlichen Ergebnis. Andere Akzente setzte Henri Pirenne in seinem 1937 erschienen Buch Mahomet et Charlemagne. Laut Pirenne sei die kulturelle und wirtschaftliche Einheit der antiken Mittelmeerwelt erst durch die islamische Expansion im 7. und frühen 8. Jahrhundert zerstört worden. Im Merowingerreich und den anderen germanischen Königreichen auf römischem Boden sei das antike Wirtschaftsleben zunächst ohne große Veränderungen weitergegangen. Die arabische Eroberung der südlichen Mittelmeerküste und Spaniens habe den Handel im Mittelmeer dann zum Erliegen gebracht. Auf diese Weise habe sich im karolingischen Reich ein neues Wirtschaftssystem gebildet, das von wirtschaftlicher Autarkie und agrarischer Subsistenzwirtschaft gekennzeichnet gewesen sei. Fernhandel habe in dieser neuen mittelalterlichen Welt keine Rolle mehr gespielt. Die Pirenne-These ist weiterhin anregend, jedoch in doppelter Hinsicht überholt: Der Handel über das Mittelmeer kam niemals ganz zum Erliegen, und die arabische Expansion bildete daher keine totale wirtschaftliche Zäsur.
Heute wird die Handelsgeschichte des Frühmittelalters positiver und stärker als ein kontinuierlicher Prozess gesehen. Tatsächlich ist der Mittelmeerhandel bereits in der Spätantike zurückgegangen. Allerdings wurde der Warenhandel sowohl auf dem Mittelmeer als auch auf den Fluss- und Landwegen in verringertem Ausmaß fortgesetzt. Seit dem 7. Jahrhundert ist beispielsweise ein reger überregionaler Handel mit Keramik im Frankenreich nachweisbar und seit der Mitte dieses Jahrhunderts trafen sich englische, friesische und französische Kaufleute regelmäßig auf den Messen von Saint-Denis bei Paris, um vor allem Wein und Textilien zu kaufen und zu verkaufen. Über die Hafenorte Quentovic in Nordfrankreich und Dorestad am Niederrhein wurde eine Verbindung zwischen England und dem Kontinent hergestellt. So enthalten Londoner Statuten aus dem frühen 11. Jahrhundert Zölle, die von Kaufleuten aus Nordfrankreich und Flandern bezahlt wurden. Ein wichtiges Handelsgut bildeten seit dem 9. Jahrhundert die friesischen Wolltuche (pallia fresonica), die von friesischen Kaufleuten im fränkischen Reich vertrieben wurden. Ob diese Textilien indes in Friesland oder entweder in Flandern oder England hergestellt worden sind, ist unsicher. Bereits seit dem 6. Jahrhundert bildete das Rhône-Saône-Tal eine wichtige Verkehrsachse, die den Mittelmeerraum mit Nordwesteuropa verband. Der wichtigste Mittelmeerhafen der Merowingerzeit war Marseille. Aus Zolleinkünften von Fos-sur-Mer bei Marseille erhielt das nordfranzösische Kloster Corbie aus königlicher Schenkung 716 eine Reihe mediterraner Luxusgüter (Öl, Pfeffer und andere Gewürze, getrocknete Feigen, Pistazien, Reis, Papyrus u.v.m.). Der Import orientalischer Güter wie Papyrus, Textilien und Gewürzen in den Westen hörte zu keinem Zeitpunkt gänzlich auf. Arabische und byzantinische Luxusgüter und Münzen gelangten über die Alpen bis in das Frankenreich. In den Orient wurden dagegen Holz, Pelze, Waffen und Metalle geliefert. Sklaven bildeten ein weiteres wichtiges Handelsgut, sie wurden hauptsächlich in Osteuropa verschleppt und auf Märkten in Venedig, Verdun oder Marseille verkauft. Da es sich ethnisch vorrangig um Slawen handelte, entwickelte sich aus dem Volksnamen der in vielen europäischen Sprachen verwendete Begriff Sklave (lat. sclavus; engl. slave) für unfreie Menschen im späteren Mittelalter und in der Neuzeit. Auch an der Ostgrenze des Frankenreich wurde Handel getrieben und Sklaven spielten hier ebenfalls eine wichtige Rolle. Dies belegt unter anderem die Zollordnung von Raffelstetten (902 / 906) für den Donauhandel zwischen Bayern und den angrenzenden Gebieten donauabwärts.
Raffelstetten war eine Zollstation an der Donau in Österreich zwischen Linz und Enns. Zwischen 902 und 906 wurden die Zolltarife schriftlich fixiert. Privilegiert wurden einheimische Händler, während Juden und andere Kaufleute den vollen Tarif zu zahlen hatten. Die wichtigsten Handelsgüter waren Salz und Sklaven. Unter anderem wird festgelegt (Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio II):
»Schiffe, die vom Westen kommen, sollen nach dem Verlassen des Passauer Waldes bei Rosdorf (bei Linz) oder an anderen Stellen, an denen sie anlanden wollen, einen Halbpfennig Zoll bezahlen. Falls sie nach Linz weiterfahren: Für jedes Schiff sind drei Scheffel Salz zu bezahlen. Für Sklaven oder andere Güter wird hier kein Zoll erhoben, und die Kaufleute erhalten die Erlaubnis, bis zum Böhmerwald anzulanden und Handel zu treiben, wo immer sie wollen. Falls ein Bayer Salz zum Eigenbedarf nach Hause transportieren will: Nachdem der Schiffsführer dies eidlich bestätigt hat, muss er nichts bezahlen und soll sicher reisen.«
Mitte des 10. Jahrhunderts wunderte sich ein arabischer Händler darüber, dass es auf dem Markt der Stadt Mainz nicht nur orientalische Gewürze gab, sondern dass obendrein mit arabischen Silbermünzen aus Samarkand bezahlt wurde. Zu erklären ist diese Internationalität des Mainzer Marktplatzes mit der Etablierung grenzüberschreitender Netzwerke des Sklavenhandels, die von Osteuropa auf einer östlichen Route entlang des Dnjepr oder der Wolga und durch das zum Judentum konvertierte Chasarenreich nach Bagdad und auf einer westlichen Route nach Córdoba führten. Umfang und Bedeutung des Sklavenhandels wurden unter anderem von Michael McCormick in Origins of the European Economy (2001) betont. In der detailreichen Studie zu den Verkehrs und Warenströmen zwischen Europa, Afrika und dem Nahen Osten gelangte der Autor zu der Ansicht, dass zwischen 775 und 825 eine starke Ausweitung des Handels erfolgt sei und dies als der »Aufstieg der europäischen Wirtschaft«, interpretiert werden könne. McCormicks Opus Magnum zeigt zweierlei: Erstens entfaltete sich die europäische Wirtschaft im frühen Mittelalter langsam, aber kontinuierlich auf einem gegenüber der Antike reduzierten Niveau weiter und blieb dabei mit dem östlichen und südlichen Mittelmeerraum verbunden. Der Fernhandel mit Sklaven aus Osteuropa, die an die islamischen Höfe in Córdoba und Bagdad verkauft wurden, war dabei von zentraler Bedeutung. Neue Forschungen zum Sklavenhandel bestätigen dieses Bild. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die vielen archäologischen Funde islamischer Silbermünzen entlang der russischen Flüsse sowie in Nord- und Osteuropa als Beleg für ein riesiges Handelsnetz im 10. Jahrhundert gedeutet werden müssen und dass in diesem Handelssystem nicht Pelze oder Waldprodukte, sondern slawische Sklaven die wichtigsten Handelsgüter waren. Mehrere zehn Millionen Silbermünzen flossen in diesem Geschäft in den skandinavischen Raum. Zweitens machen die Ergebnisse von McCormick sowie neuere Studien zur frühmittelalterlichen Agrar- und Handelsgeschichte deutlich, dass die hochmittelalterliche Expansionsphase weder aus dem Nichts entstand noch als Gegensatz zu einem archaischen Frühmittelalter gesehen werden kann, sondern dass das Wirtschaftswachstum nach 1000 die Entwicklungen des 10. Jahrhunderts fortsetzte und intensivierte.
Als ein Indiz des Niedergangs der frühmittelalterlichen Wirtschaft und insbesondere des Handels wurde unter anderem der Wandel des Geldwesens interpretiert. Während im römischen Reich der Goldsolidus die Leitwährung gewesen war, wurde Silber im Frankenreich seit dem 7. Jahrhundert zur Grundlage des Münzwesens. Karl der Große brachte diese Entwicklung mit seiner Münzreform zum Abschluss und machte dadurch den Silberpfennig zur einzigen ausgeprägten Münze im Frankenreich. Inzwischen wird dieser Wandel nicht mehr als Zeichen des Niedergangs gesehen: Im Merowingerreich wurden an rund 800 Orten Gold-, Silber- und Kupfermünzen geprägt. Der fortschreitende Übergang zur Silberwährung und damit zu kleineren Münzen ist einerseits ein Zeugnis für die Reduzierung des internationalen Handels, andererseits aber auch eine pragmatische Veränderung, um den Klein- und Lokalhandel im Frankenreich und im westlichen Europa zu erleichtern. Der Übergang zum Silber hat zudem damit zu tun, dass im Westen keine Goldminen existierten und daher das Rohmaterial für die Münzprägung fehlte. Viele Transaktionen – vor allem im Rahmen der grundherrschaftlichen Abgaben – wurden allerdings nicht mit Geld, sondern in Form von Naturalien durchgeführt.