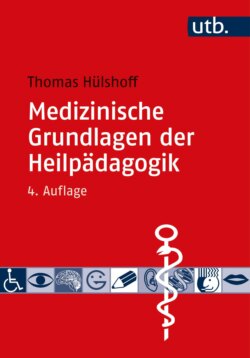Читать книгу Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik - Thomas Hülshoff - Страница 8
ОглавлениеAus dem Vorwort zur 1. Auflage
„Heilpädagogik ist Pädagogik und nichts anderes“ – so lautet einer der meistzitierten Sätze des Nestors der Heilpädagogik, Paul Moor. Insbesondere, so möchte man hinzufügen, ist Heilpädagogik keine therapeutische oder medizinische Unterdisziplin. Warum also, so könnte man fragen, sollte es dann „medizinische Grundlagen“ der Heilpädagogik geben?
Heilpädagoginnen und -pädagogen begegnen in ihrer pädagogischen und fördernden Arbeit an Förderschulen und darüber hinaus im außerschulischen Bereich Menschen mit Behinderungen bzw. körperlichen, sensorischen, kognitiven oder seelischen Entwicklungsverzögerungen und -störungen. Es ist ihre Aufgabe, diese Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern, sie zu unterrichten, zu begleiten, eingetretene oder drohende Entwicklungshemmnisse frühzeitig zu erkennen und zu ihrer Überwindung beizutragen. Sie wirken daran mit, Menschen mit Behinderungen ein gelingendes, an der Kultur der Gesellschaft teilhabendes Leben zu ermöglichen. Dabei orientieren sich Heilpädagoginnen und -pädagogen am Normalisierungsprinzip und sind weitgehend den Paradigmen von Assistenz, gesellschaftlicher Partizipation und Inklusion verpflichtet.
Diese hier nur angeschnittenen Aufgaben nehmen sie als Pädagoginnen und Pädagogen mit besonderer Herausforderung, nämlich der Heilpädagogik, wahr. Die Menschen, mit denen sie arbeiten (Schüler, Klienten), haben in der Regel auch Kontakte zu einer Reihe anderer Berufsgruppen (z. B. in der Medizin, Ergotherapie, Psychotherapie etc.), die ebenfalls vielfältige Hilfen anbieten – wenn auch nicht auf pädagogischem Gebiet. Schon deswegen ist die Kenntnis von psychologischen, medizinischen u. a. Ansätzen von Nutzen.
Darüber hinaus versteht sich Heilpädagogik aber auch als „Pädagogik unter erschwerten Bedingungen“. Zum einen sind darunter gesellschaftliche Erschwernisse (z. B. soziale Barrieren) zu verstehen, was soziologische sowie sozialpsychologische Grundkenntnisse voraussetzt. Zum anderen bestehen die Erschwernisse z. T. auch in organischen Behinderungen, Folgen von Erkrankungen oder somatisch-sensorisch-seelischen Veränderungen im Entwicklungsprozess, die zu einem gewissen Teil biologisch-medizinisch abgeklärt und behandelt – wenn auch in der Regel nicht geheilt – werden können.
Und hier kommen nun medizinische Grundkenntnisse ins Spiel. Wollen Heilpädagoginnen und -pädagogen ihrem Auftrag der „pädagogischen Förderung unter erschwerten Bedingungen“ gerecht werden, so ist es hilfreich und notwendig, sich mit allen Aspekten der Entwicklung ihrer Schüler und Klienten zu befassen, auch den medizinischen. Und insofern gibt es meines Erachtens neben beispielsweise psychologischen und soziologischen auch medizinische Grundlagen der Heilpädagogik.
Das vorliegende Buch will Studierenden und Praktikern der Heilpädagogik eine breit gefächerte Übersicht über medizinische und biologische Grundlagen geben. Zwar werden beispielsweise Heilpädagogen, die sich auf die Pädagogik hörgeschädigter Menschen spezialisieren, an gegebener Stelle auf spezielle und vertiefende Literatur verwiesen, weil spezielles Detailwissen den Rahmen des vorliegenden Buches sprengen würde. Analoges gilt für Sehbehinderung u. a. Teilgebiete. Aber es ist meines Erachtens hilfreich, wenn Heilpädagoginnen und -pädagogen (auch wenn sie sich spezialisieren) einen Überblick über die gesamte Breite möglicher medizinischer Aspekte und damit verbundener heilpädagogischer Herausforderungen haben. Nicht selten nämlich sind behinderte Kinder mehrfach behindert, und vor allem wirken sich Störungen (z. B. sensorische) mitunter auf andere Bereiche (z. B. die Motorik oder das emotionale Erleben) aus.
So möchte ich, ausgehend von den Differenzierungen der Ausbildung von Förderschullehrern, auf das Hören, das Sehen, die Motorik, die Sprache, auf kognitive Fähigkeiten sowie die Emotionen eingehen. Dabei wird in jedem Kapitel zunächst auf die neurophysiologischen und biologischen Grundlagen eingegangen, die meines Erachtens für jede Heilpädagogin und jeden Heilpädagogen von Bedeutung sind. Dies gilt auch für die Entwicklungen der jeweiligen Fähigkeit (z. B. der auditiven Wahrnehmung oder der Motorik), die anschließend dargestellt werden. Es folgen typische und in der heilpädagogischen Praxis häufig auftretende Störungen sowie spezielle Herausforderungen an Heilpädagogen in Schule und außerschulischen Arbeitsfeldern.
Das erste Kapitel befasst sich mit allgemeinen neurophysiologischen Grundlagen. Seitdem der damalige amerikanische Präsident, George Bush sen., die 1990er Jahre als „das Jahrzehnt des Gehirns und der Hirnforschung“ apostrophiert hat, haben sich Grundlagenforschung und z. T. auch anwendungs- und praxisorientierte Ansätze stürmisch weiterentwickelt, was, wie noch zu zeigen sein wird, auch an der Heilpädagogik nicht spurlos vorbeigegangen ist.
Ein weiteres Kapitel befasst sich mit sozialmedizinischen Aspekten und versucht, eine Brücke zwischen den international unterschiedlichen Aufgaben der Pädagogik und der Medizin (hier vor allem der Kinderheilkunde, Neuropädiatrie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie) zu bauen.
In meinem beruflichen Werdegang habe ich in unterschiedlichen Konstellationen Kontakt zur Heilpädagogik gehabt. In meiner assistenzärztlichen Zeit in Kinderklinik und Kinder- und Jugendpsychiatrie lernte ich vor allem die Kooperation mit den dort außerschulisch arbeitenden Heilpädagoginnen und -pädagogen sowie den Krankenhauslehrkräften kennen und schätzen. Dies gilt ebenso für die Zeit meiner Ausbildung zum Familientherapeuten. Zwei Jahre war ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sonderpädagogik der Universität Köln tätig und konnte dort einen Einblick in das differenzierte Förderschulwesen und die Ausbildung von Förderschullehrerinnen und -lehrern bekommen. In meiner jetzigen Tätigkeit als Professor für Sozialmedizin und medizinische Grundlagen der Heilpädagogik an der Katholischen Fachhochschule NW in Münster befasse ich mich vor allem mit außerschulischer Heilpädagogik und begleite seit sechs Jahren Praxis- und Entwicklungsprojekte der Rehabilitations- und Heilpädagogik, u. a. auch Weiterbildungsangebote für Menschen mit mehrfachen Behinderungen.
Vor allem diese Projekte und die Begegnung mit behinderten wie nicht behinderten Menschen (Studierenden wie Klienten) haben mich tief beeindruckt und starken Einfluss auf die Inhalte dieses Buches genommen.
Danken möchte ich Frau Landersdorfer vom Ernst Reinhardt Verlag, die mich zu diesem Buch ermutigt und in kritischen Situationen beraten hat.
Und vor allem möchte ich meiner Frau und meinem Sohn danken, deren familiärer Rückhalt mir Kraft und Anregung gibt.
Münster, im Februar 2005Thomas Hülshoff