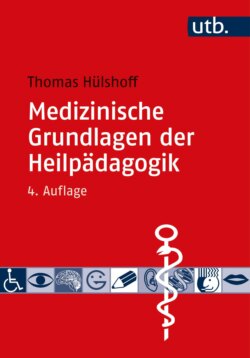Читать книгу Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik - Thomas Hülshoff - Страница 9
ОглавлениеVorbemerkung zur Inklusionsdebatte
Mit der Unterzeichnung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung hat sich die Bundesrepublik Deutschland zur Einrichtung eines inklusiven Bildungssystems verpflichtet. Das lateinische Verb „includere“ bedeutet „einschließen, einsperren, beinhalten“, und der Begriff der „Inklusion“ ist als Kontradiktum zur „Exklusion“, also dem Ausschluss bestimmter Gruppen, zu verstehen. Inklusion wendet sich also gegen gesellschaftliche Marginalisierung und sichert allen Menschen das gleiche und volle Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe, ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse (vgl. Hinz 2006). In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff der „Heterogenität“ von Bedeutung, der sich beispielsweise in Slogans wie „Es ist normal, verschieden zu sein“ oder der Erläuterung der Aktion Mensch „Inklusion ist, wenn Anderssein normal ist“ widerspiegelt. Unter Teilhabe (engl.: participation) versteht man im Rahmen der Inklusionsdebatte das Recht (und nicht nur die Möglichkeit), an allen sozial, gesellschaftlich und kulturell bedeutsamen Prozessen eigenständig und gleichberechtigt mitwirken zu können und somit die Gesellschaft zu gestalten. Der unveräußerliche, durch die universellen Menschenrechte konstituierte rechtliche Anspruch eines jeden Menschen auf Teilhabe im oben genannten Sinne ist das wesentliche Merkmal des rezent diskutierten Inklusionsbegriffs.
Zur Durchführung von Prozessen zur Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft sind das Normalitätsprinzip, persönliche Assistenz, eine solide und ausreichende Finanzierung, bedarfsgerechte Unterstützung, geeignete strukturelle Veränderungen im Bildungs- und Gesundheitssystem, aber auch die Bereitschaft zu gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen als unabdingbare Voraussetzung zu nennen. Inklusion ist kein statisches Faktum, sondern ein Prozess, bei dem eine Gesellschaft und alle ihre Mitglieder davon ausgehen, dass jede/jeder Einzelne nicht nur an gesellschaftlichen Prozessen partizipieren, sondern essentielle Bestandteile dieser Gesellschaft sind und sie somit mitdefinieren.
Die Forderung nach Inklusion findet sich auf verschiedenen Ebenen. Beispielhaft sei der Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslage von Menschen mit Beeinträchtigungen (Bundesminister für Arbeit und Soziales 2013) genannt, in dem auf die Felder der Familie und des sozialen Netzes, der Bildung und Ausbildung, der Erwerbsarbeit und des Einkommens, der alltäglichen Lebensführung, der Gesundheit, Freizeitkultur und Sport, Sicherheit und Schutz vor Gewalt sowie das Feld von Politik und Öffentlichkeit eingegangen wird. In diesem Bericht, auf den hier inhaltlich nicht detailliert eingegangen werden kann, kommen zahlreiche Barrieren, die einer Inklusion in diesen Teilbereichen entgegenstehen, zur Sprache. Diese Barrieren sind nicht nur physischer (beispielsweise nicht-Akzessibilität von Gebäuden, Einrichtungen oder öffentlichem Verkehr), sondern vor allem auch psychischer Natur (Kommunikationsbarrieren, Vorurteile usw.). Insbesondere wird auch auf strukturelle Barrieren, die es abzubauen gilt, eingegangen.
Einen besonderen Schwerpunkt findet die Inklusionsdebatte zurzeit im Bereich der Bildungspolitik. Alle Menschen, ohne Ausnahme, bestimmen und gestalten – geht es nach dem Inklusionsprinzip – Struktur und Alltag einer Schule mit. Denkt man diesen Gedanken zu Ende, kommt man zum Postulat einer „Schule für alle“, in der prinzipiell auch jede Lehrerin und jeder Lehrer befähigt sein muss, alle Kinder gemäß ihres individuellen Förderbedarfs zu begleiten.
Angesichts dieses gesellschaftlichen Umbruchs stellt sich die Frage, wie ein Buch über die „medizinischen Grundlagen der Heilpädagogik“ genutzt werden kann. Wenn man den Inklusionsgedanken aufgreift, kann es sich nicht ausschließlich an Berufsangehörige der (oft außerschulischen) Heilpädagogik oder Förderschullehrer wenden. Adressaten sind vielmehr alle, die in einem zunehmenden Inklusionsprozess in ihrem Beruf Menschen mit und ohne Behinderung begegnen und sie begleiten. Im schulischen Bereich betrifft das letztlich alle Lehrerinnen und Lehrer, im außerschulischen Bereich neben HeilpädagogInnen und HeilerziehungspflegerInnen auch ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen oder Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, um nur einige zu nennen. Sie alle brauchen, um Menschen mit und ohne Behinderungen in den jeweiligen, zunehmend inkludierenden Settings zu begleiten und individuell angemessen zu fördern, ein solides Grundwissen über die biologisch-anthropologischen Grundlagen zum Verständnis von Behinderung sowie den sich daraus ergebenden Herausforderungen.
Es wäre mir ein Anliegen, dass nicht nur HeilpädagogInnen im engeren Sinne, sondern auch andere Berufsgruppen einen Nutzen von dem hier vermittelten medizinischen Basiswissen haben, wenn es um die Gestaltung inklusiver Prozesse geht.