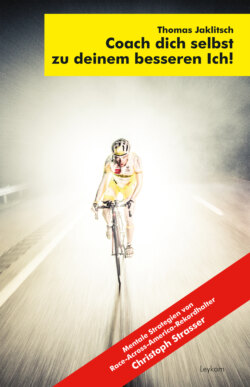Читать книгу Coach dich selbst zu deinem besseren Ich! - Thomas Jaklitsch - Страница 8
Innovation
ОглавлениеAls Christoph Strasser im Herbst 2012 beim entspannten Plaudern in meinem Beratungszentrum einerseits die Saison Revue passieren ließ und andererseits bereits mehr als intensiv auf die Saison 2013 schielte, kristallisierte sich ein Ziel immer stärker heraus. Ein Wunsch, den sich in den letzten 33 Jahren kein Mensch erfüllen hatte können: Das Race Across America unter acht Tagen zu fahren. Aufgrund der Analyse seiner Leistungsdaten und der Vergleiche der bisherigen Ergebnisse aus den vergangenen Jahren, seiner gefahrenen Zwischenzeiten bei den jeweiligen Zeitstationen des Events, konnte es möglich sein. Kann Christoph der erste Mensch in der Geschichte des seit 1976 jährlich stattfindenden Radevents sein, der 5.000 Kilometer quer durch Amerika unter acht Tagen zu radeln vermag? Ist der Anspruch vermessen? Klarerweise nur möglich, wenn auch die äußeren Rahmenbedingungen wie Wetter (Niederschläge wie auch Temperatur) und etwaige Pannen, an Rad wie an Begleitfahrzeugen, ihn verschonen würden. Aus dem gesundheitsbedingten Rennabbruch 2009 wurde gelernt, der daraus resultierende Sieg 2011 und auch der zweite Platz 2012 waren ein Fundus an Lernmöglichkeiten. Die Antwort auf die oben gestellte Frage und auch das Motto dazu, „time to perform“, konnten bereits in „Hilf mir, meinen Lebenstraum zu erfüllen“ gegeben werden. Ja, er konnte der erste Mensch sein. Doch viel wesentlicher scheint in diesem Zusammenhang die Frage zu sein: Wie? Und zu welchen weiterführenden Konsequenzen positiver wie möglicherweise negativer Natur? Also galt es, das Gute noch weiter zu optimieren, und die Dinge, die noch nicht ausreichend funktionierten, zu sanieren. Vor allem die Nervenschädigungen an den Händen – bedingt durch zu viel Druck und Gewicht auf den Händen während der Querung der USA – sollten dringend beseitigt werden. Durch die Straßenverhältnisse einerseits und aufgrund der Sitzposition von Christoph auf seinem Rad bei seinem Sieg 2011 hatte er gegen Ende des Rennens sogar Mühe, seine Trinkflaschen zu halten, geschweige denn waren feinmotorische Bewegungen seiner Finger an beiden Händen möglich. Dies ist zu einem bestimmten Grad einfach eine logische Folge der mechanischen Belastung der Hände über diese Zeitspanne von mehr als einer Woche. Immerhin sind die Hände, die Füße und die Auflagefläche des Gesäßes die einzigen Kontaktflächen, die den menschlichen Körper mit dem Fahrrad verbinden. Je nach individuellem Gewicht und mehr oder weniger komfortabler bzw. aerodynamischer Sitzposition werden an den Händen vor allem der Ulnar-Nerv – an der Außenseite der Handkante gelegen – und der Nervus Medianus (Karpaltunnelsyndrom) – direkt in der Mitte des Handballens – beansprucht. Nachdem Christoph nach seinem Sieg 2011 wochenlang Mühe hatte, ohne hinzusehen seine Hand und seine Finger zu steuern, wurden bereits 2012 vielfältige Verbesserungen gesucht. Die Verbesserungsideen reichten sogar bis zu speziellen orthopädischen Auflagen für die Hände und Unterarme aus dem Rollstuhl-Sport. Es war also ausreichend Verbesserungspotenzial vorhanden, um das neue Ziel, das RAAM 2013 unter acht Tagen zu schaffen, zu erreichen. Doch nicht nur in punkto Komfort, um eben länger entspannter und dadurch leistungsfähiger sein zu können, sollten Veränderungen und Optimierungen helfen, sondern vor allem in einem Punkt: Aerodynamik! In diesem Bereich suchten wir Unterstützung im Vorhaben, diesen Rekord aufzustellen, und fanden sie: Bisher galt bei einem Langstreckenrad das ungeschriebene Gesetz: Komfort an erster Stelle! Weil die aerodynamischste Sitzposition auf Dauer keinen Erfolg brächte, wenn sie nicht ausreichend lange und nur mit hohem energetischen Aufwand aufrechtzuerhalten wäre. Trotzdem war gerade deswegen die Idee geboren, ein klassisches Zeitfahrrad so komfortabel wie nur möglich an Christophs Körper anzupassen, damit auf den unendlichen Geraden Amerikas dieser Vorteil sich in Zeitersparnis niederschlägt. Die Straßen durch die Wüstenbereiche von Kalifornien, Arizona und Utah sowie auf den bis zum Horizont führenden Straßen zwischen den Weizenfeldern von Kansas mussten doch für aerodynamischen Vorteil zu nutzen sein. Die Idee eines Zeitfahrrades musste reifen. Doch nicht lange, denn nur wenige Monate später fand sich Christoph tagelang bei seinem Radhersteller wieder, um an der Einstellung der Sitzposition auf einem Zeitfahrrad zu feilen. Perfektioniert wurde diese Feineinstellung dann bei jenem Hersteller, der Benchmark in punkto Aerodynamik und Komfort gleichzeitig ist: Syntace. Und wirklich: Die Mühen waren so weit von Erfolg gekrönt, dass Christoph nicht nur schneller, sondern auch mit weit mehr Wohlbefinden sein Training stundenlang auf dem Zeitfahrrad vollbringen konnte. Den Oberkörper möglichst bequem abgestützt auf den Auflagen seines Zeitfahrauflegers. Eine Aussage, die seine mentale Einstellung dazu gut illustriert, getätigt im letzten Coaching kurz vor dem Abflug zum RAAM 2013, ist bemerkenswert: „Wenn man auf so einem Zeitfahrrad sitzt, ist man automatisch, ohne dass man irgendwie anders Rad fährt, um ein bis zwei km/h schneller.“ Rechnet man diesen einfach vor sich hin gesagten Vorteil auf die möglichen Flachpassagen beim RAAM mit ein – welch Riesenvorteil! Immerhin konnte Christoph das Race Across America schon zweimal in acht Tagen und weniger als neun Stunden beenden. Vorausgesetzt die Rahmenbedingungen ließen es zu und Christophs körperlicher wie mentaler Leistungsoutput wären wieder gleich stark, wäre diese magische Acht-Tage-Grenze zu kippen. Doch so weit war es noch nicht. So weit waren wir noch nicht. Immerhin ist es ein hohes Risiko, bei einem Langdistanz-Radrennen von einer Woche und mehr etwaige Rückenschmerzen zu produzieren, die Grund für Muskelverhärtungen in den Beinen und in der Pomuskulatur sein können. Deren Folgewirkungen auf Gelenke und Sehnen wiederum zu Entzündungen und letztlich zu einem Abbruch des Rennens führen könnten. Andererseits ist auch der logistische Aufwand, Räder zu zerlegen, sie nach Amerika einzufliegen, dort wieder aufzubauen, enorm. Zudem besteht das Risiko, dass aufgrund der „sorgsamen“ Behandlung des Sondergepäcks bei den Fluglinien diese High-Tech-Produkte aus Carbon und Aluminium nicht im gewünschten Zustand ankommen. Auch hier gilt: Vorsicht und Planung sind besser als ein ungestümes Voranpreschen mit den dazugehörigen Nachteilen.
Keine Stopp-Schilder mehr?! Foto: www.lupispuma.com
Doch die Idee, SUB 8, nahm immer mehr Gestalt an. Immerhin wollten wir die besondere Erfindung eines Rennrads, einer futuristisch anmutenden „Zeitfahrmaschine“, verwenden. Diese werden im Profi-Radrennsport normalerweise für Prologe über wenige Kilometern und lange Mannschaftszeitfahren von gerade mal 70 Kilometern verwendet, aber wir wollten einen Vorteil für vermutlich 1.500 Kilometer oder sogar mehr. Im Langstrecken-Triathlon, dem Ironman (3,8 km schwimmen, 180 km Rad fahren, 42 km laufen), benutzt man ja bereits seit Jahren die etwas aerodynamisch entschärften Zeitfahrräder für die ca. 180 Kilometer der Raddistanz. Aber würde dies auch auf mehrere 100 Kilometer funktionieren? Im herkömmlichen Profi-Radsport haben die flachen Einzel- und Mannschaftszeitfahren schon oft Etappenrennen wie die Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta etc. entschieden. Die andere Rahmengeometrie im Vergleich zu einem normalen Straßenrennrad, die aerodynamischeren Rohrquerschnitte, Zeitfahrlenker, aber vor allem die wettkampfspezifisch günstigere Sitzposition, die den Radfahrer etwas weiter vor über das Tretlager bringt, in Kombination mit einem Zeitfahraufleger schaffen sekundenweise Zeitersparnis auf jedem Kilometer. Und genau diesen Vorteil wollten wir nutzen.
Steve Jobs, gespielt von Ashton Kutcher, wurde in seiner Film-Biografie folgende Aussage in den Mund gelegt:
„Man kann nicht die Konkurrenz beobachten, um es besser zu machen.
Man muss die Konkurrenz beobachten, um es anders zu machen.”
(Steve Jobs, Film-Biografie, 2013, Minute 72)
Zeitfahrräder tauchten doch in Team- bzw. Staffelbewerben immer wieder für kurze Strecken bei Langstrecken-Radrennen auf. Doch wieso nutzten es die Solofahrer noch nicht konsequent? Der Österreicher Gerhard Gulewicz fuhr als Solo-RAAM-Teilnehmer bereits 2009 mit Zeitfahrhelm aerodynamisch optimiert über die schnurgeraden Straßen von Kansas. Er blieb damals die Ausnahme. (Obwohl bereits die innovativste Kraft im Radsport, der Triathlon, und ein gleichnamiges Magazin im Jahr 2005 der Aerodynamik seitenweise Raum gaben. Dort bestätigte man zwei Prozent Leistungsersparnis nur durch Verwendung von Zeitfahrhelmen.)
Rennrad versus Aerorad Foto: www.lupispuma.com
Nach den Stunden, Tagen, Wochen der Vorbereitungen, der Optimierungen und des Trainings auf dem Zeitfahrrad half dennoch nur eines: TUN. Die drei Buchstaben, die schon Goethe als Erfolgsfaktor definierte. Als Generalprobe für das RAAM 2013 durfte also das Race Across Italy fungieren. Halb so kurz wie das Race Around Slovenia und vor allem mit dem Termin Mitte April gab es ausreichend Regenerationszeit bis zum Start des RAAM Mitte Juni. Die wunderschöne Strecke von 630 Kilometern mit 5.000 Höhenmetern führte von Nettuno im Süden von Rom auf die andere Seite der Küste nach Chieti (Pescara) und wieder retour. Laut Streckenprofil ein idealer Testparcours zur Kontrolle der Arbeit an der Sitzposition von Winter und Frühjahr. Und so war es dann auch. Die im vorangegangenen Coaching angepeilte Zielzeit von 19 Stunden konnte Christoph weit unterbieten und einen eindrucksvollen Sieg bei der Pendelfahrt quer durch Italien mit nach Hause bringen. Mit einem fast unglaublichen Schnitt von 35,5 km/h, einer Fahrzeit von 17 Stunden 44 Minuten, distanzierte er die nachfolgenden um mehrere Stunden. Christoph konnte damit eine perfekte Generalprobe für die Verwendung eines Zeitfahrrades bei einem Langstreckenradrennen liefern. Und damit war ein weiteres Mosaiksteinchen für das Ziel „Sub 8“ beim RAAM 2013 in erreichbare Nähe gerückt. Zumindest für uns wurde ab nun ein gemeinsamer Nenner, der alle schnellen Sportarten eint, mit ins Team geholt: die Aerodynamik!
Wechsel auf das Zeitfahrrad RAAM 2013 Foto: www.lupispuma.com
Schlussfolgerung
Wenn man nahe an menschlichen Grenzen arbeitet bzw. diese sogar überschreiten möchte, hat man zwangsläufig immer mit Innovation zu tun. Eine Innovation ist aber erst dann eine Innovation, wenn aus einer Idee eben ein neues Produkt, ein neues Denken, umgesetzt wurde und wahrhaftig erfolgreich Anwendung gefunden hat und im besten Fall dupliziert wurde und in der Welt einen Markt – eine Wiederholung – gefunden hat. Christoph Strasser setzte mit seinen 7 Tagen 22 Stunden und 11 Minuten, die er für das Race Across America 2013 benötigte, einen Meilenstein. Dieser Weltrekord, als erster Mensch in der Geschichte dieses Rennens den amerikanischen Kontinent unter acht Tagen mit einem Fahrrad zu durchqueren, fand sich sogar im Guinness-Buch der Rekorde wieder. Nicht umsonst war er darin auf seinem Zeitfahrrad abgebildet.
Möchte man letztendlich innovativ sein, kann es nicht anders funktionieren, als die gewohnten Wege zu verlassen und möglicherweise Risiken auf sich zu nehmen – oder menschlich ausgedrückt: seine persönliche, gewohnte Komfortzone zu erweitern. Die Zeichen der Zeit zu erkennen und im richtigen Moment am richtigen Ort die richtige Entscheidung zu treffen, ist das große Mirakel gelungener Innovation oder sogar seines Lebens. Die Geschichte der Fehleinschätzungen unserer Menschheitsgeschichte ist lang. Der Bogen spannt sich von einer Musik-Combo aus Liverpool, bei deren Probeaufnahme 1962 die Plattenbosse entschieden haben, dass sich so etwas nie verkaufen lasse. – Nicht einmal ein Jahr später führten die Beatles die Charts nicht nur an, sondern dominierten das Musikgeschehen für viele Jahre. Doch auch in der neueren Zeit gab es ausreichend unerkannte und ungenutzte neue Ideen, die innovativ letztlich eine ganze Generation prägen durften. Joanne K. Rowling blitzte bei sechs Verlagsmanagern mit ihrem Manuskript zu Harry Potter ab. Einer erkannte die Chance eines Bestsellers, griff zu und machte aus der Autorin nach insgesamt sieben Bänden Harry Potter und gleich vielen Filmen die erste Schriftstellerin der Welt, die mit Büchern über eine Milliarde Dollar verdiente. Viele Klassiker der nicht erkannten Innovation liefert die Geschichte der Technik. Selbst Nobelpreisträger Albert Einstein gab der friedlichen Nutzung der Atomenergie keine Chance, weil er sich zu sehr für deren kriegerische Verwendung schämte.
Legendärer sind natürlich die ökonomischen Einschätzungen und Reaktionen auf die technischen Innovationen unserer Kommunikation. Bei der Einführung des Telegramms lautete der allgemeine Tenor: Brauchen wir nicht, wir haben ja Briefe. Bei der Einführung des Telefons: Brauchen wir nicht, wir haben ja Telegramme. Bei der Einführung des Computers: Brauchen wir nicht, zu teuer und wir haben ja Schreibmaschinen. Eine ähnliche Fehleinschätzung beging auch Microsoft-Chef Steve Ballmer: Er sah im iPhone lediglich ein Randgruppenphänomen. Laut einer Studie aus dem Juli 2015 hat Apple mit dem iPhone in den USA einen Marktanteil von 50 Prozent aller verwendeten Smartphones. Ein Randgruppenphänomen, das sich seit der Markteinführung 2007 weltweit bis zum März 2015 700 Millionen Mal verkauft hat. Möglich nur, weil Steve Jobs sein Motto „Denke das andere“, nämlich das, was alles noch möglich wäre, konsequent verfolgte. Bereits vor dem Jahr 2000 begann die technische Entwicklung und die Ideenreifung eines Multi-Touch-Bildschirms, der später zu den berühmt-berüchtigten Wischhandys der Jetztzeit führte.
So wie Christoph Strasser viel Energie in sein Ziel, eine Querung Amerikas unter acht Tagen zu schaffen, investiert hat, haben andere Menschen viele Energien in ihre Ideen, Wünsche und Träume gesteckt, um letztendlich nachhaltig eine Innovation, eine Erneuerung für sich und andere zu schaffen. Die Energie, die investiert wurde, geht letztlich nicht verloren, sondern darf wieder retour kommen. Die Energie, die man hineinsteckt, erhält man als Response. Viel Input kann viel Output bedeuten. Oft nicht gleich und man ist auch nicht vor Fehlschlägen gefeit. Steve Jobs ist mit Apple ein großartiges Beispiel dafür gewesen, welche Kraft Ideen in uns wecken können – und welche Geduld wir auch haben dürfen, um den Output der Innovation zu schaffen.
Windkanal 2014 Foto: www.lupispuma.com
Denke das Andere!
An alle, die anders denken:
Die Rebellen,
die Idealisten,
die Visionäre,
die Querdenker,
die, die sich in kein Schema pressen lassen,
die, die Dinge anders sehen.
Sie beugen sich keinen Regeln,
und sie haben keinen Respekt vor dem Status quo.
Wir können sie zitieren, ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen.
Das Einzige, was wir nicht können, ist sie zu ignorieren,
weil sie Dinge verändern,
weil sie die Menschheit weiterbringen.
Und während einige sie für verrückt halten,
sehen wir in ihnen Genies.
Denn die, die verrückt genug sind, zu denken,
sie könnten die Welt verändern,
sind die, die es tun.
(W. Isaacson, Think Different. In: Steve Jobs, 2011, S. 329)
Also welche deiner Ideen ist so anders als die Ideen der anderen Menschen? Die Erfahrung lehrt, dass eine Idee, eine richtig gute Idee, einen hohen Anteil Andersartigkeit haben darf, um letztlich wirklich innovativ und erfolgreich zu sein. Und dieser Anspruch gilt nicht nur für Erfinder, Techniker oder Produktentwickler, sondern vor allem für dich als Mensch und für deinen Lebensentwurf. Also noch einmal: Welche deiner Ideen, so andersartig sie auch ist, würde es verdienen, mit der notwendigen Geduld, mit einem sinnvollen energetischen Einsatz verfolgt zu werden?
Dein Lohn: neuen Schwung in deine Welt zu bringen und dadurch deine Möglichkeiten für die Welt zu verändern!
Praxisübung: gezielter Tag-/Entspanungs(t)raum
Du kannst dich auf einen Sessel oder Ähnliches setzen, die Fußflächen auf dem Boden, und deine Augen schließen. Beginne mehrmals mit leichtem Druck jeweils mit dem Zeigefinger vom Ansatz der Augenbraue bis zu deren Ende sanft zu reiben. Du kannst diese „Augenbrauenmassage” mehrfach auch gerne für eine Minute oder mehr für dich genießen. Dann decke mit deinen Händen deine Augen vollkommen ab. Sanfter Druck der Handballen am Auge wird meist als sehr angenehm empfunden und deine Netzhaut hat Zeit, sich zu erholen. Währenddessen kannst du bereits beginnen, regelmäßig drei Sekunden ein- und drei Sekunden auszuatmen. Vielleicht kannst du nach weniger Zeit deinen Atemrhythmus der Ein- und Ausatmung auf vier bzw. fünf Sekunden verlängern. Dann lade ich dich dazu ein, dich an einen angenehmen Moment – vielleicht aus dem Urlaub – zu erinnern. Dies wäre vermutlich eine sinnvolle Möglichkeit der Entspannung.
Oder wenn es passender zum Thema Innovation sein darf: Nutze den Moment für einen Tagtraum. Lass deiner Fantasie einmal freien Raum für Ideen, Innovationen – wofür im Alltag oft zu wenig Raum und Zeit bleibt. Schaffe dir einen kreativen mentalen Raum. Was würdest du dort erleben können? Wie bunt könnten die wahrgenommenen Bilder sein? So nach dem Motto: Was würdest du heute noch beginnen können, wenn du sicher sein könntest, alles wird dir gelingen? Was könntest du dort sehen, hören, spüren, vielleicht sogar riechen oder schmecken? Genieße deine Wahrnehmungen und gönne dir insgesamt 5–7 Minuten Zeit dafür. Danach beginne dich genüsslich zu strecken und zu dehnen. Und erst wenn du körperlich munter bist, öffne wieder deine Augen.
Zur zusätzlichen Aktivierung tagsüber, um wieder voller Konzentration zu sein, ist die Denkmützenübung angenehm: Mit Daumen und Zeigefinger die Ohrmuscheln vom Ohrläppchen beginnend nach oben kräftig ausmassieren.