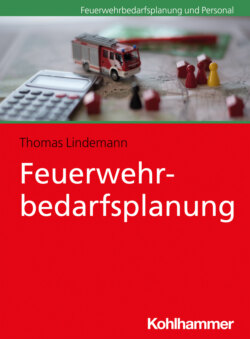Читать книгу Feuerwehrbedarfsplanung - Thomas Lindemann - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einflussgrößen auf die Festlegung der Planungsziele
ОглавлениеBei der Festlegung der Planungsziele steht der Kommune im Rahmen ihrer verfassungsmäßig zugesicherten Selbstverwaltungshoheit ein gewisser Gestaltungsspielraum zu (vgl. Kapitel 2.3). Durch gesetzliche oder aufsichtsbehördliche Vorgabenwirddiesem jedoch ein rechtlicher Rahmen gesetzt. Allerdings gibt es in den meisten Bundesländern weniger rechtsverbindliche Vorgaben als gemeinhin angenommen. So existiert beispielsweise entgegen landläufiger Kenntnis lediglich in zwei Bundesländern eine gesetzliche Hilfsfrist (vgl. Kapitel 4.6.18). Ferner kann sich bei der Festlegung der Planungsziele an Hinweisen und Empfehlungen von Fachverbänden (z. B. AGBF, Landesfeuerwehrverbände) orientiert werden.
In der Vergangenheit wurde die Debatte um das »richtige« Planungsziel sehr technokratisch geführt, indem (vornehmlich durch die Empfehlungen der AGBF) ein Anwendungszwang der von ihnen veröffentlichen Planungsparameter suggeriert wurde, die sich aus vermeintlich naturwissenschaftlich-medizinischen Tatsachenzusammenhängen im Kontext der physiologischen Rauchgasverträglichkeit von Brandopfern abgeleitet haben (vgl. Kapitel 4.5). Zwar hat die postulierte Argumentationskette keinen Bestand mehr, dennoch ist die Feuerwehrbedarfsplanung nicht frei von technischen Sachzusammenhängen. So steht beispielsweise der Zusammenhang zwischen Interventionszeit der Feuerwehr und Schadensausmaß bei einem dynamischen Ereignis außer Frage. Je eher die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrifft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich eine Schadensbegrenzung vornehmen zu können. Und auch zur Bewältigung eines Einsatzszenarios ist sachlich-logisch ein konkreter Kräfte- und Geräteansatz erforderlich. Zudem liefern immer wieder neue Forschungsergebnisse eine empirische Erkenntnisbasis, auf die bedarfsplanerische Maßnahmen aufsetzen.
Da sich aber nicht alle Festlegungen der Planungsziele vollständig aus technischen oder wissenschaftlichen Erfordernissen ableiten lassen, sondern letztendlich politisch getroffen werden, spielen auch ethische Aspekte eine Rolle bei der Suche nach einem angemessenen Versorgungsniveau der Feuerwehr (vgl. Lindemann, 2016). Feuerwehrbedarfsplanung ist insbesondere auch eine Frage der »Verteilungsgerechtigkeit«, zu der in der Literatur und der Gesellschaft ein intensiver Wertediskurs geführt wird. Die Ethik setzt dort an, wo Rechtsnormen wie auch Sachgründe an ihre Grenzen kommen und sich Gestaltungsspielräume auftun. So etwa bei der Frage, ob es ethisch vertretbar ist, für unterschiedliche Bereiche (gar innerhalb einer Gemeinde) auch unterschiedliche Planungsziele und damit unterschiedliche Versorgungsniveaus festzulegen. Ethisch geboten ist es beispielsweise auch den Einsatzkräften gegenüber sicherzustellen, sie durch eine adäquate Dimensionierung der Feuerwehr nicht unkalkulierbaren Risiken auszusetzen.
Nicht zuletzt unterliegt die Planung der Feuerwehr auch dem Diktat des Machbaren: der normativen Kraft des Faktischen. In den Orten beispielsweise, in denen partout keine tagesalarmverfügbaren oder feuerwehrdiensttauglichen Bürgerinnen und Bürger wohnen und in denen eine hauptamtliche Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung jenseits jeglicher Verhältnismäßigkeit läge, müssen faktisch längere Eintreffzeiten und die Notwendigkeit zur Selbsthilfe und -rettung akzeptiert werden (vgl. auch Kapitel 2.4).