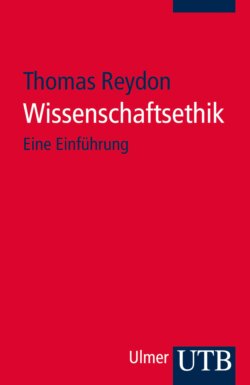Читать книгу Wissenschaftsethik - Thomas Reydon - Страница 7
1.2 Was kann die Wissenschaftsethik leisten?
ОглавлениеAls Teilbereich der Philosophie und insbesondere der Wissenschaftsphilosophie teilt die Wissenschaftsethik die Ziele dieser Fächer. Die Ziele dieser Fächer werden jedoch von verschiedenen Philosophen sehr unterschiedlich gesehen. Ein Ziel der Wissenschaftsphilosophie ist es auf jeden Fall, zu verstehen, wie die verschiedenen Wissenschaften funktionieren und was sie charakterisiert, d. h. was Wissenschaft zur Wissenschaft macht. Die theoretische Wissenschaftsphilosophie richtet sich auf die theoretisch-philosophischen Aspekte dieser Fragestellung, wie die Überprüfungs- und Begründungsweisen von wissenschaftlichem Wissen, die Struktur wissenschaftlicher Erklärungen, die Rolle von Naturgesetzen in den Wissenschaften, die Interpretation wissenschaftlicher Theorien, die Analyse wissenschaftlicher Kernbegriffe usw. Durch Klärung dieser Fragen soll ein gutes Bild davon entstehen, was Wissenschaft genau ist und wie sie in der Lage ist, verlässliches Wissen zu produzieren. Ein weiteres Ziel der theoretischen Wissenschaftsphilosophie liegt darin, das von den Wissenschaften produzierte Wissen sowie die gebrauchten Produktionsmethoden kritisch zu reflektieren, Schwächen aufzudecken und in dieser Weise die Wissenschaften bei ihrer Arbeit zu unterstützen (Reydon und Hoyningen-Huene, 2011). In diesem Bild stellt die Wissenschaftsphilosophie die „Selbstverständlichkeiten“ der Wissenschaften – das als verlässlich angenommene Wissen sowie die als gut funktionierend angesehenen Forschungsmethoden – in Frage (ebd.). Die Wissenschaftsethik hat ähnliche Ziele, bezieht sich aber bei deren Erarbeitung auf die moralischen und gesellschaftlichen Aspekte der Wissenschaftspraxis.
Wie alle Teilgebiete der Philosophie muss sich die Wissenschaftsethik jedoch bezüglich ihrer Ziele bescheiden geben. Die Philosophie produziert selbst kein positives Wissen über die Beschaffenheit der natürlichen und sozialen Welt, wie es die Natur- und Sozialwissenschaften tun (ebd.). Vielmehr zeigt sie uns die unterschiedlichen Aspekte der Dinge, d. h. die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Welt, in der wir leben. Der berühmte Philosoph Bertrand Russell schreibt in seinem Buch Probleme der Philosophie (1912) diesbezüglich:
„Die Philosophie kann uns zwar nicht mit Sicherheit sagen, wie die richtigen Antworten auf die gestellten Fragen heißen, aber sie kann uns viele Möglichkeiten zu bedenken geben, die unser Blickfeld erweitern und uns von der Tyrannei des Gewohnten befreien. Sie vermindert unsere Gewissheiten darüber, was die Dinge sind, aber sie vermehrt unser Wissen darüber, was die Dinge sein könnten.“ (Russell, 1967, S. 138).
Mit anderen Worten: Die Philosophie bietet keine endgültigen Antworten auf die Fragen an, die sie stellt, sondern zeigt uns lediglich mögliche Antworten und Positionen und analysiert, was gute Argumente für bzw. gegen diese möglichen Antworten und Positionen sein könnten.
Gleiches gilt auch für die Wissenschaftsethik: Sie kann auf mögliche moralische Probleme bezüglich der Wissenschaften und ihre möglichen Ursachen hinweisen, unterschiedliche Sichtweisen auf solche Probleme vorschlagen und erörtern, was für bzw. gegen diese verschiedenen Sichtweisen gesagt werden könnte. Sie kann jedoch diese Probleme für die Wissenschaften nicht lösen. Hier sind die einzelnen Wissenschaftler selbst gefragt, wie auch die verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen und die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft als Ganzes. Wie im Verlauf dieses Buchs deutlich werden sollte, soll sich die Wissenschaft als (zumindest teilweise) autonomer Bereich selbst ihre Werte und Normen geben. Die Wissenschaftsethik kann den Wissenschaften lediglich als beratende Instanz zur Seite stehen – sie kann nicht für sie ihre Werte und Normen festsetzen.
Diesbezüglich soll angemerkt werden, dass hier nicht nur die Naturwissenschaften im Blick sein sollen, sondern alle Bereiche der Wissenschaft. Wenn von Wissenschaftsethik die Rede ist, geht es auch immer um wissenschaftliches Fehlverhalten, d. h. um Tatbestände wie die Fälschung von Forschungsergebnissen, die Sabotage der Forschung von Konkurrenten, Ideendiebstahl oder auch Plagiate, die überall in der Wissenschaft vorkommen können und auch tatsächlich auftreten.2 Viele Diskussionen und Ansätze in der Wissenschaftsethik beziehen sich in erster Linie auf die spezifische Situation in den Naturwissenschaften und der medizinischen Forschung, weil sehr viele der bekannten und in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierten Fälle wissenschaftlichen Fehlverhaltens gerade in diesen Bereichen der Wissenschaft aufgetreten sind. Ein sehr bekanntes Beispiel ist der Fall des Biologen Paul Kammerer, der sich dem Vorwurf der Fälschung einiger Ergebnisse seiner Forschung zur Vererbung bei Geburtshelferkröten (Alytes obstetricans) ausgesetzt sah und im Laufe der Kontroverse über diesen Vorwurf 1926 Selbstmord beging.3 Ein weiteres sehr bekanntes Beispiel ist der Fall des so genannten „Piltdown-Menschen“, in dem der Amateur-Archäologe Charles Dawson Knochenreste unterschiedlicher Arten bearbeitete, chemisch alterte und zusammen als die Überreste einer bis dahin unbekannten Menschenart (Eoanthropus dawsoni) präsentierte. Obwohl sich dieser Fall schon am Anfang des 20. Jahrhunderts abspielte, wurde er erst in den 1950er-Jahren aufgedeckt (Broad und Wade, 1982, S. 119–122; Weiner, 1955). Und auch in der jüngeren Wissenschaftsgeschichte finden sich einige bekannte Beispiele wissenschaftlichen Fehlverhaltens im naturwissenschaftlichen und medizinischen Bereich. Zu denken wäre an den Fall des Physikers Jan-Hendrik Schön (beschrieben in Reich, 2009) und den Fall des Klonforschers Hwang-woo Suk4, die beide im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts für Schlagzeilen in den Medien sorgten. In beiden Fällen ging es um die nachgewiesene Fälschung von Forschungsergebnissen in Veröffentlichungen in prominenten Fachzeitschriften wie Science und Nature. Die Geschichte hat jedoch deutlich gezeigt, dass das Auftreten von Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens sicherlich nicht auf die Naturwissenschaften und die Medizin beschränkt ist. Bekannte Beispiele aus den Sozialwissenschaften sind die Betrugsfälle der Psychologen Cyril Burt (Broad und Wade, 1982, 203–211) und Diederik Stapel (Commissie Levelt, 2011). Aus anderen Bereichen der Wissenschaft können beispielhaft die Plagiatsvorwürfe zu den Dissertationen des ehemaligen Bundesverteidigungsministers zu Guttenberg (Rechtswissenschaften; der Fall spielte 2011) sowie der ehemaligen Bundeswissenschaftsministerin Schavan (Erziehungswissenschaften; der Fall spielte hauptsächlich 2012–2013 und ist derzeit noch nicht abgeschlossen) erwähnt werden. Im Grunde kann kein Bereich der Wissenschaft für sich beanspruchen, gänzlich frei von Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens zu sein.