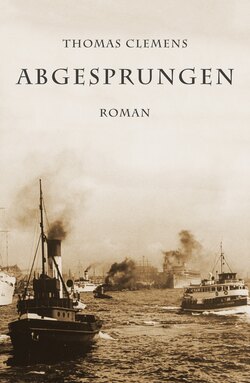Читать книгу Abgesprungen - Thomas Schaefer Clemens - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNew York, Pier 86, 30. August 1939, 01:53 Uhr, nachts
Johannes Seibel taucht prustend auf und schnappt nach Luft, schmeckt ölig modriges Hafenwasser. Hinter ihm befindet sich der schwarze Schiffsrumpf der sich hier zur Wasserlinie hin stark verjüngt. Daher kann man ihn vom C-Deck aus nicht sehen. Irgendwo unter ihm befinden sich die gewaltigen Schrauben der Bremen. Er sieht sich nach seinem Segeltuchpäckchen um. Es ist doch nicht etwa untergegangen? Es ist zu dunkel, um auf der Wasseroberfläche etwas zu erkennen. Dann hört er Rufe. Ob jemand Hilfe brauche. „Da ist nix, Hein!“ „Wenn ich‘s dir doch sage, das hat ordentlich geplatscht, als ob was Großes ins Wasser gefallen ist.“ „Vielleicht ‘n dicker Fisch?“ „Tüünkram, hab’s doch genau gehört.“ Der Lichtkegel einer starken Handlampe streicht über das Wasser. „Kiek mol, wat schwimmt denn da?“ Der Lichtschein hat das Segeltuchpäckchen erfasst, welches fast unter Wasser dahindümpelt. „Dat ist nix, jedenfalls kein Mensch.“ „Wenn du meinst?“ Der Schein der Lampe streicht noch ein paarmal über die ruhige Wasserfläche, bevor er erlischt. Johannes Seibel wartet noch zwei Minuten. Als alles ruhig bleibt, schwimmt er aus der Deckung des Achterstevens hervor. Er findet sein Segeltuchpäckchen, das beinahe untergegangen ist und schwimmt auf die Pier zu. Es ist unglaublich anstrengend in der vollgesogenen Kleidung zu schwimmen. Auch das Päckchen welches er vor sich herschiebt hat keinen Auftrieb mehr. Das heißt, dass er keine trockene Ersatzkleidung hat. Kurz darauf erreicht er die stählerne Leiter, steigt erschöpft an Land und versteckt sich hinter einem Stapel Holzkisten. Er öffnet sein Päckchen, natürlich ist nichts trocken geblieben. Der Plan wäre gewesen, sich trockene Kleidung anzuziehen und unbemerkt aus dem Hafengebiet zu verschwinden, über die breite Westside Street in den Straßenschluchten abtauchen. Drüben auf der Lower-East Side, wo viele deutsche Auswanderer leben, Arbeit suchen. Irgendetwas und sei es noch so niedere Arbeit würde er schon finden. Bis dahin durfte er sich nicht von der Zollbehörde oder der Polizei erwischen lassen. Wenn die Bremen erst abgelegt hat, kann man ihn nicht mehr so einfach ausweisen und nach Deutschland zurückschicken, glaubt er und will sich auf den Weg machen.
„Stop!“, ruft jemand. Grelles Licht blendet ihm direkt ins Gesicht. Jemand packt ihn und biegt ihm unsanft den Arm auf den Rücken. Er wird gegen die Mauer gedrückt und durchsucht. Was, zur Hölle, er hier zu schaffen habe, fragt jemand in militärisch barschem Ton und starkem New Yorker Akzent. Johannes erklärt auf Englisch, wobei er versucht seiner Aussprache eine amerikanische Sprachfärbung zu verleihen, dass er ein paar Gläser über den Durst getrunken, sich verlaufen habe und in den verdammten Hudson gefallen sei, und ob sie wüssten, wo er seine Sachen trocknen kann. „In der Zelle vom Polizeirevier in der 11th Avenue!“, klärt der Wachmann ihn auf. Er fragt noch, ob er von dem deutschen Dampfer sei. Nein, er sei Amerikaner, habe aber keine Wohnung in New York. „Soso, keine Wohnung!“, kommentiert der Mann und führt ihn ab.
Auf dem Polizeirevier nimmt man ihm das Päckchen mit seiner Ersatzkleidung und das Bündel, welches er unter seiner Jacke verborgen hat, ab. Darin befinden sich 30 Reichsmark überwiegend in Münzen und 40 Dollar überwiegend in Eindollarnoten, Trinkgeld, das er von amerikanischen Passagieren auf der Bremen erhalten hatte, sowie sein deutscher Reisepass, zwei Fotographien und seine kostbare Uhr, ein Geschenk von Uhrmacher Weintraub. Jedoch gibt es nichts, was ihn als Besatzungsmitglied des Schnelldampfers Bremen ausweist.
„Die Tagschicht wird sich um dich kümmern“, teilt der Polizist ihm mit, bevor die vergitterte Tür ins Schloss fällt. Eine leichte Panik befällt ihn, wieder eingesperrt zu sein. Er ist heilfroh, dass Licht brennt und er nicht allein in der Zelle ist. Zwei weitere Gefangene sind dort. Einer liegt auf der einzigen Pritsche und schnarcht, der andere sitzt auf dem Boden und lehnt mit dem Rücken an die dreckige Mauer. Es riecht nach Alkohol und Urin. „Eh, Mann, warum bist ‘n so nass?“ „Bin in ‘n verschissenen Hudson gefallen, paar Whiskey zu viel, Mann!“, antwortet er im gleichen Jargon. „Verdammt, warum machst ‘n das?“ „Ist halt passiert, dann haben mich die Wachmänner gegriffen.“ „Das ist echt Pech, Mann, aber morgen biste bestimmt wieder draußen!“ Johannes zieht seine Kleidung bis auf die Unterhose aus und wringt die nassen Kleidungsstücke über dem Toiletteneimer aus. Dann breitet er sie auf dem Boden aus. Der Anzug dürfte komplett ruiniert sein, aber was hatte er erwartet. Resigniert setzt er sich auf den Betonboden, lehnt sich ebenfalls an die Zellenwand und hüllt sich in eine muffige Decke, welche man ihm gegeben hatte. Ihm ist trotzdem verdammt kalt. „Meine erste Nacht in Amerika, Herzlichen Glückwunsch, Johannes“, murmelt er auf Deutsch. „Was haste gesagt?“ „Nix, bin müde.“
Eingeschlafen ist Johannes Seibel erst in den frühen Morgenstunden. Als er schließlich von einem baumlangen Police-Officer unwirsch geweckt wird, braucht er ein paar Sekunden, um zu realisieren, wo er sich befindet. Er überlegt immer noch, welche Lügengeschichte er der Polizei auftischen soll, damit man ihn, um Gottes Willen, nicht gleich auf die Bremen zurückbringt. Im Laufe des Tages würde sie New York mit Sicherheit verlassen. Er könnte sagen, dass er schon ein paar Wochen illegal in New York sei und nicht nach Deutschland zurück könne. Keine gute Idee, entscheidet er. Was sollte sie dann davon abhalten, ihn sofort auf das Schiff zu bringen. Er könnte sagen, dass er Jude sei und von der Hitler-Diktatur verfolgt werde und um Asyl bitten - nein, sie würden ihn entlarven. Außerdem haben Juden aus Deutschland ein großes J in ihrem Reisepass. Inzwischen hat er sich angezogen und lässt sich von dem Polizisten in die Wachstube bringen, wo man ihn auf einem Stuhl vor einem schäbigen Schreibtisch platziert. Man befiehlt ihm, auf den Vernehmungsbeamten zu warten.
Die Uhr über dem Schreibtisch zeigt bereits 9:35 Uhr. Seit eineinhalb Stunden setzt die Zollbehörde die Durchsuchung der Bremen fort. Sein Verschwinden wurde sicherlich schon bemerkt. Schließlich nimmt ein Beamter in zivil hinter dem Schreibtisch Platz und blättert in seinem feuchten Reisepass. „So, Mister Johannes Seibel aus Hamburg, Deutsches Reich, jetzt erklären Sie mir, was Sie mitten in der Nacht an der Pier 86 zu suchen hatten?“ „Ich bin von einem deutschen Schiff ins Wasser gesprungen und ans Ufer geschwommen.“ „Von der Bremen?“ Johannes nickt. „Warum zur Hölle?“ „Ich kann nicht zurück nach Deutschland, sie werden mich einsperren und foltern“, beteuert er. „Sind Sie Jude, Kommunist oder Krimineller?“ Bemerkenswerte Reihenfolge, Jude – Kommunist – Krimineller, sinniert Johannes. „Nein, ich bin Demokrat und möchte Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika werden.“ Der Beamte sieht ihn misstrauisch an. „Da Sie nachts von einem deutschen Schiff springen, muss ich wohl annehmen, dass Sie dort etwas Kriminelles getan haben“, mutmaßt sein Gegenüber. „Ganz bestimmt nicht, Sir! Ich hatte keine Möglichkeit das Schiff anders zu verlassen.“ „Weshalb rechnen Sie in Ihrem Heimatland mit Folter und Gefängnis?“, bohrt der Vernehmungsbeamte weiter. „Ich bin bekennender Demokrat. In Europa herrscht höchste Kriegsgefahr und ich möchte nicht gezwungen werden, auf der falschen Seite zu kämpfen, wenn Sie verstehen, was ich meine, Sir!“, versucht er es erneut. Der Miene des Beamten ist nicht zu entnehmen, ob er versteht, was Johannes meint. „Soso, und da springen Sie einfach in den Hudson und verstoßen gegen die Einreisebestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika?“ „Um aus Deutschland heraus zu kommen, riskiert man so etwas.“ „Nun, Mister Seibel, hier müssen Sie dafür möglicherweise ins Gefängnis.“ Johannes wirkt erschrocken. „Ich hoffe nicht, Sir, wenngleich ich ein Gefängnis in den Vereinigten Staaten von Amerika dem in Deutschland in jedem Falle vorziehe.“ Der Beamte zieht die Augenbrauen hoch, macht eine lange nachdenkliche Pause. „Sie sprechen hervorragend Englisch, Mister Seibel.“ „Danke, Officer.“ „Detective!“, verbessert sein Gegenüber. „Entschuldigung, Detective, Sir!“ „Von wo in Deutschland stammen Sie?“ „Ich bin aus Hamburg, Sir.“ „Meine Großeltern stammen aus Stettin“, bemerkt der Detective nachdenklich. „Allerdings sind sie nicht über Bord gesprungen, sondern ordentlich eingewandert.“ Eine weitere Pause. „Warten Sie hier!“, befiehlt der Beamte schließlich und verschwindet in einem der verglasten Büros.
9:55 Uhr, die Zeit kriecht dahin. Trotzdem spürt er einen Hauch Optimismus, wie sich das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden beginnt. Der Detective kommt zurück. Seinem Gesichtsausdruck ist nicht anzumerken, ob er etwas Gutes oder Schlechtes zu verkünden hat. „Was meinen Sie, wann die Bremen New York verlassen wird?“, fragt er leise in vertraulichem Tonfall. „Vermutlich noch heute, sobald die Zollbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika ihre Untersuchungen beendet hat, Sir.“ „Aha!“ Nachdenkliches Schweigen. „Und Sie sind ein Gegner Hitlers und wollen auf keinen Fall zurück auf das Schiff.“ „Richtig, Sir, auf keinen Fall!“ Der Detective sieht ihn streng an, scheint mit sich zu ringen. Johannes versucht sich nicht anmerken zu lassen, dass sein Herz wie rasend schlägt. Schließlich erhebt sich der Beamte und winkt einen Uniformierten heran. „Officer, bringen Sie diesen unverschämten Kerl zurück in seine Zelle und lassen Sie ihn frühestens morgen wieder heraus!“
Acht Stunden später gleitet der Schnelldampfer Bremen langsam in die Flussmitte des Hudson. Fast die komplette Mannschaft ist an Deck angetreten. Das Bordorchester spielt die deutsche Nationalhymne. Die Mannschaft singt den Text mit und hat den rechten Arm stramm zum Himmel gestreckt. Die Passagiere der Normandie stehen an Deck und winken herüber. Der französische Atlantikliner dippt die Flagge zum Abschied.
Als man Johannes Seibel am nächsten Vormittag freilässt, händigt man ihm sein immer noch feuchtes Segeltuchpäckchen, sein Geld und seinen Pass aus und teilt ihm mit, dass er fünf Dollar Strafe bezahlen muss für seine nächtlichen Eskapaden im Hafen, sowie für Kost und Logis bei Uncle Sam. Er zahlt und erhält eine Quittung. Außerdem werde man ihn umgehend der zentralen Einwanderungsbehörde zuführen. Zwanzig Minuten später sitzt er mit zwei Männern und einer Frau hinten in einem Lastwagen der Polizei. Auch diese Situation weckt düstere Erinnerungen bei ihm. Stundenlang verhört man ihn darüber, ob er womöglich ein deutscher Spion sei, bis es ihm gelingt die Befürchtungen der Einwanderungsbehörde zu zerstreuen. Nach der obligatorischen ärztlichen Untersuchung erhält er schließlich ein Gesundheitszeugnis und ein Formular mit einem Dienstsiegel, Status: bis auf weiteres geduldeter Immigrant ohne Arbeitserlaubnis. Man kassiert 25 Cent für die ärztliche Untersuchung und teilt ihm mit, dass er das Stadtgebiet von New York nicht verlassen darf, sich wöchentlich bei der Behörde zu melden habe und sich am besten an eine der deutschen Kirchengemeinden wenden soll. Dann ist er entlassen und tritt hinaus in den sonnigen New Yorker Septembernachmittag. Johannes kann sein Glück kaum fassen, ausgerechnet an einen Detective geraten zu sein, der sich seiner deutschen Wurzeln erinnerte und so etwas wie ein Gewissen hat. Er versucht sich zu orientieren und macht sich auf den Weg.
Nach der zweiten Nacht in einer erbärmlichen verlausten Massenunterkunft, wo es schlimmer als in jener Gefängniszelle war, ist Johannes Seibel erneut auf Arbeitssuche. In den belebten Straßen Manhattans machen die Zeitungsjungen, welche lautstark die letzten Neuigkeiten ausrufen, heute besonders gute Geschäfte: „Extrablatt! Extrablatt! Krieg in Europa! Hitlers Truppen marschieren in Polen ein! England und Frankreich stellen Ultimatum!“ hört man sie überall rufen. Johannes kauft den Herald Tribune. Der Funke am Pulverfass soll von Polen provozierte Grenzzwischenfälle gewesen sein, woraufhin die deutsche Wehrmacht nur wenige Stunden später am Morgen des 1. September mit hunderttausenden Soldaten die polnische Grenze auf breiter Front überrennt, ist dort mit zweifelndem Unterton zu lesen. Erst heute hatten die Briten und Franzosen dem Deutschen Reich ein Ultimatum gestellt, sich umgehend aus Polen zurückzuziehen, andernfalls kriegerische Handlungen gegen Deutschland einzuleiten. Niemals würde Hitler nachgeben, auch wenn Deutschland wieder einen Zweifrontenkrieg führen muss, denkt Johannes. Dass Frankreich und England sofort entschlossen angriffen, während die deutsche Wehrmacht noch in Polen beschäftigt war, und Hitler schnell besiegen würden, scheint niemand zu glauben. Zuhause ist Krieg! Er denkt an seine Familie in Hamburg und an Rebecca und ihre Mutter, die gottseidank in Sicherheit waren. Die beiden Fotographien in seiner Brieftasche hatten die Feuchtigkeit einigermaßen überstanden. Die erste Fotographie zeigt seine Familie, Mutter, Vater, seine beiden Schwestern und ihn selbst, die andere zeigt Rebecca und ihn am Ufer der Alster. Wie ein heimtückisches Gift sickern immer wieder Zweifel in seine Gedanken, sie alle zurückgelassen zu haben. Hatte er eine bessere Wahl? Was könnte er tun, dass Rebecca und ihre Mutter auch hierher kommen können? Ob die Normandie noch im Hafen liegt und nach Frankreich ausläuft? Es spielt keine Rolle, er hat nicht annähernd genug Geld für die Überfahrt und wenn Frankreich Deutschland den Krieg erklärt, werden sie ihn wohl kaum auf das Schiff lassen, denkt er verdrossen.