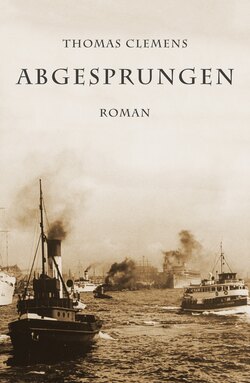Читать книгу Abgesprungen - Thomas Schaefer Clemens - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHamburg, Mai 1927
Johannes wartet ungeduldig vor dem riesigen neuen Klinkerbau an der Hochbahnstation Hoheluftbrücke. Er versteckt sich hinter einer Litfaßsäule, damit ihn bloß keiner von seinen Schulkameraden oder womöglich ein Lehrer entdeckt. Seinen Schulranzen hat er zwar dabei, allerdings wird er heute ausnahmsweise die Schule schwänzen. Und das Beste ist: Opa ist sein Komplize. „Kein Wort zu Niemandem!“, hatte der ihm gestern Abend noch verschwörerisch zugeraunt. Heute gibt es auf der Werft Blohm & Voss einen besonderen Stapellauf zu sehen. Die Cap Arcona, der größte Dampfer der Hamburg-Süd Reederei, soll dem nassen Element übergeben werden. Opa ist der Meinung, dass es an solchen Tagen ohnehin per Regierungserlass schulfrei geben sollte, außerdem ist sein Enkel ein ziemlich guter Schüler. Also hatte Opa seine Beziehungen zu seinem früheren Arbeitgeber, der HAPAG Reederei, spielen lassen, und zwei der begehrten Plätze auf der reedereieigenen Barkasse ergattert. So konnte man den Stapellauf aus nächster Nähe erleben. Johannes weiß aus Opas Erzählungen, dass es vor dem großem Krieg noch viel größere Dampfer gegeben hat, welche man jedoch an den Feind abliefern musste – ein Jammer! Der riesige Imperator, ein gigantisches Schiff und die noch größere Vaterland – alles weg! Der alte Ballin hatte Gift genommen damals, weil er den Verlust seiner stolzen Flotte nicht ertragen konnte. Der Riesendampfer Imperator habe an der Bugspitze eine Weltkugel gehabt, auf der habe gestanden: Mein Feld ist die Welt! Der Leitspruch der HAPAG, welchen Opa oft zitiert.
Endlich biegt Opas grüner Opel um die Ecke. Schnell steigt er in das Automobil und duckt sich ein wenig, weil gerade zwei seiner Klassenkameraden vorbeikommen. Wenn er nicht gerade die Schule schwänzen würde, wäre er stolz gewesen, wenn sie ihn in dem Auto gesehen hätten. Opa gibt Gas, der Wagen, offizielle Bezeichnung Opel 4/12PS, im Volksmund Opel Laubfrosch genannt, beschleunigt. Opel Laubfrosch, weil das Auto relativ klein ist und von der Firma Opel in ungewöhnlichem grün ausgeliefert wurde, wo Automobile doch eigentlich schwarz lackiert waren. Aber immer noch besser als der alberne, im Volksmund nur Kommissbrot genannte, Hanomag vom Hauswart Pagel aus dem Hochparterre von Opas Wohnblock am Kaiser-Friedrich Ufer.
Opa rast mit fast 60 Stundenkilometern die Grindelallee herunter, wie Rudolf Caracciola in seinem Mercedes-Kompressor auf dem Berliner Avus – knorke! Durch das zarte Grün der Kastanienbäume scheint die Morgensonne. „Unser Feld …?“ ruft Opa. „Ist die Welt!“, ergänzt Johannes. Ein Ritual zwischen den beiden. „Trotzdem, zu keinem ein Wort, verstanden? Deine Mutter reißt mir den Kopf ab, wenn das rauskommt!“, ermahnt Opa ihn ein weiteres Mal, während er in die Dammtorstraße einbiegt und kurz vor dem Stephansplatz rasant eine Straßenbahn überholt. Johannes fühlt sich wie in einer Gangstergeschichte. Zehn Minuten später erreichen sie die Landungsbrücken, wo schon Dutzende Barkassen und Hafendampfer mit qualmenden Schornsteinen bereitliegen. Eine große Menschenmenge drängt von den Pontons auf die Schiffe. Opa und Johannes müssen einen Augenblick suchen, bevor sie die richtige Barkasse finden. „Man tau, Wilhelm, geiht los!“, mahnt der Barkassenführer. Endlich sind sie an Bord. Opa wird freudig von einigen Pensionären der Reederei begrüßt. Johannes darf oben beim Schiffsführer stehen.
Wenig später liegen sie mit zahlreichen anderen Schiffen voller Schaulustiger an Bord in gebührendem Abstand vor den Helgen der Werft. Von dort weht Marschmusik herüber. Der riesige Schiffsrumpf ragt empor, dahinter die gigantischen Helgenkrane. Gebanntes Warten. Johannes wagt nicht den Blick abzuwenden, um bloß keinen Augenblick des großen Ereignisses zu verpassen. Dann endlich scheint der Koloss sich zu bewegen, wird immer schneller und gleitet mit einer mächtigen Bugwelle ins Wasser. Vielstimmiges Dampfertuten begleitet den Stapellauf. Johannes darf die Dampfpfeife der Barkasse betätigen. Die Männer stoßen mit Bierflaschen an, auch wenn gerade das Flaggschiff der Konkurrenz vom Stapel lief. Opa reicht Johannes eine Fassbrause. „Unser Feld ist die Welt!“, ruft er ihm begeistert zu. Sie schauen noch eine Zeit lang zu, wie mehrere Schlepper die Cap Arcona an den Ausrüstungskai bugsieren, bevor die Barkasse sie zurück zu den Landungsbrücken bringt. Opa und Johannes essen dort ein Rundstück mit rotem Heringssalat. Dann zupft Opa Johannes Jacke zurecht. „Anständige Kledage ist die halbe Miete, mien Jung“, ein weiteres Lebensmotto von Wilhelm Maltus. „Opa muss nun los. Du darfst heute ausnahmsweise mal trödeln, bis die Schule aus ist. Wir sehen uns nachher im Hotel.“ Er zwinkert seinem Enkel zu und steigt in sein Automobil.
Johannes schlendert an den Vorsetzen entlang. An den Dalben liegen mehrere große Dampfer. Ganz vorn an der Überseebrücke die etwas betagte aber sehr elegante Cap Polonio mit ihren drei hohen Schornsteinen, dahinter der brandneue HAPAG Dampfer New York, ein Stückchen weiter zwei weiße Afrikadampfer der Woermann Linie mit ihren bunten Schornsteinen. Ein imposanter Anblick. Johannes ist begeistert. Er erkennt die meisten großen Passagierdampfer schon von weitem, kann Schiffsnamen, Reederei und Tonnage der Schiffe auswendig aufsagen. Er überquert die Niederbaumbrücke und erreicht die Kehrwiederspitze. Von dort hat er einen guten Blick auf den Uhrenturm am Kaiserhöft. Auf dessen Spitze befindet sich ein Zeitball. Jeden Tag um Punkt zwölf Uhr mittags wird der Ball fallen gelassen, damit die Seeleute ihre Schiffschronometer synchronisieren können. Uhrmacher Weintraub hatte einmal erklärt, wie so eine Schiffsuhr funktionierte, aber Johannes hatte nicht alles verstanden, außerdem erhielten die meisten Schiffe das genaue Zeitsignal inzwischen per Funk, hatte Opa erklärt. Johannes wartet einige Minuten bis er den Zeitball fallen sieht. Bei den Werften heulen Sirenen zur Mittagspause. Johannes blickt sich noch einmal um. Er kann sich kaum von der imposanten Hafenszenerie losreißen, aber schließlich ist es Zeit, wie jeden Tag nach der Schule in Papas Hotel zu Mittag zu essen und anschließend unter Wilhelmines Aufsicht seine Hausaufgaben zu erledigen. Danach muss er meistens im Hotel helfen.
Bald darauf überquert er den Rödingsmarkt und erreicht den Großen Burstah. Dort stauen sich wie üblich Fuhrwerke, Automobile, Kraftdroschken und Straßenbahnen. Opas Opel parkt direkt vor dem Hotel hinter einem riesigen Horch, der wohl einem der Gäste gehört. Über dem Eingangsportal thront ein eleganter weinroter Baldachin mit goldenem Schriftzug – Hotel Seibel. Im großzügigen Foyer weist ein roter Teppich direkt auf den Rezeptionstresen aus dunklem Mahagoni, wo Mama in ihrem hübschen Kleid die Gäste empfängt. Das Geschäft brummt. Alle 24 Zimmer sind vermietet. Nach rechts geht es zum Restaurant. Dort herrscht um diese Zeit Hochbetrieb. Viele Mittagsgäste, Beamte und Angestellte aus dem nahen Rathaus, den Banken und Kontorhäusern, schätzen die reichhaltigen, schmackhaften Gerichte im Restaurant des Hotel Seibel. Einige der Stammgäste kennt Johannes schon. Die drei lustigen Herren, die immer am Ecktisch zu Mittag essen, sind noch dort. Als sie Johannes erblicken, rufen sie ihn an ihren Tisch. „Na, mien Jung, kannste noch jonglieren?“ „Klar!“, antwortet er. Darauf hat er nur gewartet. Schnell holt er seine Bälle, läuft zurück an den Tisch und zeigt was er kann. Jonglieren mit drei Bällen hatte er sich selbst beigebracht und es war ihm leicht gefallen. Der eigentliche Trick ist, hatte er schnell herausgefunden, nicht zu versuchen einen einzelnen Ball im Blick zu behalten, sondern einfach konzentriert im konstanten Rhythmus mit eher unscharfem Blick aber hoher Konzentration die Bälle zu werfen. Inzwischen übt er mit vier Bällen, aber es den Gästen vorzuführen wagt er nicht, bevor er es richtig beherrscht. Die Herren klatschen Beifall. Sie stecken ihm ein paar Pfennige zu, auf Dauer ein einträgliches Geschäft für Johannes. Im Foyer trifft er Wilhelmine. „Haste wieder den Pausenclown gemacht?“, neckt sie ihn. Wilhelmine ist sechszehn und besucht die Hotelfachschule. „In der Küche steht dein Essen“, teilt sie ihm mit und wuschelt ihm durchs Haar, was Johannes nicht mag. Sonst versteht er sich mit seiner ältesten Schwester sehr gut. Wilhelmine ist eine plietsche Deern, meint Opa. Auguste hingegen ist mitten im schlimmsten Backfischalter, hatte er neulich aufgeschnappt, als die Erwachsenen sich nach dem Essen unterhielten. Mit Auguste hat er öfter Streit. Zuhause tritt sie mit Absicht auf die Schienen seiner Märklin Bahn und lässt ihre Sachen überall liegen. Weil sie in der Schule nicht fleißig war, arbeitet sie nun in der Hotelküche. Allerdings hatte sie sich in den letzten Monaten zu einem ziemlich hübschen Ding entwickelt und begonnen damit zu kokettieren. Die rothaarige, etwas pummelige Wilhelmine, und auch das hatte Johannes von den Erwachsenen aufgeschnappt, ist eher zu den Mauerblümchen zu zählen. Was damit gemeint war, weiß er schon. Er findet es nicht nett von seinen Eltern, so über Wilhelmine zu reden.
Paul Seibel, ganz Hoteldirektor im eleganten Stresemann mit Weste, goldener Uhrkette und Weltkriegsorden am Revers bespricht sich mit zwei Männern in Zimmermannskluft. Sie begutachten das Treppenhaus des Hotels. Einer der Handwerker führt Messungen mit seinem Zollstock durch und trägt Maße in sein Notizbuch ein. Das Hotel soll einen Fahrstuhl für die Gäste bekommen. „Das wird bannig aufwändig, Herr Seibel. Wee möten ‘ne Menge Stahlträgers intrecken und auf ‘n Dachboden ‘n Fundament für den Maschinenraum gießen“, erklärt der Handwerker. „Weil das Treppenhaus dann enger wird, muss auf der Gebäuderückseite eine Treppe aus Eisen hin. Feuerpolizeilich vorgeschrieben!“ ergänzt der andere. „Gut, wie lange benötigen Sie für den kompletten Umbau?“, fragt Seibel und bietet den Männern Manoli Zigaretten an. Die leere, kunstvoll kolorierte Manolipackung, ein begehrtes Sammelobjekt seines Sohnes, drückt er achtlos zusammen und wirft sie in einen Papierkorb. „Bummelig, acht bis zehn Wochen, wenn allens glatt geiht, Herr Seibel.“ „Dann kalkulieren Sie mal alles durch und schicken mir einen Kostenvoranschlag!“ „Mookt wi, Herr Seibel! Die Herren verabschieden sich mit Handschlag. Paul Seibel zündet sich eine dicke Zigarre an und blickt nachdenklich nach oben, als er die Stimme seines Sohnes hört. „Kriegen wir einen Fahrstuhl, Papa?“ „Hast du etwa gelauscht?“ „Nein Papa, ich kam gerade hier vorbei, soll die Sachen nach oben bringen.“ Er trägt einen Stapel Handtücher. „Ja, wir bauen einen Fahrstuhl für die Gäste ein“, antwortet er. „Kann ich dann Liftboy werden?“ Papa blickt ihn streng an. „Mal sehen, jetzt bring erstmal die Tücher nach oben!“ Johannes steigt die Treppe hoch. Er hatte in Mamas Illustrierter gesehen, wie in einem vornehmen Hotel in Amerika die Fahrstühle von Jungen in schicker Uniform bedient werden. Da gibt es bestimmt eine Menge Trinkgeld zu verdienen.
Wenn er nur das angrenzende Gebäude in seinen Besitz bringen könnte, denkt Paul Seibel. Dort befinden sich ein Lederwarengeschäft im Erdgeschoss und eine Werkstatt, Büros und Wohnungen in den oberen Stockwerken. Er könnte das Restaurant fast auf das Doppelte vergrößern, zwölf weitere Gästezimmer und eine geräumige Wohnung für seine Familie einbauen. Dann könnte man die Wohnung im Stadtteil Hoheluft aufgeben und hier einziehen. Aber jetzt, wo die Krise vorbei ist, würde niemand eine solche Immobilie hergeben. Außer? Ihm muss etwas einfallen, überlegt er.
Als Johannes die Treppe herunter kommt, sieht er seinen Vater ruhelos vor den Treppen auf und ab gehen, mit grimmiger Miene. Warum ist er nur so streng und sagt nie etwas Nettes zu ihm oder lobt ihn für seinen Fleiß? Nun ja, heute, wo er die Schule geschwänzt hatte, hat er sicher kein Lob verdient, aber sonst?
Die Schulwege von Johannes und Rebecca kreuzen sich an einer Stelle. Manchmal treffen sie sich dort, gehen ein kurzes Stück gemeinsam und reden miteinander, fast immer über die Schule. Ob er bald mal wieder mit seinem Opa vorbeikäme, sie könnte ihm etwas auf dem Klavier vorspielen, schlägt sie ihm an einem regnerischen Hamburger Sommertag vor. Gern, er wolle seinen Opa darauf ansprechen. Gelegentlich nimmt Opa ihn mit zu den Weintraubs, was er seinen Eltern nicht erzählen soll.
Der Uhrmacher winkt Johannes und Opa Maltus in seine Werkstatt als die beiden einige Tage später dort auftauchen. Eine komplizierte Taschenuhr ist in die Halterung der Werkbank eingespannt. Der Deckel ist geöffnet, sodass man das filigrane Uhrwerk betrachten kann. „Seht mal her, eine kostbare Breguet, über 120 Jahre alt, mit mehreren Komplikationen. Sowas bekommt man nicht mehr oft zur Reparatur. Das war noch Wertarbeit. Sogar Napoleon hat eine Breguet besessen. Er erklärt andächtig die filigrane Mechanik. „Zeig mal deine Hände, Johannes! Hmm, schmale Uhrmacherhände sind das nicht gerade. Vielleicht biste trotzdem geschickt genug. Nimm mal die Feder dort mit der Pinzette auf und reich sie mir, aber ganz vorsichtig.“ Johannes kommt seiner Aufforderung nach. Es gelingt ihm auf Anhieb. „Siehste, wirste mal Uhrmacher“, lobt Weintraub. „Oder Klavierspieler“, wirft Frau Weintraub ein, die gerade die Treppe heruntergekommen ist. „Hast Massel, mein Junge, habe ich doch gerade heiße Schokolade gemacht!“ Sie lächelt gütig. Johannes und Frau Weintraub steigen die Treppe hinauf. Am Esstisch in der guten Stube sitzt Rebecca bereits vor einer dampfenden Tasse und ihren Notenblättern. „Pass auf, Kind, dass du mir bloß keine Schokoladenflecken auf die Noten machst!“, ermahnt Frau Weintraub ihre Tochter.
Rebecca spielt, etwas holprig zwar, ein temperamentvolles Klavierstück. Frau Weintraub nimmt Johannes Hand und wiegt sich mit ihm zu einem Tanz, was ihm ein bisschen peinlich ist. „Das Stück heißt Hava Nagila und ist ein altes hebräisches Volkslied. Hava Nagila heißt: Lasst uns glücklich sein“, erklärt sie. Dann setzt Frau Weintraub sich selbst ans Instrument und spielt gekonnt ein beeindruckendes Stück. „Das ist von Brahms, er hieß übrigens Johannes mit Vornamen und wurde hier in Hamburg geboren.“ Sie lächelt ihn freundlich an. „Ungarische Tänze, wird eigentlich vierhändig gespielt.“ „Das klingt wirklich großartig, Frau Weintraub“, lobt Johannes. An Rebecca gerichtet ergänzt er eilig: „Und du kannst es auch schon so gut.“ Rebecca strahlt. „Willst du es lernen? Ich erteile dir gern ein paar Unterrichtsstunden“, bietet Frau Weintraub an. Johannes zögert. „Komm setz dich hier her. Sie lässt ihn einige Tonleitern spielen. „Du hast wirklich geschickte Hände“, stellt sie fest.
Einige Monate später spielt Johannes in Weintraubs guter Stube bereits halbwegs passabel einfache Stücke. Mama und Papa wissen nichts von seinen heimlichen Klavierstunden bei Frau Weintraub, weil Papa die Weintraubs nicht mag, auch Auguste nicht, die würde petzen, weil sie Rebecca nicht leiden kann. Nur Wilhelmine und Opa wissen Bescheid. Johannes vermutet, dass Opa die Klavierstunden bezahlt, er weiß es aber nicht genau. „Wechselst du im nächsten Jahr auf eine höhere Schule?“, fragt Rebecca. „Ja, wenn ich die Aufnahmeprüfung schaffe, auf die Oberrealschule an der Bogenstraße, sind ja nur zehn Minuten von zu Hause.“ Sie nickt zufrieden.
Johannes und sein Schulfreund Kurt Krahn klettern aus Opas Automobil. Die beiden Jungen hatten sich zu zweit auf den Beifahrersitz gequetscht, der Opel ist ja nur ein Zweisitzer. „Opa, beeil dich, das Spiel geht gleich los, ruft Johannes. „Man sinnig, `n oller Mann ist kein D-Zug“, keucht Opa. Sie parken in der Nähe des Altonaer Stadions, wo heute das Endspiel zur Deutschen Fußballmeisterschaft 1928 stattfindet: Hamburger Sportverein gegen Hertha BSC Berlin. Spät aber rechtzeitig drängen sie sich in das mit 50.000 Menschen rappelvolle Stadion. Kurz darauf ist Anpfiff und schon nach fünf Spielminuten schießt Otto Harder, von den Anhängern des HSV nur Tull genannt, seine Mannschaft in Führung. Das Publikum jubelt begeistert. „Jawoll Tull! Weiter so!“, ruft Opa. „Wär doch gelacht, wenn wir Hertha nicht ein zweites Mal die Meisterschaft abjagen.“ Johannes und Kurt müssen sich auf die Zehenspitzen stellen, um etwas zu sehen. Gerade hatte der Hamburger Torwart Wilhelm Blunk einen Kopfball von Willi Kirsei abgewehrt. „Das war knapp!“, kommentiert Johannes. Noch in der ersten Halbzeit geht der HSV mit 3:00 in Führung. Nach der Pause, schießen die Hamburger zwei weitere Tore. Die Stimmung im Stadion kocht. Der Meistertitel scheint gesichert. „Das holen die Berliner niemals wieder auf!“, ruft Opa begeistert. Schade, dass Papa nicht dabei ist, denkt Johannes, immer hat er nur Zeit für sein Hotel. Am Ende steht es 5:2 für den HSV, der Jubel ist groß. „Darauf müssen wir noch was trinken gehen“, schlägt Opa vor, als sie in seinen Opel Laubfrosch steigen. „Alster oder Elbe?“, fragt er gleich darauf. „Elbe! Zum Hafen!“, rufen die beiden.
Später als sie auf der Dachterrasse vom Fährhaus Sankt Pauli vor ihren Gläsern sitzen und den grandiosen Blick über den Hafen genießen, reden sie noch eine Zeit lang über das Spiel und wie der HSV Hertha nass gemacht hat. „Wie ist eigentlich das Hamburger Schulturnier in diesem Sommer ausgegangen?“, fragt Opa die beiden Jungen. „Dritter Platz, 3:0 gegen Veddel immerhin, aber Barmbek hat wieder den Pokal geholt.“ Die Fußballrivalität der Hamburger Schulen entspann sich zwischen dem linken und rechten Alsterufer. Und die vom linken Ufer hatten mal wieder gewonnen. „Und hat einer von euch beiden wenigstens ein Tor geschossen?“ „Nee, bin ja nur Außenverteidiger“, erklärt Johannes. Kurt hatte als Mittelstürmer immerhin einmal getroffen. Opa Maltus’ Blick schweift über den Hafen. Unter den Helgenkranen bei Blohm & Voss ragen die Aufbauten eines weiteren Ozeanriesen hervor. „Die Europa! Bald ist Stapellauf. Dass ich das noch erlebe, dass der Norddeutsche Lloyd hier in Hamburg auf der Hauswerft der HAPAG so ein phantastisches Schiff baut“, seufzt Opa. „Das Schwesterschiff, das bauen sie doch in Bremen“, merkt Johannes an. Opa blickt ihn verständnislos an. „Wäre ja noch schöner, hier in Hamburg so ein Schiff ausgerechnet auf den Namen Bremen zu taufen.“ Er schüttelt entrüstet den Kopf. „Jammerschade, bald haben die Bremer die größten und schnellsten Dampfer auf dem Atlantik“, schnauft Opa. Die alte Rivalität zwischen den Hansestädten. Die Schwesterschiffe Europa und Bremen, der zukünftige Stolz der deutschen Hochseeflotte, sollten im nächsten Jahr fertiggestellt werden und ihren wöchentlichen Liniendienst von Bremerhaven nach New York aufnehmen und das blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung für Deutschland gewinnen. Die Dampfturbinen der Europa sollen mehr als 130.000 PS leisten, weiß Johannes. Schön, dass Deutschland nach dem verlorenen Weltkrieg wieder solche Schiffe bauen kann, denkt er. Überhaupt, geht es ihnen ziemlich gut. Er erinnert noch die schlechte Zeit, wenige Jahre zuvor als alles grau und düster war. Inzwischen verdient Papa scheinbar eine Menge Geld mit dem Hotel.
Johannes und sein Freund Kurt trödeln auf dem Heimweg von der Schule, werfen kleine Steine nach den Enten auf dem Isebekkanal. Als sie vor Opas Wohnblock ankommen, hat Hauswart Pagel gerade seinen Hanomag Kommissbrot angeworfen. Der Einzylindermotor auf der Hinterachse versetzt den Wagen in ein rhythmisches Wippen, was charakteristisch für dieses Auto ist und witzig aussieht. „Kiek mol, Pagels Kommissbrot hüppt wedder wie ‘n Karnickel“, amüsiert sich einer der Jungen, die am Straßenrand Murmeln spielen, vorlaut. „Ein Kilo Blech, ein Kilo Lack, fertig ist der Hanomag!“, fügt sein Spielkamerad hinzu. Alle lachen, auch Johannes und Kurt. „Ich werd’ euch Beine machen, verdammte Bengels“, brüllt Pagel und droht mit der Faust. Die Jungen verziehen sich grinsend. Johannes will sich von Kurt verabschieden. „Gehst heute zu deinem Opa?“, fragt Kurt. „Ja.“ „Dann besucht ihr wohl wieder den Uhrmacherjuden, drüben in Klein Jerusalem?“, argwöhnt er. Johannes zögert verunsichert. „Mein Vater sagt, mit Juden lässt man sich nicht ein, außerdem sind sie ‘ne minderwertige Rasse und Schädlinge am Volkskörper“, erklärt Kurt ziemlich laut. „Nee, ich will nur meinen Opa besuchen“, antwortet Johannes und wendet sich ab. „Bist mit der Tochter vom Uhrmacherjuden gesehen worden“, setzt Kurt in einem anklagenden Tonfall nach. „Kenne sie eben“, murmelt Johannes so beiläufig wie möglich und verschwindet schnell im Hauseingang. Er kommt sich ein wenig schäbig vor, Rebecca fast verleugnet zu haben, wo sie ihm doch eine Menge bedeutet. Und was sollte der Unsinn mit der minderwertigen Rasse? Turnlehrer Hackbarth hatte neulich auch so etwas gesagt. Die Weintraubs konnten damit kaum gemeint sein. Sie sind in seinen Augen sehr kultivierte Leute, die gebildeter sind, als die meisten Menschen, die er kennt. Dass er jeden Donnerstagnachmittag bei Frau Weintraub zur Klavierstunde geht, hatte er allerdings niemandem in der Schule erzählt, auch nicht Musiklehrer Wattrich, obwohl ihm seine Klavierkenntnisse sicher eine bessere Note einbringen würden. Aber heute ist Dienstag und da hat er Schwimmunterricht in der Warmbadeanstalt Hohe Weide. Dass ein Mann schwimmen kann, sei wichtig, vielleicht würde er mal zur See fahren oder zur Marine gehen und da sei es nicht empfehlenswert, wenn man Nichtschwimmer sei, hatte Opa argumentiert und sich ausnahmsweise gegen Papa durchgesetzt, der es überflüssig findet, dass ein zukünftiger Hoteldirektor schwimmen kann.
An einem nasskalten Dezembertag peitscht ein ungemütlicher Wind zwischen den Häuserschluchten hindurch, fegt letztes Laub von den Bäumen. Johannes beeilt sich von der Schule nach Hause zu kommen. Inzwischen haben sie eine Wohnung in einem Neubau, einem Wohnblock aus dunklen Klinkern, wie sie überall in den umliegenden Straßen gebaut werden, bezogen. Die neue Wohnung liegt ebenfalls in der Schlankreye und Johannes hat ein eigenes kleines Zimmer für sich. Heute ist wieder Donnerstag und er hat Klavierstunde bei Frau Weintraub. Allerdings ist seine Mutter seit einiger Zeit wieder zuhause in der neuen Wohnung und nicht im Hotel. Papa hatte einen Portier eingestellt und Wilhelmine hilft ebenfalls tüchtig mit, sodass Mama sich mehr um den Haushalt und um Opa kümmern kann, der in diesem Winter besonders schlimm unter seinem Rheuma leidet. Jedenfalls bei dem Schietwetter braucht er eine gute Ausrede, um am Nachmittag nach draußen zu dürfen. Schließlich gelingt es ihm, indem er vorgibt mit einem Schulkameraden dringend für eine Klassenarbeit lernen zu müssen.
Die Klavierstunden sind eigentlich verdammt anstrengend, da er ja zwischendurch nicht üben kann, weil sie zuhause kein Klavier haben. Trotzdem kommt er langsam aber stetig voran. Beim letzten Mal hatte er mit Rebecca vierhändig gespielt. Sie hatten dicht beieinander auf der Klavierbank gesessen und manchmal hatten sich ihre Schultern und Arme berührt. Ein bisher nicht gekanntes Wohlgefühl hatte ihn durchströmt. Aber das hatte sicher nichts zu bedeuten. Dennoch genießt er die Zeit bei den Weintraubs, wenn sie nach der Klavierstunde in der großen Küche mit den zwei Geschirrschränken zusammensitzen und heiße Schokolade trinken.
„Mama hat Sufganiyot gemacht“, eröffnet ihm Rebecca freudestrahlend, als er die Treppe vom Uhrengeschäft hinauf kommt. „Ja, aber die gibt es erst zum Chanukkafest“, erklärt Frau Weintraub mit strenger Stimme. Aus der Küche kommt tatsächlich ein verführerischer Duft nach Gebäck, stellt Johannes fest. „Was ist Sufgani…, wie heißt das nochmal?“, flüstert er Rebecca zu. „Sufganiyot, das sind kleine Teigkugeln mit Marmelade drin, lecker!“, schwärmt sie. „Manche nennen sie auch Ochsenaugen“, ergänzt Frau Weintraub, „aber nun mach dem armen Jungen nicht den Mund wässrig, Rebecca!“, schimpft sie ihre Tochter. Dann lächelt sie milde. „Ausnahmsweise“, flüstert sie verschworen. Sie reicht ihm eine der Teigkugeln. Und als Rebecca sie herzerweichend anblickt, bekommt sie auch eine. „Aber beißt vorsichtig hinein! Die Marmelade ist bestimmt noch sehr heiß und sagt Papa nicht, dass ihr sie heute schon bekommt.“ „Sufganiyot ist übrigens der Plural von Sufganiyah und das ist Hebräisch. Das lerne ich gerade in der Schule“, erklärt sie stolz. „Wann beginnt denn das Chanukkafest?“, fragt er Rebecca. „Morgen“ „Aber, das ist doch so etwas wie Weihnachten und Weihnachten ist erst in drei Wochen“, stellt er fest. „Nein, Chanukka ist unser Tempelfest und hat nichts mit dem Weihnachtsfest zu tun. Das Datum richtet sich nach dem jüdischen Kalender und ist manchmal schon im November in anderen Jahren erst, wenn ihr Christen Weihnachten feiert. Chanukka dauert acht Tage. Jeden Tag zünden wir eine weitere Kerze an.“ Sie weist auf einen achtarmigen Leuchter, den Chanukkia, der im Fenster der guten Stube steht. „Und da esst ihr jeden Tag die leckeren Kugeln?“ Rebecca lacht. „Nein, auch andere Sachen, zum Beispiel Latkes, das sind Kartoffelpuffer und am achten Tag, wenn alle acht Kerzen brennen, gibt es Gänsebraten, dann kommen Freunde und Verwandte zu Besuch und wir spielen Glocke und Hammer.“ „Gibt es auch Geschenke?“ „Ja, die Kinder bekommen Süßigkeiten, aber die meisten Süßigkeiten gewinne ich beim Dreidelspiel mit den anderen Kindern“, verrät sie. „Das Spiel kenne ich nicht“, gibt er zu. „Warte!“ Sie läuft in ihr Zimmer und kommt kurz darauf mit einem hölzernen Spielstein wieder. „Das ist ein Dreidel“, erklärt sie. Es handelt sich um ein vierseitiges Holzklötzchen mit einem eingesteckten Stäbchen, auf dem man den Dreidel wie einen Kreisel drehen kann. Auf den vier Seiten des Dreidels befinden sich hebräische Buchstaben. Der Buchstabe, der oben liegt, wenn der Dreidel ausgetrudelt ist, entscheidet darüber, ob etwas gewonnen oder verloren geht. Rebecca erklärt ihm die einzelnen Spielzüge ausführlich. Er zögert einen Augenblick. „Geht ihr eigentlich oft in eine Synagoge?“ „Eigentlich gehen wir nur an den Feiertagen in die große Synagoge am Bornplatz. Jüdische Feiertage gibt es allerdings eine ganze Menge: Rosch ha Schana, Jom Kippur, Sukkot…“ „Rebecca, verschone den armen Johannes“, spricht ihr Vater, der soeben die gute Stube betreten hat, „sonst will er noch konvertieren und ich weiß nicht, was seine Eltern dazu sagen würden. Außerdem, meine Tochter, hast du noch Marmelade in den Mundwinkeln, von der ich nicht hoffen will, dass sie von einem Sufganiyah stammt.“ Sie wischt sich schnell den Mund und errötet leicht. Aaron Weintraub sieht Johannes nachdenklich an. Dann fragt er, wie es seinem Großvater geht und lässt beste Genesungswünsche ausrichten.
Später als Johannes gegangen ist und Rebecca mit ihren Eltern beim Abendessen sitzt, fragt sie ihren Vater, ob Johannes nicht auch am Sonntag zum Dreidelspielen kommen kann, wenn ihre Tante Judith und Onkel Elias mit Mirjam, Samuel und Levi zu Besuch kommen. „Rebecca, das geht nicht.“ „Papa, bitte!“ „Ich habe nein gesagt!“, macht ihr Vater unmissverständlich klar. Aber seine Tochter gibt noch nicht auf. „Warum denn nicht?“, quengelt sie. „Ich möchte solche Gespräche nicht während des Abendessens, Rebecca, du gehst sofort in dein Zimmer und schämst dich!“ Rebecca verlässt mit hochrotem Kopf den Raum. Aaron Weintraub legt klirrend das Besteck beiseite, als seine Frau beschwichtigend ihre Hand auf seinen Unterarm legt. „War das notwendig?“, fragt sie einfühlsam. „Ja, und ich möchte auch nicht, dass du den Jungen weiterhin im Klavierspielen unterrichtest!“, bestimmt er. „Aber…“ „Nichts aber, wenn seine Eltern erfahren, dass er in einem jüdischen Haus ein- und ausgeht, hätte der Junge sicher nichts zu lachen.“ Aaron Weintraubs Stimme zittert, als er das sagt. Er ist aufgeregt, wie selten. Mila Weintraub weiß natürlich von Wilhelm Maltus, dass Johannes Eltern etwas gegen den Umgang des Jungen mit ihnen haben, aber eine solche Bedeutung hatte sie dieser Abneigung bisher nicht zugemessen. „Dann rede ich mit seiner Mutter, von Frau zu Frau“, sagt sie bestimmt. „Mila! Sei bitte vernünftig. Ich mag den Jungen genau wie du und Rebecca mag ihn auch, umso schlimmer. Aber ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass in dem Hotel von diesem Seibel immer öfter die Nationalen verkehren. Erst waren es wohl nur eine Handvoll Stahlhelmer, offensichtlich alte Kriegskameraden von dem Seibel.
Inzwischen tauchen da auch Leute von dieser Hitler-Partei auf und schwadronieren über eine neue Zeit, die kommen wird.“ „Na und, das ist doch nichts Neues, dass die Nationalen uns nicht wohlgesonnen sind“, beschwichtigt seine Frau. „Nicht wohlgesonnen? Was die Anhänger von diesem Adolf Hitler vorhaben, ist weit schlimmer, als das Bisherige. Sie sitzen dort vor ihren Biergläsern und hetzen gegen uns Juden, geben uns für jegliches Übel in diesem Land die Schuld, verunglimpfen uns, bezeichnen uns als minderwertige Rasse und würden uns am liebsten vom Erdboden tilgen. Und der Seibel duldet diese primitive Horde nicht nur in seinem Restaurant, sondern er hofiert sie auch noch und pflichtet ihnen bei, jawohl!“ Weintraub hat sich weiter in Rage geredet. „Woher willst du das denn so genau wissen?“ Der Jacob Sternreich hat es mit eigenen Ohren gehört, als er dort einkehrte, er hat ja die Lederwarenhandlung neben dem Hotel Seibel. Er sieht die Kerle fast jeden Abend dort hineingehen. Er selbst ist schon von denen angepöbelt worden“, erklärt er niedergeschlagen. Mila streichelt ihm zärtlich über den Arm. „Aaron, mach dich nicht meschugge wegen einer Handvoll Braunhemden. Die haben doch nichts zu melden. Wir haben eine stabile Regierung. Der Hindenburg wird so etwas nicht zulassen und Reichskanzler Hermann Müller steht ebenfalls für eine ganz andere Politik. Deutschland ist dem Völkerbund beigetreten. Die Zeiten haben sich geändert.“ „Dein Wort in Gottes Ohr!“, seufzt Aaron Weintraub wieder etwas beruhigter. Rebecca schließt leise die Tür ihres Zimmers, wirft sich auf ihr Bett und weint vor bitterer Enttäuschung. Sie hatte alles mit angehört.
Am folgenden Donnerstag besucht Johannes seinen Opa. Der sitzt in seinem Sessel und quält sich mit seinem Rheuma, das nicht besser werden will. „Bist du heute gar nicht zur Klavierstunde?“, fragt er seinen Enkel. „Nein, Familie Weintraub feiert doch das Chanukkafest, da fällt Klavier aus.“ Opa nickt bedächtig. „Und wie geht es in der Schule?“ „Gut“, antwortet Johannes wortkarg. „Gute Noten?“ „Die meisten schon“ „Na raus mit der Sprache“, fordert Opa. „ Was haste in Deutsch und Mathematik?“ „Sehr gut und genügend“ „Und in Turnen?“ „Das heißt jetzt Leibesübungen, Opa.“ „Ach so, na was haste da?“ „auch genügend.“ Opa runzelt nachdenklich die Stirn. Er hatte seinen Enkel immer für ziemlich sportlich gehalten, fragt aber nicht weiter nach. „Und in Englisch?“ „Sehr gut.“ „Das hört sich doch ganz gut an, in Rechnen, das wird schon.“ Johannes sagt nichts. „Junge, nu’ mal Butter bei die Fische, was ist los? Warum bist du so trübsinnig?“ „Ach nichts.“ An diesem Nachmittag gelingt es Wilhelm Maltus nicht, mehr aus seinem Enkel herauszubekommen, obwohl er deutlich spürt, dass etwas vorgefallen sein muss. Später hatten sie eine Runde Schach gespielt, wie sie es manchmal taten, aber wenig geredet. Danach hatte er Kartoffelpuffer für den Jungen gemacht, die er wortkarg am Küchentisch vertilgt hatte.
Der Grund für Johannes’ Trübsinn rührt von folgender Begebenheit, die sich am Morgen abgespielt hatte. Auf dem Schulweg hatte er Rebecca gesehen. Sie ging etwa 50 Schritte vor ihm. Er war gelaufen, um sie einzuholen, hatte auch gerufen. Sie hatte sich kurz umgedreht und als sie ihn erblickte, war sie selbst losgelaufen und dann in eine Seitenstraße abgebogen, wo sie zwei Klassenkameradinnen traf. Sie hatte ihn keines Blickes gewürdigt. Was hatte er falsch gemacht? Ein paar Tage zuvor hatte er noch mit ihr in der Küche ihrer Eltern bei heißer Schokolade gesessen und dieses leckere Gebäck gegessen. In der Schule lief auch nicht alles so glatt, wie er bei seinem Besuch bei Opa vorgegeben hatte. Zwar war er, von Mathematik einmal abgesehen, wirklich ein guter Schüler, aber sein vormals bester Freund Kurt Krahn hatte überall herumerzählt, dass er sich mit Rebecca treffe, der Tochter vom Uhrmacherjuden und sich in Klein Jerusalem herumtreibe. Sich überhaupt mit Mädchen abzugeben, war für die Sextaner schon ein Fauxpas, dass Rebecca Jüdin ist, für manche offenbar eine Art Verbrechen. Er wurde mehr und mehr zum Außenseiter in seiner Klasse, obwohl sich einige Jungen neutral verhalten und sich nicht an der Häme beteiligten. Aber das waren ebenfalls Klassenkameraden, die auf dem besten Weg zum Außenseiter waren, und von Rüpeln, wie Willi Hamester traktiert wurden. Hamester, auch Hammer genannt, war der größte und stärkste Junge in der Klasse, der gerade wie es ihm beliebte, Boxhiebe und Kopfnüsse an alle verteilte, die er für unwürdig hielt, sich in seiner Nähe aufzuhalten. Johannes gehört leider dazu. Natürlich waren Typen, wie Hamester genau nach Turnlehrer Hackbarts Geschmack. Der hatte zu allem Überfluss davon erfahren, dass Johannes Kontakte zu einer jüdischen Familie hatte. Seitdem benachteiligte Hackbarth ihn in seinem Unterricht. Judenfreund und Schwächling hatte er ihn genannt und dafür gesorgt, dass er nicht mehr in die Fußballmannschaft der Klasse gewählt wurde.
Das Weihnachtsfest bei den Seibels verläuft zunächst harmonisch. Opa ist natürlich zu Besuch, aber die Zeiten als er für die Kinder als Weihnachtsmann verkleidet auftrat, sind längst vorbei. Nach dem Karpfen müssen Johannes und seine beiden Schwestern die gute Stube verlassen, bis die Erwachsenen die Kerzen am Tannenbaum angezündet und die Geschenke unter dem Baum aufgebaut haben. Dann wird traditionell das Glöckchen geläutet und die Kinder dürfen wieder herein. Sie singen, wie in jedem Jahr, einige Weihnachtslieder, wobei Johannes schon mal die verpackten Geschenke taxiert. Endlich ist Bescherung. Johannes bekommt von seinen Eltern und von Opa einiges Zubehör für seine Märklin Bahn und von Wilhelmine das Buch The adventures of Huckleberry Finn in englischer Sprache. Auguste hatte ein schönes Kleid und Wilhelmine einen neuen Mantel bekommen. Für Spielsachen sind die Mädchen schon zu groß, finden ihre Eltern. Johannes Mutter bekommt einen dieser neuen Staubsauger von ihrem Ehegatten. Die Geschenke seiner Frau enthalten zwei Schellackplatten, den neuesten Schlager und Operettenmusik, sowie ein neues Benzinfeuerzeug. Johannes überreicht Mutter einen kleinen Bilderrahmen mit einem selbst gemalten Bild einer Winterlandschaft, wofür sie sich herzlich bedankt. Seinem Vater übereicht er ein Zigarettenetui aus glänzendem Metall, welches er von seinem Taschengeld gekauft hatte. Vater nickt kurz und legt es achtlos auf die Anrichte. Der Höhepunkt des Abends naht: Ein elektrisches Grammophon, welches Paul Seibel sich selbst schenkt, das aber im Hotel seinen Platz finden soll. Dafür wird das alte Gerät zum Aufziehen zuhause aufgestellt. Johannes ist trotz der wertvollen Gaben enttäuscht. Vater hatte ihm nicht mal ein frohes Weihnachtsfest gewünscht. Nun ist er damit beschäftigt, das neue Grammophon anzuschließen. Schließlich legt er die Platte von den Comedian Harmonists auf. Der neue Schlager Ich hab ein Zimmer, gnädige Frau ertönt. Mama protestiert. Das passe nun wirklich nicht zu Weihnachten. Später am Abend lesen Mama und Wilhelmine abwechselnd weihnachtliche Kurzgeschichten vor. Aus dem neuen Grammophon tönt jetzt leise Operettenmusik. Die Erwachsenen trinken Wein, Wilhelmine bekommt auch ein Glas, während Johannes und Auguste an diesem Abend ausnahmsweise so viel grüne, rote und gelbe Brause trinken und Weihnachtsgebäck essen dürfen, wie sie mögen. Am Ende zünden Papa und Opa sich Zigarren an und Mama schimpft weil sie von dem Qualm husten muss und nicht mehr vorlesen kann.
Später als Johannes im Bett liegt und ihm ein wenig übel von der vielen Brause und den Süßigkeiten ist, muss er immer wieder daran denken, wie Vater sein Geschenk so achtlos beiseitegelegt hatte. Weshalb ist er so? Kein Lob, kein freundliches Wort. Dann denkt er an die Weintraubs, die ja nicht richtig Weihnachten feiern, aber trotzdem ging es dort geselliger und fröhlicher zu als hier zuhause. Das Chanukkafest, so wie Rebecca es beschrieben hatte, ist sicher auch schön. Ob sie wieder so viele Süßigkeiten gewonnen hatte beim Dreidelspiel? Schade, dass er nicht dabei sein konnte. Die Juden haben geheimnisvolle Rituale. Gern würde er mehr darüber erfahren. Seit jenem Tag als Rebecca auf dem Schulweg vor ihm davongelaufen war, hatte er sie nicht mehr gesehen. Am ersten Donnerstag im neuen Jahr, würde er wie gewohnt zur Klavierstunde erscheinen, dann wird er schon herausbekommen, weshalb sie sich so abweisend verhielt.
Johannes klopft sich den Schnee von den Stiefeln, bevor er zwei Wochen später das Uhrengeschäft betritt. Niemand ist im Laden. „Guten Tag“, sagt er laut. Keiner antwortet. Vorsichtig blickt er in die Werkstatt. Rebeccas Vater sitzt dort über seine Werkbank gebeugt, ein Lupenglas vor dem Auge. Er blickt auf, sieht ihn mitleidig an. „Ach Johannes, Rebecca ist nicht zuhause.“ „Ich wollte zur Klavierstunde. Heute ist doch Donnerstag.“ Weintraub zögert einen Augenblick, dann weist er ihm mit einem Kopfrucken den Weg nach oben. Auch Frau Weintraub ist heute irgendwie verlegen, fragt nur, ob er hoffentlich nicht so viel verlernt hat. Der Klavierunterricht zieht sich schleppend dahin ohne Rebecca. Schließlich fragt er, wo sie denn sei. „Bei ihren Freundinnen“, ist die knappe Antwort. Als er das Haus der Weintraubs verlassen will, fragt Rebeccas Vater, wie es denn seinem Großvater gehe. „Etwas besser“, antwortet er. „Sag’ ihm doch, dass er mal wieder vorbeikommen möchte, wenn es ihm gut genug geht.“
Als Opa Maltus und Johannes wieder einmal Schach spielen, seufzt Opa tief und setzt zu einer gequälten Rede an. „Ich war gestern bei Uhrmacher Weintraub. Er … also, es ist schwer zu erklären. Er sagte, dass mit dem Klavierunterricht erstmal Schluss ist.“ „Warum? Ich habe mich bestimmt immer ordentlich benommen.“ „Ich weiß, das ist es nicht, mein Junge.“ „Was denn dann?“ Opa ringt mit sich. „Sie sind Juden, einige Menschen reden schlecht über sie, weil … weil, ach das ist schwer zu verstehen.“ „So wie Turnlehrer Hackbart“, schimpft Johannes. „Die Weintraubs sind feine Leute“, setzt Opa erneut an, „aber sie haben gewisse Sorgen.“ Johannes sieht ihn fragend an. Opa schüttelt langsam den Kopf, als verstünde er es selbst nicht. „Und Rebecca?“ Opa knetet sich das Kinn und überlegt. „Rebecca kommt jetzt in ein Alter, wo die Mädchen …, ach das verstehst du nicht.“ „Opa! Ich habe zwei große Schwestern!“, erinnert er ihn. „Hess ok wedder recht“, seufzt Opa erneut. „Hab’ einfach ein wenig Geduld. Die Zeit heilt alle Wunden.“ Ehe Johannes etwas entgegnen kann, wechselt Wilhelm Maltus das Thema. „Was ist denn nun mit deinem Turnlehrer? Was erzählt der da für einen Unsinn in der Schule?“ Naja, er redet eben schlecht über die Juden, und wen er nicht mag, den triezt er ordentlich, nennt ihn Schwächling und gibt ihm Kopfnüsse. Redet so ähnlich, wie die Männer, die abends im Hotel am Stammtisch sitzen.“ Opa verzieht das Gesicht. „Und dieser Hackbart? Dich triezt er auch?“ „Manchmal“, gibt Johannes kleinlaut zu. „Lat di von den Mors nich unnerkreegen!“, fällt Opa ins Plattdeutsche und lacht kurz auf, wird aber gleich wieder nachdenklich.
Drei Monate später hat sich Johannes’ Klasse endgültig in zwei Lager gespalten. Diejenigen, die Herrn Hackbart, der zu allem Überfluss auch noch den Deutschunterricht übernommen hat, nach dem Mund reden und stramme Haltung annehmen, wenn der Turnlehrer seine Kommentare abgibt und jene die sich zurückhalten und so gut es geht mit stummem Protest seine Schikanen über sich ergehen lassen und schlechtere Noten kassieren, ihren Lehrer aber hinter seinem Rücken Kackbart nennen. Genau das hatte ein paar Tage zuvor, vermutlich ein älterer Schüler in der Aula an die Tafel geschrieben unter einer sehr gelungenen Karikatur des Turnlehrers. Während Hackbart sich furchtbar aufregte und dem Täter, den man sicherlich bald überführen werde, schon mal furchtbare Strafen androhte, fahndet die übrige Lehrerschaft aber nur verhalten nach dem Missetäter.
An einem stürmischen Märztag lässt Hackbart einmal mehr Ernst Jüngers heroisch verklärende Texte aus dem Weltkrieg vorlesen. Wie das unbesiegte deutsche Feldheer Stahlhelm an Stahlhelm, Gewehr an Gewehr, Bajonett an Bajonett seine vaterländische Pflicht gegen einen übermächtigen Feind erfüllt hat. Kurz vor dem Sieg, aber von den Roten und den Juden ein unverzeihlicher Verrat am Vaterland begangen, eine Revolution angezettelt und in Versailles der Totenschein der deutschen Nation ausgestellt wurde. Schlussendlich habe der Jude in seiner Niedertracht dem tapfer kämpfenden deutschen Landser den Dolch in den Rücken gerammt. Johannes ist verunsichert. Wenn das stimmt … er könnte seinen Vater fragen, der war schließlich im Krieg, aber der sprach nicht über seine Erlebnisse. Er könnte Opa fragen, dessen Urteil er mehr schätzt, aber Opa war nicht im Krieg. Herr Weintraub, der war im Krieg, aber den konnte er sowas unmöglich fragen.
In der letzten Stunde schreibt Mathematiklehrer Doktor Scharnagel, ein strenger aber bisweilen zu kluger Ironie neigender Zeitgenosse, Bruchrechnung an die Tafel, nachdem er die ideologischen Ergüsse seines Kollegen Hackbart hat von der Tafel wischen lassen, und zwar von Willi Hamester, der wie er ihm in seiner ironischen Art mitteilt, über die geeigneten körperlichen Eigenschaften zum Tafelwischen verfügt, an den geistigen müsse man noch arbeiten. Allerdings wagt niemand in der Klasse über solche Kommentare zu lachen, aus Angst, Hamester würde sich grausam rächen. Johannes kniet sich in der Mathematikstunde mächtig rein, um die zu erwartende schlechte Note in Deutsch wieder auszugleichen. Scharnagel spricht in seinem singenden Tonfall: „Man dividiert einen Bruch durch einen Bruch, indem man … Wolter?“ Zusammenzucken, ratloser Blick. „Weiterschlafen, Wolter! Seibel?“ Johannes springt auf. „Indem man den Zählerbruch mit dem Kehrwert des Nennerbruchs multipliziert.“ „Gut! An die Tafel! Vorrechnen!“ Johannes gelingt die Rechnung und bekommt eine Zwei.
Als sie nach Unterrichtsende endlich auf den Schulhof laufen, berichtet einer der älteren Schüler, dass im Hafen seit letzter Nacht ein Großfeuer tobt. Der fast fertige Schnelldampfer Europa stehe lichterloh in Flammen. Wahrscheinlich müsse man das Schiff auf Grund setzen, weil man der Flammen nicht Herr werde bei dem Wind. Johannes und einige seiner Mitschüler beschließen spontan mit der Hochbahn zu den Landungsbrücken zu fahren und sich das Ereignis anzusehen, obwohl es zuhause, wegen der Verspätung mächtig Ärger geben wird. Am Hafen, gegenüber der Werft Blohm & Voss stehen tausende Menschen, die gebannt die Löscharbeiten an dem Ozeanriesen verfolgen. Viele blicken entsetzt, einige haben feuchte Augen, andere schwadronieren sensationslüstern. Dichter Qualm quillt aus den schwarzgrau verrußten Aufbauten. Mehrere Löschboote spritzen hohe Fontänen Wasser in das Schiff. „Den Dampfer können die man glix verschrotten, dat kreegen die nie nich wedder hin“, kommentiert ein Hafenarbeiter.
Auch Wilhelm Maltus, der inzwischen die Europa als ein Hamburger Schiff akzeptiert, wenngleich es einer Bremer Reederei gehören wird, hatte am Vormittag von dem Unglück erfahren. Trotz seiner Schmerzen hatte er sich auf die Straße begeben und versucht sein Automobil anzuwerfen. Aber der Opel hatte den ganzen Winter am Straßenrand gestanden und springt nicht an. „So ein Schiet!“, schnauzt Maltus. Hauswart Pagel ruft aus dem Fenster seiner Wohnung im Hochparterre: „Da müssen Sie wohl erstmal Zündkerzen und Vergaser gründlich reinigen, Herr Maltus! Fleiß und Sauberkeit zahlt sich eben aus.“ „Weet ick selber, Kloogscheeter!“, gibt Maltus zurück. „Dann eben nicht, steht morgen sicher alles in der Zeitung. Ist ‘n Jammer um den schönen Dampfer“, brummt er und humpelt zurück in seine Wohnung.
Als Wilhelmine sich am nächsten Tag mit einem Einkaufsnetz auf den Weg zum Grünhöker machen will, fragt Johannes, ob er mitkommen kann. „Klar“, antwortet sie, „kannst mir tragen helfen mit den Kartoffeln, kriegst ordentlich Muskeln von.“ Als sie draußen sind, fragt er sie: „Glaubst du, dass die Juden unseren Soldaten im Krieg einen Dolch in den Rücken gerammt haben und wir deshalb den Krieg verloren haben?“ Sie bleibt stehen und sieht ihn entgeistert an. „Woher hast du den Blödsinn denn?“ „Von Kackbart, meinem Deutschlehrer.“ „Wie heißt der?“ „Eigentlich Hackbart.“ Sie schüttelt den Kopf. „Du glaubst es also nicht?“, fragt er nochmal nach. „Nein, ich glaube es nicht“, erklärt sie grimmig und geht weiter. „Und Papa? Ob der etwas weiß? Hat der nichts erzählt, als er damals aus dem Krieg kam?“ „Papa wurde 1915 verwundet, danach war er im Lazarett. Wegen seinem Bein kam er dann nach Hause. Da war ich fünf Jahre alt. Aus dem Weltkrieg hat er nie etwas erzählt.“
Die Ferien im Sommer 1929 sind zu Ende, Ernüchterung in der Quinta, der Oberrealschule an der Bogenstraße, und dann noch Deutsch bei Hackbart in der Frühstunde. Die 30 Jungen springen auf und nehmen militärisch stramme Haltung an, wie Hackbart es ihnen eingebläut hatte, als Peter Wolter, der Schmiere steht, von der Tür die Annäherung einer Lehrkraft meldet. Aber es erscheint nicht Hackbart sondern ein neues Gesicht. „Morgen, Jungs, ich bin Herr Zeckmann, euer neuer Deutschlehrer. Setzen! Herr Hackbart hat sich an eine andere Lehranstalt versetzen lassen“, verkündet er knapp. Einige von Johannes’ Klassenkameraden atmen auf, andere schauen enttäuscht, unter ihnen Kurt Krahn, der nicht mehr Johannes’ Freund ist. Zeckmann öffnet seine Aktentasche und entnimmt einen Stapel abgegriffener grauer Leseheftchen und verteilt sie. „Theodor Storm, der Schimmelreiter“, verkündet er. „Einer liest laut vor, alle anderen lesen den Text in ihren Heften leise mit, nach fünf Minuten, auf mein Kommando, ist der nächste mit Vorlesen dran.“ Johannes rechnet aus, dass er in dieser Stunde nicht mehr drankommen wird und geht seinen eigenen Gedanken nach, lässt die Ferien Revue passieren. Zwei Wochen lang war er mit Mutter und seinen beiden Schwestern an der Nordsee gewesen. Mit dem Dampfer Jan Molsen von den Landungsbrücken nach Cuxhaven waren sie gereist. Papa war natürlich nicht mitgekommen, der hatte zu viel im Hotel zu erledigen. An der Nordsee waren sie in einer kleinen Pension untergekommen, hatten in den Wellen getobt, lange Wattwanderungen unternommen und tolle Sonnenuntergänge gesehen. „Du bist ja braun wie `n Neger!“, hatte Kolonialwarenhändler Steincke gelacht und ein paar Dauerlutscher aus dem großen Bonbonglas spendiert, als Johannes zurück in Hamburg war. Aber die Sommerferien setzten sich scheinbar endlos fort. Von morgens bis abends war er mit den Jungen aus der Nachbarschaft am Isebekkanal und in den umliegenden Gärten und Grünanlagen unterwegs gewesen. Sie hatten versucht ein Floß zu bauen, um auf dem Isebekkanal zu fahren, wie Huckleberry Finn auf dem Mississippi. Johannes hatte seinen Freunden einiges aus dem Roman von Marc Twain berichtet, welchen er inzwischen durchgelesen hatte. Leider geriet das Floß aus Mangel an geeigneten Baumstämmen zu klein und war nach wenigen Metern zerbrochen und gekentert. An anderen Tagen hatten sie stundenlang Murmeln gespielt, um leere Manoli-Zigarettenschachteln, jene begehrten Sammelobjekte. Er hatte neue Freunde gefunden. Zu Rebecca hatte er keinen Kontakt mehr, was ihn immer noch mit Wehmut erfüllt. Opa verfolgt die Schiffbauaktivitäten der großen Reedereien. Inzwischen war der Schnelldampfer Bremen in Dienst gestellt und hatte auf seiner Jungfernfahrt nach New York erwartungsgemäß das Blaue Band gewonnen. Das ausgebrannte Schwesterschiff Europa liegt im Schwimmdock bei Blohm & Voss und wird repariert. Wilhelm Maltus ist hochzufrieden mit dieser Entwicklung, obwohl es Bremer Schiffe sind. Johannes wird aus seinen Gedanken gerissen, als die schrille Pausenglocke schellt.
In den folgenden Tagen kursieren Gerüchte auf dem Schulhof, dass Hackbart die Lehranstalt wohl nicht ganz freiwillig verlassen hatte. Einflussreiche Eltern sollen bei der Schulbehörde angefragt haben, ob die pädagogischen Fehltritte und politischen Anwandlungen des Herrn Hackbart tatsächlich dem Geist einer höheren Lehranstalt entsprechen, zudem hatte es wohl eine Beschwerde wegen der übermäßig harten Züchtigungen eines Schülers in der Turnstunde gegeben. „Welche Weichlinge wohl gepetzt haben?“, tönt Willi Hamester, alias Hammer. Kurt Krahn glaubt zu wissen, dass es die Eltern von Max Heylbrink waren, dem Hackbart in der Turnstunde den Arm ausgekugelt hatte. „Max ist doch selbst ein halber Jude!“, hatte Kurt durch den Klassenraum posaunt.