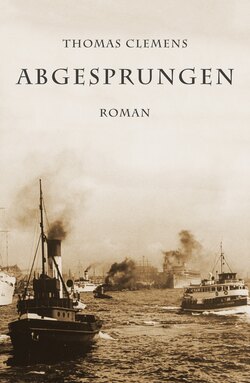Читать книгу Abgesprungen - Thomas Schaefer Clemens - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNew York, September 1939
Zwei weitere Nächte hatte Johannes Seibel in der Massenunterkunft für obdachlose Immigranten verbracht und in beiden Nächten hatte man versucht ihn zu bestehlen. Hätte er seine letzten Dollarnoten und seine Uhr nicht dicht am Körper getragen, wäre er jetzt wirklich völlig mittellos. In den Tagen zuvor, hatte er versucht Arbeit zu finden – ohne Erfolg. Amerika hat immer noch zwölf Millionen Arbeitslose und er hat nicht einmal eine Arbeitserlaubnis. Andererseits bietet er äußerlich mit seinem durch den Sprung ins Wasser verdorbenen Anzug keinen besonders vertrauenerweckenden Eindruck. Er muss alles auf eine Karte setzen und sein letztes Geld in neue Kleidung investieren, getreu dem Ratschlag von Wilhelm Maltus, dass anständige Kledage die halbe Miete sei. In einem der zahlreichen einfachen Hotels oder Restaurants auf der Lower-East-Side musste es doch Arbeit für ihn geben. Weshalb hatte er es nur versäumt etwas Geld bei einer New Yorker Bank zu deponieren, als er in den letzten Monaten mehrmals Landgang in der Stadt hatte? Aber selbst wenn er genug Geld hätte, die Möglichkeit mit dem Dampfer Normandie nach Frankreich zu Rebecca zu fahren, hat sich mit dem Kriegsausbruch zerschlagen. Der französische Luxusliner bleibt bis auf weiteres im New Yorker Hafen.
Tatsächlich hat er an diesem Tag Glück. Der Besitzer eines großen Restaurants in der Nähe des Tompkins Square, ein gewisser Pistorious Harvey, stellt ihn ohne Arbeitserlaubnis ein. Tatsächlich haben wohl seine gepflegte Erscheinung und seine Sprachkenntnisse überzeugt. Er soll in der Küche helfen, was sich als eine Tätigkeit als Tellerwäscher entpuppt. Dafür könne er eine kleine Kammer unter dem Dach bewohnen, wobei es sich um eine winzige Kammer handelt, in der es stickig und heiß ist und in der ein weiterer Mitarbeiter untergebracht ist. Warmes Wasser zum Baden gäbe es einmal pro Woche in der Badestube im Keller. Essen könne er von den Resten auf den Tellern, welche die Gäste zurückgehen lassen und wenn in der Küche etwas übrig bleibt. Zusätzlich hat Johannes durch zähes Verhandeln 50 Cent Tageslohn herausgeschlagen. Die Arbeit beginnt am späten Vormittag und geht bis spät in die Nacht, bis alles wieder für den nächsten Tag vorbereitet und gereinigt sei. Der Sonntag sei arbeitsfrei. Bei einer behördlichen Kontrolle habe er sich schnellstmöglich im Lagerraum hinter der Küche zu verstecken. Ernüchtert stimmt er schließlich den Arbeitsbedingungen zu, in der Hoffnung bald etwas Besseres zu finden, ohne zu ahnen, dass es sich bereits um einen der besseren Arbeitsplätze für Immigranten handelt. Also legt er seinen gerade erworbenen guten Anzug ordentlich zusammengefaltet in das schmale Schapp in der Kammer, den Hut obendrauf, zieht seine heruntergekommene Kleidung wieder an und macht sich an die Arbeit in der Spülküche.
Johannes’ Zimmergenosse ist in seinem Alter, heißt Harry und kommt aus Ohio. Er arbeitet in der offensichtlich ebenfalls Mister Harvey gehörenden benachbarten Wäscherei. Harrys Dienst beginnt morgens um fünf und endet am frühen Abend, sodass sie sich kaum sehen. Dennoch scheint er ein ganz erträglicher Zeitgenosse zu sein.
Die Arbeit in der Spülküche ist hart und anstrengend. Die Berge an schmutzigem Geschirr, Töpfen, Pfannen und anderen Küchenutensilien sind kaum zu bewältigen. Nach wenigen Tagen hat er wunde Hände von der Waschlauge. Allerdings bleibt ihm das eklige Resteessen von den zurückgehenden Tellern erspart. Als er an seinem ersten Arbeitstag sein Essen von den benutzten Tellern zusammenkratzt, tritt der Koch auf ihn zu. „Solange du anständig arbeitest, kannst du mit uns essen.“ Er deutet mit einem Kopfrucken auf den hinteren Bereich der Küche wo ein schmaler Tisch steht. Dort finden der Küchenchef, die vier Hilfsköche, drei Kellnerinnen und er selbst Platz.
Noch in der ersten Nacht in der Dachkammer schreibt er einen langen Brief an Rebecca, bedauert, dass es keine Möglichkeit für ihn gab, nach Frankreich einzureisen, er stattdessen im letzten Moment von der Bremen in den New Yorker Hafen gesprungen sei und nun mühsam in Amerika Fuß zu fassen versucht. Er drückt seine Hoffnung aus, dass der Krieg vielleicht bald vorbei sei und für sie und ihre Mutter der Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika frei sei. Er freue sich auf ein Wiedersehen in besseren Zeiten.
An jedem Montagmorgen meldet Johannes sich bei der Einwanderungsbehörde, nur um einen Stempel in ein Formular zu erhalten. Seine Einbürgerung könne zurzeit nicht erfolgen, weil zum einen sehr viele Immigranten aus Europa in die Vereinigten Staaten von Amerika kommen und zum anderen, er die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt, welche auch immer das sein mochten. Das Arbeitsverbot könne nicht aufgehoben werden. Wovon er leben sollte, interessierte auf der Behörde niemanden. Vielleicht ganz gut so, überlegt er. Von seinen zwölf Dollar Monatsverdienst kann er nichts sparen, da er nicht einmal die nötigsten Dinge besitzt, die er nach und nach beschaffen muss. Daher besteht unter den gegebenen Umständen kaum Hoffnung, aus dem Loch unter dem Dach in absehbarer Zeit wieder herauszukommen. So vergehen die ersten Wochen in Amerika in trostlosem Einerlei. Gottseidank versteht er sich mit seinen Kollegen in der Küche ganz gut, was nicht zuletzt an seinen Sprachkenntnissen liegt. Da es ihnen zu mühselig ist, seinen deutschen Namen auszusprechen, nennen sie ihn nur Joe, was ihm ganz recht ist.
Die attraktive Linda, ist nicht nur Kellnerin, sondern erledigt für Mister Harvey in einem winzigen Büro ohne Fenster die Buchhaltung. Manchmal schreibt sie etwas auf einer kompakten Remington Schreibmaschine. Eines Tages bleibt sie vor Johannes’ Spültisch stehen, weil sie seine wunden, rissigen Hände entdeckt hat. Sie schüttelt den Kopf. Kurz darauf bringt sie ihm eine Salbe. „Wird Zeit, dass der alte Harvey endlich eine dieser neuen Spülmaschinen anschafft“, schimpft sie. „Willst du mich arbeitslos machen, Linda?“, entrüstet er sich. „Du kannst mehr als nur Teller spülen, Joe! Wie du neulich mit den Untertassen jongliert hast, damit kannst du im Varieté auftreten!“ Johannes sieht sie zweifelnd an. Als sie verschwunden ist, macht er sich resigniert an die Arbeit. Er hatte sich längst um andere Arbeit bemüht. Es ist hoffnungslos, ohne Arbeitserlaubnis bessere Arbeit zu bekommen.
Dennoch nutzt Johannes die freien Morgenstunden und die Sonntage, um die riesige Stadt zu erkunden und sich nach Arbeit umzusehen. Mehrmals war er bis zur 150th Street hinaufgefahren. Dort im Stadtteil Washington Heights leben ebenfalls viele deutsche Immigranten. Allerdings waren es eher bessergestellte Aussiedler, darunter viele jüdische Familien. Als einzelner mittelloser nichtjüdischer Immigrant findet er keinen Zugang zu den dort lebenden Familienverbänden und schon gar nicht bezahlte Arbeit. Hier bin ich erst recht ein Fremder, hatte er resigniert festgestellt.
Seitdem führt sein Weg ihn häufig nach Little Italy durch die belebte Mulberry Street, hinein ins Gewimmel der vielen Straßenhändler und kleinen Geschäfte, wo ein merkwürdiges Kauderwelsch aus Englisch, Jiddisch und Italienisch gesprochen wird, weiter über die breite Canal Street nach Chinatown, wo es in der Pell Street exotisch aus den Garküchen duftet, schließlich zur Brooklyn Bridge von deren über der Fahrbahn verlaufenden Gehsteig sich immer ein Blick auf den East River und auf die Wolkenkratzer Lower Manhattans lohnt. Dann mit der Elevated, der Hochbahn, zurück, noch schnell die Zeitung lesen bevor seine Arbeit am Spültisch in der Küche beginnt. Vor allem die Neuigkeiten aus Europa interessieren ihn. Deutschland hatte Polen nach wenigen Wochen besiegt und besetzt, zumindest den westlichen Teil. Von Osten war die Rote Armee dort einmarschiert, eine bis dahin geheime Vereinbarung des Hitler-Stalin-Paktes. Polen war von der Landkarte verschwunden, seine Städte und Landschaften verwüstet und das Volk unterjocht oder in Arbeitslager verschleppt, ohne dass England und Frankreich merklich in das Geschehen eingegriffen hatten. Auch rätselte die Weltpresse nach dem Verbleib der Bremen, die nach ihrer Abreise aus New York sechs Wochen zuvor angeblich nie in Deutschland angekommen war. Die offizielle Verlautbarung des deutschen Konsulates war: Man möge doch Winston Churchill fragen, vielleicht wisse dessen Royal Navy etwas Näheres zum Verbleib des Schiffes. Die Briten dementierten, die Bremen aufgebracht oder gar versenkt zu haben, was glaubhaft war. Wenn es ihnen tatsächlich gelungen wäre, des deutschen Schnelldampfers habhaft zu werden, hätten sie es propagandistisch ausgeschlachtet, ebenso wie die Deutschen, wenn das Schiff in der Heimat eingetroffen wäre. Die Presse spekulierte also weiter.
Bei einem weiteren seiner morgendlichen Spaziergänge kommt Johannes durch eine wenig belebte Straße in der Nähe des East River. Penetrante Gerüche von den nahen Schlachthöfen wabern durch die verwahrlosten Straßen. Johannes biegt in eine Nebenstraße ab, um die Gegend so schnell wie möglich zu verlassen, als ihm zwei Männer den Weg versperren. „Hast dich verirrt, Rockefeller?“, fragt der größere der beiden und drückt ihn gegen eine Hauswand. Ehe Johannes sich wehren kann, haben die beiden ihm den Arm auf den Rücken gedreht und seine Brieftasche aus seinem Jackett gezogen. Der kleinere der beiden findet keine drei Dollar darin. „Verdammt! Das ist alles? Er muss noch mehr haben, bei den feinen Klamotten.“ Der größere reißt Johannes herum. Das Geräusch reißenden Textils ist zu hören. „Raus mit den Kröten! Wird’s bald!“ Er hält ihm ein spitzes Messer an die Kehle. „Ich habe nicht mehr, ehrlich, Jungs!“, stammelt Johannes. Der kleinere der beiden fängt an ihn abzutasten und greift sich seine kostbare Taschenuhr, welche er von Mila Weintraub bekommen hatte. Dann hören sie einen schrillen Pfiff. „Verdammt, die Cops! Hast Glück gehabt, Rockefeller.“ Er schleudert Johannes herum und verpasst ihm einen derben Tritt, dass er auf den Bürgersteig stürzt. Sein Hut fliegt auf die Straße. Ein Jugendlicher greift sich den Hut und rennt weg. Die beiden Straßenräuber verschwinden so schnell wie sie gekommen sind in einem Hauseingang. Als Johannes sich aufrappelt sieht er zwei Polizisten in knapp 50 Meter Entfernung herankommen. Seine Brieftasche ist weg und damit auch seine Aufenthaltsgenehmigung. Keine gute Idee der Polizei gegenübertreten zu müssen. Eilig macht er sich davon. Die Polizisten verfolgen ihn allerdings nicht weiter. Erst jetzt merkt er, dass er an der Stirn blutet, eine harmlose Schürfwunde von dem Sturz auf das Straßenpflaster. Trotzdem ist ihm ziemlich übel. Verdammt, seine Uhr ist weg, der einzige Besitz, der etwas wert ist und außerdem einen hohen emotionalen Wert für ihn hatte. Der Lohn für sechs Tage schwere Arbeit ist ebenfalls verloren! Vorsichtig blickt er sich um, erreicht bald eine belebtere Straße.
Als er mit seinem zerrissenem Anzug und der Schürfwunde durch den Personaleingang des Restaurants kommt, läuft er Linda in die Arme. „Mein Gott, Joe, was ist passiert?“ „Ach, nichts.“ „Willst du mich auf den Arm nehmen? Du siehst aus, als ob du überfallen wurdest. Du blutest am Kopf! Die Wunde muss desinfiziert werden, ach Gott und der schöne Anzug und wo ist dein Hut?“ Rose und Erica, ihre Kolleginnen, kommen heran und halten sich beide erschrocken die Hand vor den Mund.
Nachdem Linda und Rose ihren Kollegen verarztet und die Hoffnung geäußert haben, dass sein Anzug durch eine versierte Schneiderin, wie Lindas Tante, noch zu retten sei, sitzen sie am Tisch hinter der Küche beisammen und Johannes muss erzählen, was passiert ist. „Verdammt, Joe, wie konntest du dich in diese miese Gegend trauen und dann noch mit dem feinen Zwirn. Da mussten die ja denken, dass bei dir was zu holen ist“, entrüstet sich Rose. Joe nickt. „Das war wohl ziemlich naiv von mir.“ „Allerdings“, beteuert der Koch, „kannst froh sein, dass du noch lebst.“ Seine Kollegen fragen ihn weiter aus, was er früher in Deutschland gemacht hat, weshalb er so gut ihre Sprache spricht und ob Hitler wirklich so schlimm ist und ob er glaube, dass der Krieg in Europa bald vorbei sei? Johannes erklärt, dass Hitlers Regime schlimm genug ist, dass er von der Bremen in den Hudson gesprungen sei. Vorher habe er als Steward die Passagiere auf dem Schiff bedient. Seine Kollegen sehen ihn mit einer Mischung aus Staunen und Ungläubigkeit an.
Eine Woche später ist Johannes’ Anzug geflickt und die Schürfwunde verheilt. „Da bin ich euch wohl etwas schuldig, wenn ich wieder ein paar Dollar gespart habe“, teilt er Linda und Rose mit, als sie ihm seinen frisch gebügelten Anzug überreichen. Dazu hatten sie noch auf einem Straßenmarkt in der Eldridge Street einen ganz passablen Hut für ihn erstanden. „Lass nur!“, wiegelt Linda ab. „Am Samstag, dann bekomme ich meinen Wochenlohn von Mister Harvey, davon lade ich euch ins Kino ein“, verspricht er. „Fein, im Astoria am Time-Square läuft Der Zauberer von Oz mit Judy Garland in der Hauptrolle“, erklärt Rose. Er nickt. „Ich rede mal mit Mister Harvey, ob er uns am Samstagabend frei gibt“, erklärt Linda.
Mister Harvey schüttelt entschieden den Kopf. Am kommenden Samstag könne er niemanden seiner Leute entbehren. Eine große Gesellschaft habe sich am Abend angemeldet, eher benötige er noch eine weitere Kellnerin. „Wie wäre es mit einem Kellner, der bereits Erfahrung mit den vornehmen Gästen auf einem Ozeandampfer hat?“, schlägt Linda vor. „Ach, und wer soll das sein?“, gibt er ungnädig zurück. „Joe!“
Als am Samstag kurz vor Mitternacht die letzten Gäste gegangen sind, zahlt Mister Harvey den zusätzlichen Lohn und die Trinkgelder an seine Angestellten aus. Mit Johannes’ Leistung ist er sehr zufrieden. Leider könne er ihm aber keine dauerhafte Stellung vorn im Restaurant anbieten, solange er nicht über eine offizielle Arbeitserlaubnis verfüge, zu riskant, wenn die Behörde kontrolliert. Hinten in der Küche könnte er sich ja rechtzeitig verstecken. Aber wenn er noch etwas für ihn tun könne, jederzeit. Mit der Einbürgerung und der Arbeitserlaubnis sei es wohl einfacher, wenn ein angesehener Bürger der Vereinigten Staaten persönlich für ihn bürge, deutet Johannes an. Mister Harvey lehnt dies jedoch ab. Das würde nichts bringen und mit den Behörden wollte er lieber nichts zu tun haben.
Ende November, die ersten unangenehm kalten Tage hatten New York in den Morgenstunden mit Raureif und Nebel überzogen. Dennoch nutzt Johannes den freien Sonntag für eine weitere Exkursion durch die Riesenstadt. Dank des warmen Mantels, ein Geschenk von Mister Harvey zum Thanksgiving, muss er nicht frieren. Harvey hatte den Mantel natürlich nicht gekauft, er war in seiner Wäscherei von einem Kunden nicht abgeholt worden. Möglicherweise plagte Harvey sein Gewissen, weil er die persönliche Bürgschaft für ihn abgelehnt hatte. Mit der Subway fährt Johannes bis zur 141st Street hinauf. Gleichförmige rote Backsteinblöcke mit den obligatorischen verrosteten Feuertreppen an der Außenfassade umgeben ihn und dennoch sind die Straßen recht belebt. Hier wohnen fast nur Neger. Er meidet weniger belebte Straßen und achtet genau darauf, ob ihn jemand belauert oder verfolgt. Alles erscheint unverdächtig, daher biegt er zum Harlem-River ab, an dessen Ufer er spazieren geht. Johannes zieht trotz des Überfalls, die weniger wohlhabenden Stadteile den pompösen Gegenden vor. In die Geschäfts- und Vergnügungsviertel Manhattens hatte er Linda und Rose einmal begleitet. Aber das war eine Welt, in die er, der jeden verdammten Cent zweimal umdrehen muss, nicht hineinpasst. Er hatte Linda und Rose schließlich, wie versprochen, ins Kino eingeladen. Der Zauberer von Oz, ein gut inszeniertes, tiefgründiges Märchen hatte ihn durchaus beeindruckt. Vor allem als die wirklich bezaubernde Judy Garland ihr Stück Over the Rainbow intoniert und die Frauen zu Tränen rührt. Rose, neben ihm hatte seine Hand gedrückt und sich von ihm die Tränen abwischen lassen, was ihr hinterher furchtbar peinlich war. Dennoch war Johannes an jenem Abend berauscht von der Atmosphäre im flirrenden Downtown Manhattan, die unglaubliche Leuchtreklame am nächtlichen Time-Square, die gewaltigen Silhouetten der Wolkenkratzer, die Menschenmassen und der nicht abreißende Autoverkehr in den breiten Straßen und das mitten in der Nacht. Ins Kino hatte sie noch ein weiterer Mann begleitet. Zunächst hatte er eine Spur Eifersucht verspürt, als der die attraktive Linda zur Begrüßung herzlich umarmt hatte. Kurz darauf hatte sie ihn als ihren kleinen Bruder Victor vorgestellt, obwohl Victor fast Eins Neunzig misst. Victor hatte sie alle nach dem Kino in eine Bar auf einen Drink eingeladen. Die hellblonde Linda gefällt ihm, aber da macht er sich nichts vor. Bei ihr hätte er sicher keine Chancen, bei Rose schon eher, wie sie ihn manchmal ansah. Schnell verdrängt er den Gedanken, eine seiner Kolleginnen zu begehren. Es war schon eine Menge wert, sie als wohlgesonnene Arbeitskolleginnen zu haben. Wenn Rebecca nur hier wäre, denkt er mit einer Spur Wehmut.
Plötzlich hört er voraus vom Flussufer schrille Schreie einer Frau und ihrer Kinder. Die Frau, eine Negerin, keift ihren Mann, einen riesigen Kerl, an und schubst ihn zum Ufer hin. Gerade als Johannes im Laufschritt herankommt, springt der Mann recht unbeholfen ins Wasser. Die Frau fällt mit einem weiteren schmerzlichen Schrei auf die Knie und hält zwei Kleinkinder im Arm. Johannes sieht im Wasser eine kleine Hand wild herumzappeln, ein krauser Haarschopf erscheint kurz, verschwindet jedoch unter der Wasseroberfläche. Der Vater versucht vergebens sein Kind zu erreichen. Die Strömung scheint es fortzureißen. Der Mann kann offensichtlich nicht schwimmen. Aber da hat Johannes schon Schuhe und Mantel abgestreift. Ohne zu zögern springt er in den eiskalten Fluss. Mit wenigen Schwimmzügen erreicht er die Stelle, wo er das Kind zuletzt gesehen hat. Er taucht unter, kann den kleinen Körper aber nirgends ausmachen. Beim zweiten Versuch bekommt er einen zierlichen Arm zu fassen und zieht das Kind an die Oberfläche. Nun erst merkt er wie ihn selbst die Kälte lähmt. Mit Mühe schwimmt er mit dem leblosen, kleinen Jungen gegen die Strömung ans Ufer. Die Frau zieht das Kind aus dem Wasser und stößt einen schrillen Schrei aus. Sie hält ihren kleinen Sohn in den Armen und schüttelt ihn. Auch der Vater des Kindes ist wieder ans Ufer geklettert. Johannes nimmt das Kind, hält seinen Kopf nach unten und klopft ihm mehrmals auf den Rücken. Der Junge hustet heftig, spuckt einen Schwall Wasser aus und atmet. Seine Mutter kniet neben ihnen und ist in einen gebetsartigen Singsang gefallen. Der Vater, dieser riesige Kerl, weint hemmungslos. Johannes sieht an sich herunter. Er friert in seiner nassen Kleidung. „Es ist mir in dieser Stadt scheinbar nicht vergönnt einen intakten Anzug zu besitzen“, murmelt er. Der Mann kommt plötzlich auf ihn zu und schließt ihn in seine Arme. Seine kräftigen Muskeln zerquetschen ihn fast. „Danke! Danke, guter Mann, Sie schickt der Himmel! Sie haben meinen Louis gerettet. Ich stehe tief in Ihrer Schuld!“ Die Frau schimpft schon wieder mit ihrem Mann: „Cooper! Vielleicht, bietest du dem tapferen Herrn an, mit zu uns nach Hause zu kommen. Ihr holt euch sonst noch den Tod in den nassen Sachen.“ Ihren kleinen Sohn, der wohl noch keine drei Jahre alt ist, hatte sie inzwischen in ihre eigene warme Jacke verpackt.
Die Wohnung der Familie Mocala liegt im Erdgeschoss eines der Backsteinblöcke, nicht weit entfernt. Johannes ist es ein wenig unangenehm dort mit hinzukommen. Aber was sollte er tun, er braucht einmal mehr trockene Kleidung und Frau Mocala hatte ihn gleichermaßen herzlich wie unerbittlich in ihre Wohnung eingeladen. Neben den drei kleineren Kindern, welche auf dem Spaziergang am Harlem River dabei waren, sind in der Wohnung noch zwei ältere Schwestern, eine Großmutter und ein Baby. In einem kaum verständlichen Kauderwelsch reden alle durcheinander, bis das Geschehene in Kurzform berichtet ist und Johannes als Retter des kleinen Louis ausgiebig gepriesen ist. Eines der älteren Mädchen bringt heißen Tee, nachdem Johannes in viel zu weiter trockener Kleidung von Herrn Mocala neben dem bullernden Ölofen sitzt. Die Mocalas scheinen nicht gerade arm zu sein, so wie es in der geräumigen Wohnung aussieht und die Kinder gekleidet sind. In einem der Schränke stehen eine Menge Pokale und die Wände sind mit Fotographien behängt die Herrn Mocala im Boxring oder in Siegerpose zeigen. Einige Zeitungsauschnitte berichten über Boxkämpfe in denen er gesiegt hatte.
Johannes muss erzählen, wo er herkommt und wo er so gut schwimmen gelernt hat. Schmunzelnd denkt er an seine ersten Schwimmstunden in der Warmbadeanstalt in Hamburg. Er berichtet, dass er aus Deutschland kommt und vor einiger Zeit auf einem großen Schiff zur See gefahren sei. Herr Mocala teilt ihm mit, dass er Boxtrainer sei, was sich ja schon aus den Fotos und Pokalen ahnen lässt. Seine Frau ergänzt vorwurfsvoll: „Bärenstark ist er, Cooper kann die halbe Stadt verprügeln, nur schwimmen kann er nicht!“ Alle lachen. Cooper Mocala berichtet, dass er alle Kämpfe von dem großen Max Schmeling hier in New York gesehen hat, seine großartigen Siege gegen Joe Louis, Ben Foord und Max Baer, aber auch Schmelings schmachvolle Niederlage im letzten Jahr, technischer k.o. in der neunten Runde wiederum gegen Louis. Johannes erzählt, dass er in Hamburg den legendären Boxkampf von Max Schmeling gegen Steve Hamas gesehen hat. Cooper Mocala klopft ihm freundschaftlich auf die Schulter und erzählt, dass er seinen Sohn Louis, den er gerade aus dem Wasser gefischt hat, nach dem Boxer Joe Louis benannt hat. Johannes erklärt, dass seine Freunde hier in New York ihn Joe nennen. Mocala lacht, „wenn das kein Zeichen ist!“ Er fragt, wie er seine tiefe Schuld, dass Johannes sein Leben für den kleinen Louis riskiert hat, je wieder gutmachen kann. Das Leben eines Kindes zu retten sei Ehrensache, dafür brauche er keine Belohnung, beteuert Johannes. Aber Herr Mocala besteht auf die Erfüllung eines Wunsches. Johannes überlegt. „Trainieren Sie mich im Boxen!“, antwortet er schließlich.
„Nochmal, kriegen wir deinen Anzug nicht wieder hin“, klagt Linda, als er am nächsten Tag vor Arbeitsbeginn von seinen Erlebnissen in Harlem berichtet und den erneut ruinierten noch feuchten Anzug zeigt. Erica schüttelt den Kopf und bemerkt in abfälligen Ton: „Und das wegen einem Niggerbalg, als wenn es da nicht schon genug von gibt.“ Rick, einer der Hilfsköche pflichtet ihr bei. Die anderen sagen nichts dazu. „Ein Kind ist ein Kind, egal ob schwarz oder weiß, ich würde es jederzeit wieder tun!“, erklärt Johannes wütend. „Ach, wie edel, der Herr!“, tönt Erica und verlässt die Küche. Später nimmt Linda ihn beiseite. „Ich finde es großartig, dass du den kleinen Jungen gerettet hast, Joe!“, erklärt sie mit warmherziger Stimme.
Einige Tage später, früh am Morgen betritt Johannes zusammen mit Cooper Mocala einen, zum Box-Club umgebauten Lagerraum auf einem Hinterhof in Harlem. Zwei Dutzend Schwarze sind dort und begrüßen Cooper, sehen Johannes aber argwöhnisch an. „Cooper, was hat das Weißbrot hier zu suchen?“ Cooper baut sich vor den Männern auf. „Das ist Joe, mein Freund! Er hat meinen Sohn aus dem Fluss gezogen und ihm das Leben gerettet. Er will bei uns lernen, wie man seine Fäuste richtig gebraucht. Sportsgeist, Männer, steht an oberster Stelle. Wenn sich jemand unfair gegen Joe verhält, kriegt er es mit mir zu tun, verstanden!“ Einige der Männer nicken verständig, andere murren herum und werfen Johannes böse Blicke zu. Dem ist inzwischen ein wenig blümerant zumute. Cooper führt ihn in das Gebäude. „Erstmal staffieren wir dich aus. Zeig mal deine Hände, Hm, eher Klavierspielerhände. Naja, kräftige Schultern hast du ja, wir schaffen das schon“, erklärt Cooper. Kurz darauf steht Johannes in Boxershorts und freiem Oberkörper mit angelegten Handschuhen vor Cooper. „Okay, versuche mich am Kopf zu treffen, keine Rücksicht, stell dir vor, ich wäre einer von denen, die dich mal richtig mies behandelt haben und du willst es demjenigen heimzahlen.“ Johannes fällt spontan eine ganze Reihe von Kandidaten ein. Er versucht ein paar Treffer zu landen, aber Cooper weicht ihm mühelos aus oder wehrt die Schläge mit seinen Fäusten ab. Mit viel Geduld zeigt er ihm Deckungs-, Schlag- und Abwehrtechniken, erklärt ihm, locker in den Beinen, stets in Bewegung zu bleiben. Nach knapp zwei Stunden beendet Cooper das Training, schlägt aber unvermittelt einmal zu und trifft Johannes am Kopf. Der geht sofort zu Boden. Einige der zuschauenden Sportler lachen. Cooper hilft ihm auf. „Sorry! Das gehört zum Training. Einen Mädchenschlag muss jeder in der ersten Trainingsstunde einstecken“, lacht Cooper. Johannes reibt sich den Schädel. Aha, Mädchenschlag, also. „Gar nicht schlecht, für den Anfang“, kommentiert Cooper, als sie sich mit eiskaltem Wasser an dem großen Steinbecken in dem improvisierten Umkleideraum den Schweiß herunterwaschen. „Wenn du nach dem Schlag eben in zwei Tagen wiederkommst, wirst du ein passabler Boxer.“ Er gibt ihm einen mit Sand gefüllten Punching-Ball. „Den hängst du in deiner Kammer auf und verprügelst ihn jeden Morgen 20 Minuten lang, so wie ich es dir gezeigt habe! Bis übermorgen, Joe!“
Johannes liegt auf seinem Bett in der Dachkammer, trübes Licht fällt durch das winzige Fenster. Es ist so kalt, dass er seinen warmen Mantel trägt. Harry, sein Stubengenosse ist bei seiner Familie in Ohio. Rose, Linda und die anderen sind ebenfalls bei ihren Familien. Das Restaurant hat ein paar Tage geschlossen. Das Haus ist leer. Es ist Weihnachten, er ist allein und fühlt sich hundeelend. Er hatte zwar geahnt, dass ihn irgendwann schreckliches Heimweh ereilen wird, aber dass es so schlimm wird. Was wäre passiert, wenn er auf der Bremen geblieben wäre? In der Zeitung hatte er gelesen, dass der deutsche Schnelldampfer wieder aufgetaucht war. Vor einigen Tagen war die Bremen nach Deutschland zurückgekehrt. Wahrscheinlich hatte man das inzwischen mit einem Tarnanstrich versehene Schiff in einem sowjetischen Hafen am Polarmeer versteckt und war in den dunklen Winternächten dicht an der norwegischen Küste entlang unbemerkt bis nach Bremerhaven gedampft. Die Nazis hatten ein Riesenspektakel darum gemacht.
Rose hatte ihm gestern einen kleinen Schokoladenkuchen mit einer Kerze darauf hingestellt. Sie ist längst heruntergebrannt. Wie es Rebecca und ihrer Mutter wohl ergeht? Ob sie gerade an ihn denkt. Ob sein Brief bei ihr angekommen ist und ob er bald einen Brief von ihr bekommen wird. Vermutlich kam kaum noch Post aus Europa durch. Gottseidank sind Rebecca und ihre Mutter dort in Frankreich in Sicherheit. Und seine Familie? Was würde aus ihnen werden in Deutschland? Wilhelmine würde er gern hier in Amerika haben. New York würde ihr bestimmt gefallen. Hoffentlich macht sie nichts Unüberlegtes, wurde ihre Courage ihr nicht zum Verhängnis. Wenn er ihr nur schreiben könnte. Aber seit Krieg in Europa herrscht, geht auf dem normalen Weg keine Post mehr nach Deutschland. Andererseits berichten weiterhin amerikanische Journalisten von dort, weil Amerika seine Neutralität bisher aufrechterhält. Angeblich geht Post über Schweden nach Deutschland. Aber selbst wenn er herausfindet, wie das funktioniert, wäre es riskant. Vermutlich würden die Briefe aus dem Ausland gelesen werden und er würde seine Familie in Gefahr bringen, wenn seine Flucht von der Bremen als Desertion betrachtet wird. Wie lange der Krieg wohl noch dauern wird. Im Moment tat sich kaum etwas auf dem europäischen Kriegsschauplatz, aber das mochte am Winter liegen. Er sollte hinausgehen anstatt hier Trübsal zu blasen, aber dort war es noch kälter und er besitzt zurzeit kaum noch Geld. Endlich steht er auf und schlägt wütend auf den Punchingball ein, der zwischen zwei Seilen gespannt über seinem Bett hängt.
Zum Jahreswechsel auf 1940 veranstaltet Harvey eine große Silvesterparty in seinem Restaurant. Johannes ist wieder einmal als Aushilfskellner eingesprungen und hat mit seinen Jonglierkünsten die Gäste beeindruckt und den einen oder anderen Nickel zusätzlich an Trinkgeld bekommen. Harvey hat sogar ein kleines Orchester engagiert und die Gäste tanzen die ganze Nacht zu den Stücken von Benny Goodman, Artie Shaw, Tommy Dorsey und anderen Größen des Swing. Rose hatte den ganzen Abend schon mit Johannes geflirtet, ihn im Vorbeigehen unauffällig berührt und ihn dabei kokett angesehen. Unbemerkt von Mister Harvey hatten sie im Laufe der Nacht einige Drinks konsumiert. Lange nach Mitternacht, als die meisten Gäste gegangen sind, drängt Rose ihn auf die Tanzfläche, obwohl er mehrmals beteuert, dass er nicht Swing tanzen kann. Die Kapelle spielt gerade Goodmans Sweet Georgia Brown. Swing tanzen sei in Deutschland sogar verboten, bekräftigt er. Wenn man Glück hatte, wurde man nur verprügelt und ein paar Tage in eine stinkende Zelle gesperrt, wenn man in einem der wenigen Hamburger Swingkeller erwischt wurde, aber wen in Amerika interessiert das schon. „Dann bring ich es dir jetzt bei!“, erklärt Rose, bei der der Alkohol bereits deutlich Wirkung zeigt, mit leicht lallender Stimme und zieht ihn hinter sich her auf die Tanzfläche. Aber Swing ist das keineswegs, was Rose ihm da beizubringen versucht. Als endlich Stairways To The Stars von Glenn Miller erklingt, schmiegt sie sich eng an ihn und lässt sich langsam und gefühlvoll über die Tanzfläche bewegen. Die Band kündigt schließlich den letzten Titel an und spielt Over The Rainbow. Johannes zieht sie enger an sich. Sie presst ihren Unterleib an ihn. Eine eindeutigere Geste konnte es nicht geben. „Ich habe die Kammer heute Nacht für mich allein. Harry ist noch in Ohio, kommt erst nächste Woche zurück“, flüstert er dicht an ihrem Ohr. „Du bist ein ganz schlimmer Junge, weißt du das?“, säuselt sie angetrunken. Sie sehen sich in die Augen. Verschworenes Einvernehmen! Johannes sieht sich kurz um. Linda trägt gerade ein großes Tablett mit Gläsern in die Küche, Harvey ist gottseidank nirgends zu sehen. Erica serviert Getränke für die wenigen verbliebenen Gäste, bevor sich ihr der Hilfskoch Rick in ähnlicher Weise zuwendet. „Lass uns verschwinden und das neue Jahr auf unsere Art einläuten, Rose-Baby“, schlägt er vor. „Meinst du wirklich, Joey-Boy“, zweifelt sie mit viel zu süßer Stimme. „Aber es wird auffallen, wenn wir die anderen hier allein weiterarbeiten lassen“, wendet sie ein. „Das wird es“, raunt er und schiebt sie sanft zum Rand der Tanzfläche. Sie kichert, ziert sich ein wenig. Er drängt sie in eine Nische neben der Garderobe, wo man sie nicht direkt sehen kann und küsst sie auf den Hals dann auf den Mund.“ „Ich glaube ich bin beschwipst“, kichert sie. „Dann sollten wir jetzt nach oben gehen und Rick und Erica zuvorkommen, sonst ist hier gleich niemand mehr und das würde dem guten Mister Harvey gar nicht gefallen“, überzeugt er sie schließlich.
Johannes erwacht als ihn jemand heftig schüttelt. Mister Pistorious Harvey persönlich steht vor seinem Bett und brüllt, ob er den Saustall allein aufräumen soll und ob er sich vielleicht mal bequeme zur Arbeit zu kommen und wofür er ihn wohl bezahle und wenn er in zehn Minuten nicht im Restaurant erschienen sei, könne er sich als gefeuert betrachten. Dann stapft er mit schweren Schritten aus der Kammer. Johannes sieht sich um. Rose ist bereits verschwunden, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der wütende Puritaner Harvey sie hier erwischt hätte. Johannes beeilt sich den zerwühlten Laken zu entsteigen. Er findet zwischen seiner verstreuten Kleidung einen Seidenstrumpf auf dem Boden. Die Erlebnisse der letzten Nacht ziehen an seinem inneren Auge vorbei. Er hatte Rose ausgezogen, ganz langsam, und ihren Körper mit Küssen bedeckt, dann, im letzten Moment hatte sie wieder Kontrolle über sich gewonnen und es nicht zum Äußersten kommen lassen. Schnell zieht er sich an und begibt sich eiligst in das Restaurant. Nur Linda ist dort und räumt Gläser zusammen. Sie grinst ihn vielsagend an.
Mitte Januar wird es in New York richtig kalt. Zudem hat es kräftig geschneit. An einem der freien Sonntagabende besuchen Johannes, Rose, Linda, Lindas kleiner Bruder Victor, sowie Steve und Charly das Green Crocodile, eine preiswerte Bar am Tompkins Square. Steve ist Radiomechaniker und Charly arbeitet in einem Büro. Sie sind Freunde von Victor.
Rose und Johannes verhalten sich distanziert seit ihrer gemeinsamen Nacht, wissen beide nicht so recht mit der peinlich ungewohnten Situation umzugehen. Sie, weil sie entschieden zu leichtfertig gewesen ist. Um ein Haar hätten sie es getan. Möglicherweise hält er sie jetzt trotzdem für ein Flittchen und wahrscheinlich hatten alle es mitbekommen – wie peinlich! Auch Joes Gewissen ist nicht rein, weil er die Situation ausgenutzt - sie im angetrunkenen Zustand zu verführen versucht hatte. Am Tag nach Neujahr hatte er diskret ihren Strumpf, den sie in seiner Kammer vergessen hatte, in ihre Manteltasche gesteckt. Sie war errötet und hatte nichts weiter gesagt. Auch heute Abend lässt sie sich nichts anmerken.
Die Männer reden eine Zeitlang über die letzten Baseballspiele der New York Yankees, die jüngste Schlappe gegen die Red Sox, und dass die großen Zeiten der Yankees wohl nicht mehr wiederkommen seit der großartige Babe Ruth seine Karriere beendet hat. Dann wenden sie sich den Ereignissen in Europa zu und ob Frankreich und England tatsächlich Deutschland mit ihren Landstreitkräften angreifen werden. Bisher hatte die Royal Air Force nur ein paar deutsche Kriegsschiffe vor Wilhelmshaven angegriffen und dabei die Hälfte ihrer Flugzeuge verloren. Zudem hatten sie damit begonnen ein britisches Expeditionsheer in Frankreich zu stationieren. Die Franzosen und die Deutschen beschossen sich gelegentlich über den Rhein hinweg. Die Presse nannte das Sitzkrieg. Hitlers U-Bootwaffe hingegen wurde allmählich zu einer ernsthaften Bedrohung für die Briten. Dutzende von Handelsschiffen hatten die Deutschen inzwischen versenkt und angeblich waren sogar ein britisches Schlachtschiff und ein Flugzeugträger deutschen Torpedos zum Opfer gefallen. Die überseeischen Versorgungswege der Briten sind trotz ihrer überlegenen Flotte ausgesprochen gefährdet.
„Amerika sollte den Briten rechtzeitig helfen, sonst erobert Hitler ganz Europa“, wirft Victor ein. „Nein Amerika darf sich nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen“, beteuert Charly. „Wenn Roosevelt könnte, würde er den Briten helfen, aber das ist im Kongress wohl kaum durchsetzbar. Hoffentlich setzen die Briten endlich Neville Chamberlain, diesen Zauderer, ab und Winston Churchill als Premierminister ein. Der würde Hitler schon im Zaum halten“, bewertet Victor die Situation. „Gut möglich, aber wenn die Deutschen mit ihren U-Booten die Versorgung der Insel blockieren, kann Churchill auch nichts machen.“ „Wir sollten auch die Japaner nicht vergessen. Die Schlitzaugen breiten sich in China immer weiter aus und sind zudem mit Deutschland verbündet“, merkt Victor an. Letztendlich kann Amerika nichts passieren, von den einen trennt uns der Atlantik und von den anderen der Pazifik und auf die Rohstoffe aus anderen Ländern sind wir auch nicht angewiesen“, erklärt Charly. Verhaltenes Lachen. Man prostet sich zu. „Auf unser großartiges Amerika!“
„Joe wird jetzt übrigens Boxer“, meldet Linda sich unvermittelt. „Tatsächlich?“, fragt Victor interessiert, „wo trainierst du?“ „In Harlem, habe dort im letzten Jahr einen Boxtrainer kennengelernt.“ „Einen Neger?“ „Ja.“ „Das sind ziemlich gute Boxer, trotzdem wäre ich vorsichtig dort in Harlem“, warnt Steve. „Ach, Cooper ist in Ordnung, ich habe doch seinen kleinen Sohn vor ein paar Wochen aus dem Harlem-River gezogen und vor dem Ertrinken gerettet“, berichtet Johannes. „Cooper? Etwa Cooper Mocala?“, fragt Victor. „Ja, kennt ihr ihn?“ „Klar kennt man den in New York. Das war mal ein richtig guter Boxer, ist vor drei oder vier Jahren nach einer Verletzung aus dem Profisport ausgestiegen.“ „Glückwunsch, wenn Mocala dein Trainer ist.“ Als sie sich kurz darauf alle verabschieden, hält Johannes Roses Hand ein wenig zu lange fest und wirft ihr einen fragenden Blick zu. Sie lächelt schüchtern, entzieht ihm ihre Hand, hakt sich bei Linda ein und geht mit ihr davon.
„Post für dich, Joe“, ruft Linda ihm durch den Küchenlärm zu und reicht ihm ein Couvert. Johannes Herz schlägt bis zum Hals, eine französische Briefmarke. Mit zitternden Händen reißt er das Couvert auf. Der Brief ist in fast fehlerfreiem Französisch geschrieben, unverkennbar Rebeccas winzige Schrift. Sie habe sich sehr über seinen letzten Brief gefreut, sei aber umso trauriger, dass sie nun durch den Atlantik getrennt seien. Vielleicht sei der Krieg ja bald vorbei, obwohl in Paris eine große Sorge vor einem deutschen Angriff zu spüren sei. Ihr Französisch sei inzwischen ganz passabel. Mutter gehe es nicht gut, alles sei zu aufregend für sie. Sie wohnen immer noch in einem Hinterhof der Rue Pastourelle im dritten Arrondissement und leben von der Hand in den Mund, weil viel Geld für den Arzt und die Medikamente für Mutter gezahlt werden musste. Ein paar Francs habe sie durch Gelegenheitsarbeiten in einem jüdischen Geschäft verdienen können. Um dauerhaft davon zu leben, reicht es bei weitem nicht. Sie vermisse ihn so sehr und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen in besseren Zeiten. Johannes ist sehr ergriffen, was Linda nicht entgeht. „Schlimme Neuigkeiten?“, fragt sie. „Nein, ganz im Gegenteil.“ Mehr erzählt er ihr nicht. Gleich am Abend schreibt er Rebecca einen weiteren Brief, diesmal ebenfalls auf Französisch, erwähnt, dass die Normandie noch immer im New Yorker Hafen läge, seit Kriegsausbruch nicht mehr in Fahrt gekommen sei. Wer weiß, vielleicht würde er eines Tages mit diesem Schiff den Atlantik überqueren und zu ihr kommen – oder sie zu ihm.
Mit eiserner Disziplin zieht Johannes sein Boxtraining durch. Dreimal in der Woche fährt er frühmorgens mit der Subway nach Harlem hinauf und trainiert dort zwei Stunden. Nie mehr sollten irgendwelche Schlägertypen ihm etwas anhaben können.
Als er an einem milden Frühlingstag in Mocalas Boxclub eintrifft begrüßen ihn einige der anderen Boxer mit einem freundlichen Zunicken – immerhin! Andere sind weiterhin misstrauisch, wollen keinen Weißen in ihren Reihen. Gegenseitig begrüßen sich die Schwarzen mit: „Hey Bruder!“ und dem obligatorischen Zusammenstoßen der rechten Fäuste. Die ersten Trainings waren schwierig bis entmutigend für Johannes, weil er kaum Fortschritte machte, aber Cooper ist sehr geduldig und hat sich fest vorgenommen einen passablen Boxer aus ihm zu machen. Inzwischen verbindet die beiden eine echte Freundschaft. „Heute ist dein erster Trainingskampf, Joe!“, erklärt Cooper ihm, nachdem er sich am Boxsack warmgemacht hatte. „Meinst du, ich bin schon soweit?“, fragt er unsicher. Cooper grinst. „Leroy, du kämpfst heute gegen Joe!“ ruft er einen von jenen Boxern zu, die Johannes wohlgesonnen sind. Leroy kommt lässig und selbstsicher herangeschlendert. Er hat ungefähr Johannes’ Statur. Die beiden steigen in den Ring. „Im Kampf musst du hochkonzentriert aber niemals blindwütig sein, dennoch sportlich fair. Denk immer dran, du willst ihn besiegen.“ Leroy grinst ihn überlegen an. Cooper läutet die erste Runde ein. Leroy schlägt mehrmals unerwartet schnell zu, aber Johannes wehrt die Schläge ab, ist allerdings schon nach wenigen Sekunden in seine Ecke gedrängt. „Leroy! Mach das Weißbrot fertig!“, brüllt jemand. „Denk dran, was ich dir beigebracht habe, Joe! Denk an deinen ärgsten Feind!“, feuert Cooper ihn an. Willi Hamester, genannt Hammer, ein übler Schläger aus seiner Zeit in Hamburg, erinnert Joe. Die nächsten 30 Sekunden verlaufen in der Tat etwas günstiger für ihn. Es gelingt ihm einen harmlosen Treffer anzubringen und seine Beweglichkeit besser einzusetzen. Kurz vor Ende der ersten Runde trifft Leroy jedoch zweimal kurz hintereinander. Der zweite Treffer lässt ihn zurücktaumeln. Nach der Pause greift Leroy mit unverminderter Härte an. Die ganze Runde über ist Johannes in der Defensive. Er steckt einen weiteren Treffer ein und merkt, dass Kraft und Konzentration bereits nachlassen. „Nicht schlecht, Joe, das wird schon! Deine Chance ist die Beweglichkeit. Eine Runde noch, dann ist Schluss. Versuch ihm noch ein, zwei ordentliche Dinger zu verpassen, locker aus den Schultern!“, muntert Cooper ihn auf. Aber die dritte Runde verläuft für Johannes ebenfalls in der Defensive. Dennoch kann er weitere Treffer verhindern. Nach dem Gong gibt es Applaus und einige wohlmeinende Zurufe für ihn. Leroy bietet ihm freundschaftlich die Faust zum Abschlagen und grinst noch genauso wie vor dem Kampf. Johannes blutet an den Lippen. Cooper nimmt ihn beiseite. Leroy hätte nach Punkten klar gesiegt, in der vierten Runde wärst du wahrscheinlich zu Boden gegangen, aber deine Beweglichkeit und dein Gleichgewicht sind gut, die Deckung einigermaßen aber die Offensivkraft lässt zu wünschen übrig“, lautet das Urteil seines Trainers. „Außerdem werden wir jetzt gezielt an deiner Schnellkraft und Kondition arbeiten.“
Erst kurz bevor Harveys Restaurant am späten Vormittag im Mai 1940 öffnet, stürzen Linda und Rose, bepackt mit Einkaufstaschen, herein. Sie tragen leichte Sommerkleider, modische Hüte und hochhackige Schuhe. „Ihr glaubt nicht, was heute in den Kaufhäusern los war?“, ruft Rose ganz aus der Puste Johannes und den beiden Hilfsköchen zu, die im Restaurant letzte Vorbereitungen vor der Öffnung treffen. „Schaut mal, meine neuen Nylonstrümpfe, seit heute gibt es die zu kaufen. Sind viel billiger und haltbarer als Seidenstrümpfe und sehen trotzdem genauso schick aus. Die Mädels haben sich fast totgetreten in den Kaufhäusern, weil heute jede Frau nur zwei Paar bekommt. Bestimmt sind die Nylons morgen ausverkauft. Aber wir haben jede gleich vier Paar ergattert, weil wir uns erst bei Macy’s an der 34th Street und anschließend gleich bei Bloomingdales angestellt haben. Bei Saks an der 5th Avenue waren sie leider schon ausverkauft. Sind die nicht schick?“ Sie dreht sich im Kreis herum, zieht ihr Kleid bis über die Knie nach oben und zeigt ihre wohlgeformten Beine in den transparent, glänzenden Strümpfen. Sie wirft Johannes einen kurzen Blick zu. Der kann die Augen nicht von ihr lassen. Die Nähte an der Rückseite der Strümpfe lassen ihre Beine endlos erscheinen. Einer der Hilfsköche stößt einen anerkennenden Pfiff aus. „Hey, ihr seht aus wie Hollywood Stars!“ Linda geht noch einen Schritt weiter, zieht ihr Kleid soweit nach oben, dass der apart verstärkte Rand ihrer Strümpfe sichtbar wird und tänzelt mit anmutigen Bewegungen durch den Raum. Die Männer kommen heran, ihnen fallen fast die Augen aus dem Kopf. Dann hören sie Harveys Stimme, wie er dem Koch Anweisungen erteilt aus dem Nebenraum. Schnell fallen die Kleidersäume wieder auf Kniehöhe. Die Frauen verschwinden eilig, um sich umzuziehen. Eine dreiviertel Stunde später stöckelt Erica Hals über Kopf herein. Harvey raunzt sie an: „Reichlich spät, Erica, das ziehe ich dir vom Lohn ab!“ „Tut mir leid, Mister Harvey, musste noch dringend etwas besorgen.“ Auch ihre Beine glänzen verdächtig.
Wenige Tage darauf trifft Johannes sich mit Lindas Bruder im Green Crocodile am Tompkins Square. Victor wirft eine Münze in die prachtvolle Wurlitzer Musikbox. Die Mechanik hinter der Glasscheibe hebt eine Schallplatte aus dem Magazin und befördert sie auf den Plattenteller. Kurz darauf erklingt In The Mood von Glenn Miller, jene Melodie, welche zurzeit ganz New York, wahrscheinlich sogar ganz Amerika vor sich hin summt. Victor ist Taxiunternehmer und hat ebenfalls erst spät am Abend Feierabend. Er scheint der einzige unter Johannes’ amerikanischen Freunden zu sein, der sich näher für die Vorgänge außerhalb der USA interessiert. „Frankreich ist verloren“, verkündet er nach einem kräftigen Schluck Bier. „Ich habe es gelesen, Hitlers Truppen haben große Teile der französischen Armee und das britische Expeditionskorps an der Kanalküste eingeschlossen. Nur noch eine Frage von Tagen bis sie zur Kapitulation gezwungen sind“, … und Hitler Paris besetzen wird. Hoffentlich können Rebecca und ihre Mutter fliehen, aber wohin? denkt er, spricht es aber nicht aus. „Wenigstens haben die Briten Churchill endlich zum Premierminister berufen“, merkt Victor an. „Wenn es Hitler gelingt, die britische Insel zu erobern, ist ganz Europa verloren.“ „Allerdings, und der englische Kanal ist an der schmalsten Stelle nicht breiter als die Chesapeake Bay.“ „Meinst du Amerika erklärt Deutschland den Krieg, wenn sie England besetzen?“ „Nein, die Amerikaner wollen nicht in einen Krieg hineingezogen werden. Möglicherweise geben wir unsere Neutralität auf und rüsten die Armee hoch, aber aktiv in den Krieg eintreten, das kann ich mir nicht vorstellen“, erklärt Victor. Nach einem weiteren Schluck Bier fragt er unvermittelt: „Was läuft da eigentlich zwischen dir und Rose?“ „Woher? … ach konnte dein Schwesterherz ihren Mund nicht halten?“ Victor grinst. „Die Spatzen pfeifen es von den Dächern.“ „Sie ist ein sehr nettes und attraktives Mädchen“, bemerkt Johannes. „Und ein sehr freizügiges obendrein!“, ergänzt Victor und grinst verschworen. Die Sache in der Silvesternacht war offensichtlich nicht unentdeckt geblieben. „Liebst du sie?“ Er zögert. „Ich mag sie sehr gern.“ „Dann geh’ doch mal mit ihr aus!“ „Ich kann ihr nichts bieten, Victor, ich bin ein armer Schlucker“, beteuert Johannes. Dass es drüben in Europa eine Frau namens Rebecca Weintraub gibt, die er liebt, hat er bisher niemandem seiner amerikanischen Freunde anvertraut. „Aber Rose glaubt an dich und sie macht sich gewisse Hoffnungen, Joe.“ „Ich weiß nicht“, entgegnet Johannes unsicher. Er denkt erneut an Rebecca, und den Brief, den er im Januar von ihr bekommen hatte. Seitdem hatte er nichts mehr von ihr gehört. „Joe, wenn du eine Amerikanerin heiratest, sollte es mit der Einbürgerung weniger Probleme geben“, reißt Victor ihn aus seinen Gedanken. „Entschuldige Victor, ich muss darüber nachdenken“, weicht er aus. „Möglicherweise ringt sich Mister Harvey ja irgendwann zu einer persönlichen Bürgschaft für mich durch und ich erhalte meine offizielle Arbeitserlaubnis und vielleicht auch meine Einbürgerung.“ „Harvey wird niemals für dich bürgen. Wahrscheinlich würde es auch gar nichts nützen. Heirat ist eine Möglichkeit, andernfalls benötigst du für die Einbürgerung ein sogenanntes Affidavit, eine persönliche Bürgschaft eines in den Vereinigten Staaten lebenden Verwandten oder einer wichtigen Persönlichkeit. Außerdem wäre Harvey ja schön blöd. Dann könnte er dich ja nicht mehr so gut ausbeuten wie bisher. Du würdest bei ihm kündigen und in einem der besseren Hotels an der 5th Avenue Arbeit finden oder sogar auf einem amerikanischen Passagierdampfer anheuern und gutes Geld verdienen.“ „Ich weiß, aber was soll ich tun? Außerdem habe ich es immer noch besser als die meisten Immigranten.
Ich kann mich in Harveys Küche jeden Tag satt essen und habe ein Dach über dem Kopf. Und wenn er mir nicht die warme Kleidung geschenkt hätte, wäre ich im Winter wohl erfroren. Außerdem sind die Kollegen zu einer Art Familie für mich geworden.“ Victor nickt bedächtig, als ob er längst wüsste, was zu tun wäre.