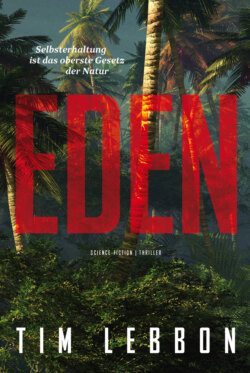Читать книгу Eden - Tim Lebbon - Страница 15
8
Оглавление»Russland war uns allen natürlich voraus. 1917 schuf Zar Nikolaus II. das erste Sapowednik, grob übersetzt ein ›striktes Naturschutzgebiet‹. Was es doppelt traurig macht, dass Zona Smerti so schwer durch menschliches Eingreifen geschädigt wurde.«
Professor Amara Patel, Natural History Museum, London
Sie aßen im Gehen. Während die Sonne im Westen über einer zerklüfteten Bergkette unterging, begann Dylan zu verstehen, warum er Eden so beunruhigend fand, und alles, was er sah, roch und an seiner Haut spürte, bestätigte es.
Genau wie Selinas Enthusiasmus und Begeisterung. Eigentlich ruhig und zurückhaltend, wurde sie immer lebhafter, je weiter sie gingen. Sie sah Dinge, die niemandem sonst auffielen, und sprach ihre Beobachtungen untypischerweise aus.
Es sind all die kleinen Dinge, dachte Dylan. Die winzigen Veränderungen, die meisten davon unbemerkt, summieren sich zu etwas Größerem. Darum fühlt sich dieser Ort so seltsam an.
Selinas Arbeit auf dem Gebiet der Umweltwissenschaften manifestierte sich in der Besorgnis über das Artensterben und die Auswirkungen von menschlichem Eingreifen in die Natur. Es war ihre Passion und Ursache ihrer sie regelmäßig heimsuchenden Depressionen. Während sie sich durch die Landschaft bewegten, ging sie oft voraus, um etwas Zeit zu haben, einen Baum, eine Pflanze, eine Spur auf dem Boden oder eine Blume genauer zu untersuchen, bis die anderen aufgeholt hatten. Sie machte sich hastige Notizen und lief mit ihnen weiter, ihre Augen voller Ehrfurcht über ihre Funde.
»Was hast du gesehen?«, fragte Dylan, als sie einen langen, flachen Hang zum weiten Talboden hinunterstiegen.
»Vieles, was ich erwartet habe«, sagte sie. »Aber auch eine Menge Dinge, die ich mir niemals hier hätte vorstellen können. Es gibt hier wieder Pflanzen im Überfluss, die aus solchen Landschaften eigentlich schon vor vielen Hundert Jahren verschwunden sind. Der Boden ist immer noch basischer, als er sein sollte, aber die Zone scheint sich zu erholen. Sich von unserer Berührung zu befreien.« Sie sprang über einen umgestürzten Baum. Dylan musste mühselig darübersteigen und laufen, um sie wieder einzuholen.
»Seht euch nur den alten Mann an«, rief Gee von hinten.
»Ich bin auch zwei Jahre älter als du, mit einem kaputten Knie«, sagte Dylan.
»Dann bleib das nächste Mal daheim, Opa, und wir rufen dich an, wenn wir fertig sind!« Gee lachte auf diese Art, die sonst immer so ansteckend war.
»Seht euch mal den Kerl mit der falschen Hand im Arsch an«, rief Dylan und diesmal lachten alle. Dylan holte Selina ein. »Was sonst noch? Hab dich schon lange nicht mehr so aufgeregt gesehen.«
»Es ist fast so, als wäre das hier der perfekte Ort für mich!«, sagte Selina und die Fröhlichkeit in ihrer Stimme ließ ihm ganz warm ums Herz werden. Ihr Leben war normalerweise so von Fakten und Zahlen über die negativen Auswirkungen der Menschheit auf die Natur beherrscht, dass solche Freude selten war. Dylan sagte oft, dass es sehr selbstlos von ihr war, diese Dinge zu lehren und sich von ihnen ständig herunterziehen zu lassen. Sie nannte es Realität.
»Aber findest du das nicht ein bisschen seltsam?«, fragte Jenn. Sie lief neben ihnen her, angelockt von ihrer Unterhaltung. Er wusste, dass sie das Gleiche spürte wie er und dass der Rest der Gruppe ebenfalls von Eden verunsichert war.
»Absolut«, stimmte Selina zu. »Aber auf wunderbare Weise.« Sie lief wieder vor, überholte Aaron und sah sich um, als sie einen abfallenden Waldboden überquerten. Große Dornenbüsche rissen an ihrer Kleidung und Dylan hatte bereits ein Dutzend Kratzer an den Schienbeinen und Waden, aus denen kleine Bluttropfen drangen. Ihm machte das nicht viel aus. Es gefiel ihm, die Natur und Umgebung zu spüren, durch die er kam. Selbst hier.
»Schaut mal«, sagte Selina und deutete auf einen Baumstamm.
Keuchend blieben sie hinter ihr stehen und waren froh über die kurze Atempause. Es war immer noch warm, obwohl die Sonne schon fast hinter den westlichen Bergen verschwunden war.
»Was sehe ich mir an?«, fragte Jenn.
»Duftmarkierungen«, erklärte Selina. Sie duckte sich und ging näher heran, roch an der nachgedunkelten Rinde und untersuchte den Boden um den Baum. »Ziemlich gewöhnlich.«
»Sie schnüffelt an Pisse«, murmelte Gee.
»Was hat sie hinterlassen?«, fragte Dylan.
»Wölfe, denke ich.«
»Was?« Cove sah sich um, als erwarte er, graue Gestalten in den Schatten zu entdecken, die sie beobachteten, um sie zu jagen.
»Hier gibt es seit über hundert Jahren keine Wölfe mehr«, sagte Lucy.
»Genau«, entgegnete Selina. »Und doch sind hier diese Spuren.«
»Könnten einfach nur wilde Hunde sein«, bemerkte Aaron. »Vielleicht wurden welche zurückgelassen, als Eden eingerichtet wurde, und vielleicht haben sie sich über die Jahre hinweg vermehrt und wild gekreuzt.«
»Möglich.« Selina klang nicht überzeugt.
»Hätte sie nicht jemand hierherbringen müssen?«, fragte Jenn. »Die tauchen doch nicht einfach so aus dem Nichts auf.«
Selina antwortete nicht. Sie machte sich ein paar Notizen, dann stand sie auf und sah an ihnen vorbei in den umliegenden Wald.
»Lasst uns weitergehen«, sagte Dylan. »Die Sonne berührt die Gipfel und ich will es bis auf die andere Seite des Tals schaffen, bevor wir unser Lager aufschlagen.«
Das Blätterdach und der üppige Baumwuchs schränkten ihre Sicht auf die Landschaft ein, während sie dem sanften Hang nach unten folgten, doch Dylan war sich ihrer Richtung sicher. Er behielt die Sonne im Blick, Lucy warf alle halbe Stunde einen Blick auf ihren Kompass und sie kamen gut voran. Das Gerede von Wölfen faszinierte ihn, denn auch wenn es gefährliche Tiere sein konnten, glaubte er nicht, dass in Eden hungrige Wölfe herumliefen.
Es gab keine Pfade, denen sie folgen konnten, und gelegentlich wurden sie von breiten Streifen dichten Unterwuchses aufgehalten. Sie hatten keine Buschmesser mitgebracht, also konnten sie sich ihren Weg nicht freihacken. Stattdessen umgingen sie diese Stellen, wenn möglich, oder gingen zurück und suchten nach einer alternativen Route.
Selina machten diese Verzögerungen nichts aus. Sie war so daran gewöhnt, sich mit dem Team zu bewegen, dass es ganz natürlich für sie war, Teil dieser Gruppe zu bleiben, doch ihre Konzentration war hauptsächlich auf ihre Umgebung gerichtet. Dylan blieb in ihrer Nähe und genoss, wie ihr Enthusiasmus zum Vorschein kam. Sie hatte akzeptieren müssen, dass sich die Menschheit auf einer Abwärtsspirale befand und dass Leute wie sie nur sehr wenig tun konnten, um diesen Abstieg aufzuhalten. Sie hatte Dylan mal erzählt, dass sie in ihrer Jugend immer davon geträumt hatte, etwas bewirken zu können.
Was immer das zwischen ihnen war, wurde von ihren regelmäßigen Depressionsschüben überschattet, einer Folge ihrer Studien. Er half ihr hindurch so gut er konnte und wusste, dass sie seine Bemühungen zu schätzen wusste. Nun hoffte er, dass sie hier in Eden etwas von dieser verlorenen jugendlichen Zuversicht und Positivität wiederfinden würde.
Als sich der Abend näherte, erreichten sie das Ufer eines Flusses. Dylan setzte eine Pause an, die sie fürs Trinken und Essen nutzten. Während sie auf ihren Energieriegeln und Gelen herumkauten, stellte Cove mittels eines Schnelltests fest, dass das Wasser trinkbar war. Sie füllten ihre Trinkflaschen und -blasen auf und gaben Reinigungstabletten hinzu. Dylan zog seine Karte heraus, faltete sie auseinander und versuchte, sich zu orientieren, wo sie waren. Lucy stand neben ihm und drehte sich langsam nach rechts und links, bis die Karte und der Kompass übereinstimmten. Dylan stimmte ihre Position noch mit ein paar lokalen Orientierungspunkten ab – einem Hügel, einem Knick im Fluss ein paar Hundert Meter vor ihnen.
Etwas stimmte nicht.
»Was ist?«, fragte Jenn.
»Wir hätten entlang des Flusses auf eine Straße treffen müssen«, sagte er, sah zu Boden und strich mit der Schuhspitze über das lange Gras. Die anderen hörten schweigend zu.
»Es gibt Eden schon lange genug, um Straßen zu verschlucken«, sagte Selina. »Das wissen wir. Selbst in viel jüngeren Zonen haben wir das schon gesehen.«
»Ja, aber wo ist die Brücke?«, fragte Dylan. Er zeigte ihr die Karte und nachdem Selina sie mit dem Kompass abgeglichen hatte, brummte sie.
»Ja. Stimmt. Hier sollte eine Brücke sein.«
Der Fluss war nicht breit, aber die Strömung war stärker als die des ersten, den sie durchquert hatten, um Eden zu betreten. Laut der Karte handelte es sich um einen Nebenfluss dieses Stroms, der fünfundzwanzig Kilometer entfernt in den westlichen Hügeln entsprang und über eine Reihe von Wasserfällen und Stromschnellen herabführte, bis er zehn Kilometer weiter östlich in den Hauptfluss mündete.
»Und eine Raststätte, da drüben«, sagte Dylan und deutete über das Wasser. »Restaurant, Parkplatz, ein paar Läden.«
Dort war nichts.
»Schauen wir uns das mal an«, schlug Cove vor. »Wir müssen sowie irgendwie über den Fluss kommen.«
Sie gingen stromaufwärts, so nah am Ufer entlang, wie sie konnten. Sie waren hier im Überschwemmungsgebiet, es gab nicht viele Bäume und es war angenehm, im Freien zu sein und die letzten Strahlen des dämmrigen Sonnenlichts abzubekommen. Sonst genoss Dylan das Geräusch von Wasser, doch dieser tosende Fluss verstärkte lediglich sein Gefühl subtiler Paranoia. Im Unterholz konnte alles Mögliche herumschleichen und sie würden es durch das beständige Dröhnen gar nicht mitbekommen.
Er sah, wie sich ein paar der anderen ebenfalls umsahen. Er stellte Blickkontakt zu Aaron her. Er war wachsam und vorsichtig und das ließ Dylan ein wenig entspannen. Aaron hatte einen militärischen Hintergrund und auch wenn er nie viel darüber sprach, strahlte er ein Selbstvertrauen aus, das Dylan ein Gefühl der Sicherheit vermittelte.
Aaron blinzelte, runzelte die Stirn und sah zu Boden.
»Hab was gefunden.« Er kniete sich hin und riss ein paar Grasbüschel und Dornenranken heraus, sodass ein verrosteter Metallpfosten sichtbar wurde, der ein paar Zentimeter aus dem Boden ragte. Obwohl sie erst seit ein paar Stunden in Eden waren, war es ein seltsamer Anblick. Die erste gerade Linie, die sie an diesem Ort gesehen hatten.
»Eine Straßensperre?«, fragte Cove.
»Vielleicht. Ist zu verrostet, um was zu erkennen.« Aaron zerrte an dem Objekt. Es bewegte sich nicht. »Ist auch ziemlich tief vergraben.«
»Jetzt wissen wir, was aus der Straße geworden ist«, sagte Lucy. »Wir gehen darauf.«
Es fühlte sich nicht so an, als würden sie einer Straße folgen, aber während sie weiter stromaufwärts gingen, fanden sie zwei weitere Objekte, die darauf hindeuteten, dass dem so war. Dylan hielt das erste irrtümlich für einen toten Baum, umwickelt von Kletterefeu und das Zuhause zweier Eichhörnchen, die von hoch oben ihr Näherkommen beobachteten. Erst als sie näher kamen, machte sie Gee auf die zerschlagene Glühbirnenfassung am oberen Ende des Laternenpfahls aufmerksam. Sie lag nur teilweise frei, die zurückgebliebene Plexiglasscheibe war von grünem Schimmel überzogen und nur die vertraute Form machte es offensichtlich. Eines der Eichhörnchen kletterte den Pfosten hinauf und setzte sich auf die vorstehende Spitze, als wollte es sie verhöhnen.
»Andere sehe ich nicht«, sagte Aaron, der sich entlang des Flusses umschaute.
»Nein, aber hier ist noch was.« Lucy lief ein paar Meter vor zu einer Böschung. Eine Seite war mit großen pinken Blumen gesprenkelt und eine Pflanze mit winzigen blauen Blüten schlängelte sich durch den Hügel. Es war eine herrliche natürliche Farbpalette, doch Lucy hatte etwas anderes als die Blumen entdeckt. Als Dylan und die anderen ihr folgten, versuchte er zu erkennen, was es war.
»Wie zum Teufel hast du das gesehen?«, fragte Gee. »Hast du ein Roboterauge oder so was?«
»Ein Roboterherz«, sagte Cove, eine gedankenlose, aber heikle Bemerkung. Lucy zeigte ihm den Mittelfinger, ohne den Blick von dem zu nehmen, was sie gesehen hatte.
»Wie lange willst du uns noch auf die Folter spannen?«, fragte Dylan.
»Schaut.« Lucy deutete auf eine Seite der Böschung, dann bewegte sie ihren Arm nach oben. Dylan folgte ihm und sah es.
»Eine Antenne?«, fragte er.
»Ich schätze schon. Da ist ein altes Auto drin.«
»Quatsch«, sagte Gee. Er kam näher, trat gegen einen Busch, verfing sich mit dem Fuß und fiel auf den Rücken. Cove lachte. Aaron drehte Gee auf die Seite und half ihm dann auf.
»Komm schon, alter Mann.«
Es gab nichts zu sehen. Vielleicht war es eine Antenne, vielleicht aber auch nur der dünne, nackte Stiel einer toten Pflanze. Das Objekt lag zu weit im Strauchwerk, um heranzukommen, und Dylan verspürte den plötzlichen Drang weiterzugehen. Sie verschwendeten Tageslicht.
»Wir müssen diesen Fluss überqueren«, entschied er. »Ich hatte gehofft, dass zumindest ein Teil der Brücke noch steht. Aber wenn nicht, müssen wir stromaufwärts gehen, bis wir eine sichere Stelle finden.«
»Das könnte Stunden dauern«, sagte Cove. »Warum schwimmen wir nicht rüber?«
»Bist du übergeschnappt?«, blaffte Lucy.
Gemein, dachte Dylan, kommentierte es jedoch nicht weiter. »Wir schwimmen nicht rüber«, sagte er. »Du weißt, dass wir hier auf uns allein gestellt sind, Cove. Wir gehen keine dämlichen Risiken ein. Zügle deine Ambitionen.«
»Ich könnte auf die andere Seite schwimmen und …«
»Es spielt keine Rolle, dass du der beste Schwimmer unter uns bist«, sagte Dylan und mehr war nicht nötig. Coves Arroganz hatte Grenzen und er erkannte immer Dylans Autorität als Teamleiter an. Er presste die Lippen zusammen und nickte.
»Soll ich vorangehen?«, fragte Lucy.
»Folge dem Fluss«, antwortete Dylan.
Während sie sich in Bewegung setzten, passte Dylan bereits seine Pläne für die beabsichtigte Position ihres ersten Nachtlagers an. Er sah sich um und suchte nach Spuren von Kat. Sie hatte sich jahrelang von ihm ferngehalten und er hatte den Moment, als sie ihn verlassen hatte, nie vergessen. Er war in seine Seele eingebrannt.
»Nur eine Woche«, hatte sie gesagt. »Allerhöchstens zehn Tage.«
»Aber du hast diese Reise vorher nie erwähnt«, hatte er erwidert. »Nicht mal angedeutet. Keine Karten, keine Diskussionen, keine Planung.« Er wusste, dass er nach Strohhalmen griff. Die Kälte zwischen ihnen war seit langer Zeit gewachsen, eine unerklärliche Distanz, die irgendwie direkt mit den zahllosen Kilometern zu tun zu haben schien, die sie zusammen auf ihren Abenteuern rund um den Globus gelaufen, gegangen, gesegelt, gefahren und geflogen waren. Obwohl sie überall zusammen hinreisten, waren sie nie weiter voneinander getrennt gewesen. »Hast du es Jenn erzählt?«
»Natürlich nicht«, antwortete sie. Dylan wusste, dass hier etwas anderes mit im Spiel war, und das bestätigte es. Wenn es nur zehn Tage wären, hätte sie es Jenn erzählt, dachte er, konnte jedoch einfach nicht glauben, dass Kat ihn endgültig verließ. Eine Pause vielleicht. Eine Trennung auf Zeit, erzwungen durch einen oder zwei Kontinente zwischen ihnen. Aber doch nicht für immer.
»Ich weiß nicht, was passiert ist«, sagte er und ein paar Sekunden lang dachte er, dass ihre kühle Fassade bröckelte, dass das Eis, das sich zwischen ihnen gebildet hatte, wieder schmelzen würde, sodass sie einander erreichen und berühren konnten wie zuvor. Dann verhärtete sich ihr Gesicht und ihr Blick wurde distanziert.
»Eine Woche, zehn Tage«, wiederholte sie und erstickte damit jede Hoffnung auf eine Diskussion.
»Ich glaube dir nicht.«
Kat fuhr damit fort, ihre Sachen zu packen. Sie nahm ihren Lieblingsrucksack, den er ihr in Kanada gekauft hatte, und verstaute die Laufausrüstung darin, obwohl er schon so voll mit Erinnerungen war.
»Lass uns darüber reden«, bat Dylan. »Was auch immer zwischen uns passiert ist, wir hätten schon vor Jahren darüber reden sollen. Lass uns das jetzt tun. In aller Ruhe.«
»Da ist nichts«, beharrte Kat und schenkte ihm ein seltsam trauriges Lächeln, bevor sie den Raum verließ. Dylan hatte dieses Lächeln nie vergessen, weil er es noch nie in ihrem Gesicht gesehen hatte und er dadurch verstanden hatte, dass sie zu einer Fremden geworden war. Er hätte ihr nachgehen können. Hätte sie davon abhalten können, ihre Mietwohnung zu verlassen, mit ihr reden, sie anbetteln können, zu warten, bis sich der Sturm in ihren aufgewühlten Gedanken gelegt hatte. Doch er hatte sie gehen lassen und niemals wiedergesehen.
Später war ihm klargeworden, dass sich ihre letzte Bemerkung wahrscheinlich nicht auf die Distanz bezogen hatte, die zwischen ihnen entstanden war. Was Kat anging, war es eine Zusammenfassung dessen gewesen, was von ihrer Beziehung übrig geblieben war. Er hatte viel Zeit mit dem Versuch verbracht, zu verstehen, was schiefgelaufen war. Manchmal gab er sich selbst die Schuld, manchmal überlegte er, ob Kat gestörter war, als ihm klar gewesen war. So musste es gewesen sein. Schließlich war sie spurlos aus seinem und Jenns Leben verschwunden.
In den nächsten drei Jahren hatte er gelegentlich von ihr gehört, kurze, unangenehme Telefonate, bei denen keiner von ihnen viel sagte – sie, weil sie nicht wollte, er, weil er nicht wusste, was. Und dann war Kat für immer aus ihrem Leben verschwunden.
Doch nun schien es, als hätte sie Jenn in ihrem Herzen behalten. So sehr er sich angesichts dieses Umstands auch Entschuldigungen für Kat ausdachte – und so sehr er sich auch für Jenn freute –, war das ziemlich gefühlskalt. Schlicht und einfach grausam. Auch wenn ihre Beziehung kompliziert gewesen war, hätte die Zeit alten Streitereien und Feindseligkeiten mit Sicherheit die Schärfe genommen, und er wusste beim besten Willen nicht, was er getan haben sollte, um solch eine Behandlung zu verdienen.
Auch wenn es so aussah, als hätte Kat sie hergelockt, fragte er sich doch, wie sie reagieren würde, wenn sie ihr auf einem bewaldeten Hang begegneten.
So sehr er sich auch bemühte, konnte er sich nicht entscheiden, wie seine eigene Reaktion aussehen würde.