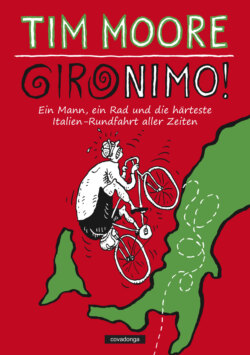Читать книгу Gironimo! - Tim Moore - Страница 6
I
Оглавление»Sie haben etwas, öh, expérience mécanique mit die Fahrräder?«
Der Fragesteller lächelte mich über den fleckigen Boden seiner Garage hinweg an. Überall lagen ausrangierte und zerlegte Maschinen verstreut.
»Ein bisschen«, antwortete ich. »Un peu halt.«
Das war eine unwiderlegbare Tatsache, ausgesprochen im trügerischen Tonfall männlichen Understatements. Ich war ins grüne und feuchte Hinterland der Bretagne gefahren, um diesen Mann namens Max zu treffen und den Berg uralter Fahrradteile zu erwerben, den er zum Kauf anbot. Ich hatte eine Fährüberfahrt im Morgengrauen und mehrere Stunden auf regennassen französischen Landstraßen hinter mir. Ich schaute auf das Durcheinander aus Speichen, Ritzeln, Felgen und Rohren und spürte, wie sich die Zweifel wie hartnäckige Kettenschmiere auf mein Gemüt legten.
»Voilà«, sagte Max, hob eine zerbeulte Dose hohler Vierkantmessingschrauben auf und reichte sie mir. »Très importants!«
Ich nahm die Dose mit einem fachkundigen Lächeln entgegen und dachte: Was zum Geier sind das für Dinger? Oder, etwas genereller formuliert: Warum zur Hölle trieb ich diesen ganzen bescheuerten Aufwand, nur um dann mein Auto – und anschließend mein Eigenheim – mit rostigen Artefakten vollzupacken, deren Bestimmung mir größtenteils schleierhaft war? Und vor allem: Wie hatte ich es bis hierher geschafft, ohne mir ein einziges Mal die aberwitzige Ungeheuerlichkeit des Unternehmens vor Augen zu führen, das ich mir vorgenommen hatte?
Die Hände, die jetzt diese Dose hielten, hatten sich seit dem Zeitalter der Airfix-Modellbausätze nie mehr einer so anspruchsvollen technischen Herausforderung gestellt. Die Beine, die auf dem ölverschmierten Garagenboden anfingen zu zittern, waren zuletzt zwölf Jahre zuvor zu längerem sportlichen Gebrauch herangezogen worden. Und doch hatte ich mir in den Kopf gesetzt, aus den hundert Jahre alten Einzelteilen, die sich nun vor mir auftürmten, ein fahrtüchtiges Fahrrad zu bauen und darauf die 3.162 Kilometer lange Strecke des härtesten Radrennens aller Zeiten zu absolvieren.
Ich gab Max die Dose zurück und fragte ihn, wo seine Toilette sei.
Die Reise, die mich in diese bretonische Werkstatt führte, hatte 60 Tage zuvor begonnen, als ich die vorletzte Seite meiner Zeitung aufschlug und las, dass die US-Staatsanwaltschaft ihre bereits zwei Jahre währenden Ermittlungen gegen Lance Armstrong und sein früheres Team US Postal wegen Verdachts auf systematisches Doping einstellte. Der Artikel schloss mit einem Zitat des bekanntesten und in meinen Augen auch unsympathischsten Radsportlers der Welt. Es fiel zwar für seine Verhältnisse vergleichsweise zurückhaltend aus, war aber immer noch überheblich genug, um meine Backen mit Splittern wütend zermalmter Bran Flakes zu tapezieren. »Es ist die richtige Entscheidung, und ihnen gebührt Anerkennung dafür, sie so getroffen zu haben.«
Im Juni 2000 fuhr ich auf einem Rennrad die Strecke der Tour de France jenes Jahres ab, eines dreiwöchigen Etappenrennens, das Armstrong wenige Wochen später zum zweiten Mal gewann. Sein erster Sieg im Jahr zuvor war mir wie das ultimative Comebackwunder erschienen: vom Kampf gegen den Krebs zum Triumph bei der härtesten körperlichen Prüfung, die es im Sport gibt. Aber als ich bei seinem zweiten Sieg zuschaute – im Fernsehen und bei ein paar Etappen auch vom Straßenrand aus – begann mir irgendetwas gegen den Strich zu gehen. Nicht nur Armstrong selbst, der ohne Zweifel ein Kotzbrocken allererster Güte war, aber beileibe nicht der einzige Fahrer, der auf rätselhafte Weise zuvor wohlverborgene und für den Toursieg unabdingbare Kletterqualitäten in sich entdeckt hatte. Nein, mich beschlich ein eher allgemeines Unbehagen angesichts der relativen Leichtigkeit, mit der selbst durchschnittlich begabte Radprofis eine Herausforderung meisterten, die aus ihren Vorgängern noch zerstörte, stumpfsinnig nuschelnde Wracks gemacht hatte. Mit der körperlichen Prüfung schien es nicht mehr weit her zu sein.
Meine Zweifel erhärteten sich, als ich inmitten einer Schar flaggenbemalter Trunkenbolde am härtesten Abschnitt des Mont Ventoux stand, einer piniengesäumten Passage, die so steil war, dass wir uns eigentlich hätten anseilen sollen. Armstrong war bereits an uns vorbeigesaust, in einer elitären Gruppe von Fahrern, deren Karriereleistungen mittlerweile aus den Geschichtsbüchern gelöscht oder zumindest mit zahlreichen Sternchen und Anmerkungen versehen worden sind. Als kurz darauf zwei seiner Helfer von US Postal vorbeizockelten – unbedeutende Domestiken, deren Tagwerk vollbracht war –, schenkte ihnen kaum jemand Beachtung. Ich allein schaute ihnen mit großen Augen hinterher. Diese beiden Männer hatten ihren Kapitän gerade 140 Kilometer lang ins Schlepptau genommen, über drei Berge hinweg und auch noch in den unbarmherzigen ersten Kehren des Ventoux, und das alles bei einem durchschnittlichen Tempo von 35 km/h. Ich wusste, was sie hinter sich hatten: Einen Monat zuvor hatte ich das Gleiche durchgemacht, wenn auch wesentlich langsamer und ohne dass mir Armstrong ständig im Nacken saß. Die Erinnerungen an jenen schrecklichen, zermürbenden Tag waren noch frisch und ungetrübt, und jetzt gondelten diese beiden Kerle einen besonders behaglichen Abschnitt mit elf Prozent Steigung hinauf und plauderten dabei auch noch ganz entspannt miteinander, eine Hand am Lenker, die andere ein Ohrläppchen kratzend.
Dies ist vermutlich der falsche Ort, um sich lang und breit über den Fluch des EPO und aller anderen Formen des Blutdopings auszulassen, die den professionellen Radsport in den letzten Jahrzehnten besudelt haben. (Für eine ausführliche Erörterung des Themas verweise ich auf Bad Blood von Jeremy Whittle und The Secret Race [dt. »Die Radsport-Mafia und ihre schmutzigen Geschäfte«] von Armstrongs früherem Teamkollegen Tyler Hamilton). Sagen wir einfach, dass all die bösen Gedanken wieder hochkamen, als ich las, dass Armstrong, der schummeligste Schummler aus Schummelhausen, wieder einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen hatte.
Das prägende Erlebnis, das mich zum Radsport brachte, war die Tour de France 1987, die gladiatorengleiche Ankunft von Stephen Roche in La Plagne, als er direkt hinter der Ziellinie zusammenbrach und, mit der Sauerstoffmaske vor dem wächsernen Gesicht und den Blick in weite Ferne gerichtet, viel zu erschlagen war, um zu begreifen, dass seine außergewöhnliche, unmenschliche Leistung ihm den Gesamtsieg so gut wie gesichert hatte. Genau solche Momente waren es, Stephens Mutter möge mir verzeihen, die den Reiz und die ganze Faszination der großen Rundfahrten ausmachten. Als wolle er unterstreichen, wie überholt diese Vorstellung war, musste ich bei der Tour 2001 mitansehen, wie Lance Armstrong angebliche Erschöpfung vortäuschte und theatralisch für die Kameras nach Luft schnappte, bevor er, ohne auch nur ins Schwitzen zu kommen, zum Sieg in Alpe d’Huez eilte.
Dank verbesserter Testmethoden und unter dem Druck öffentlicher Bloßstellungen gelang es in den folgenden Jahren, dem Blutdoping zumindest ein wenig Einhalt zu gebieten. Aber etwas hatte sich verändert, und zwar für immer. Es war nicht mehr nötig, dass sich die Fahrer bis aufs Letzte quälten und schindeten. Die Beine waren frischer und ebenso die Geister. Die Rennen wurden vorhersehbarer, berechenbarer und im wahrsten Sinne des Wortes professioneller. Wenn die Kameras eine Nahaufnahme eines Fahrers einfingen, war dort nur noch selten Leiden zu erkennen. Stattdessen sah man Konzentration.
Der wahre Verlierer des ganzen Schlamassels war natürlich der Sport. Der Sport und ich. Ich hatte mich auf der Tour-de-France-Strecke von 2000 an die erbrecherischen Grenzen meiner Leistungsfähigkeit geschunden, und nun schauten die Leute auf diese hochkonzentrierten, mühelos tretenden Roboter und dachten: Na und? Jedes Rennen, das nicht mit einem Zusammenbruch von rocheanesken Ausmaßen endete, schien meine Leistung zu schmälern. Das Zeitalter von Blut, Schweiß und Tränen – mein Zeitalter – entschwand in die sepiabraungetönte Geschichte.
Drei Monate nach meiner Tour de France fuhr ich nach Manchester, um bei Chris Boardmans Versuch dabei zu sein, Eddy Merckx’ 28 Jahre alten Stundenweltrekord zu brechen. Streng genommen hatte Boardman die Marke schon mehrmals übertroffen und das mit gigantischen Abständen: Vier Jahre zuvor hatte er siebentausend Meter mehr geschafft als die 49,5 Kilometer, die Eddy zu seiner Zeit in 60 Minuten erreicht hatte. Die Intensität seiner Rekordfahrt von 1972 – die er selbst als härteste Strapaze seines Lebens bezeichnete – hatte den großen Mann etwas einbüßen lassen, das er nie wirklich wiedererlangen sollte. Boardman seinerseits war gewiss ein begabter Athlet, aber er war kein Merckx: Vielmehr waren seine Leistungen ein Triumph der Technologie und der windkanalgetesteten Ergonomie einer neuen Ära. Chris Boardman steuerte, die Arme ausgestreckt wie Superman und mit einer großen Plastikträne auf dem Kopf, eine futuristische Kohlefasermaschine mit Scheibenrädern. Eddy Merckx hatte sich einfach seine Lederwürstchenmütze übergestülpt und sich aufs Rad gesetzt.
Kurz nachdem Boardman 56 Kilometer in einer Stunde gefahren war, stellten die Radsportbehörden neue Regeln auf, um die Integrität des Stundenweltrekords zu wahren. Merckx’ Distanz wurde als offizielle Marke wiedereingesetzt. Jeder künftige Rekordversuch würde unter vergleichbaren Bedingungen unternommen werden müssen, also mit althergebrachter Maschine, Ausrüstung und Fahrposition. Als Boardman sich der Herausforderung dennoch stellte, erschien das fast tollkühn. Ich weiß noch, wie ich ihn an der Startlinie auf seinem altbackenen Stahlbahnrad sitzen sah und dachte: Aller Ehren wert, es überhaupt zu versuchen, Chris, aber das packst du nicht. Fast hätte ich Recht behalten. Unter ohrenbetäubendem Jubel im Velodrom katapultierte sich Chris mit einem unglaublichen Kraftakt in den letzten Sekunden noch an Eddys Marke vorbei, um ganze zehn Meter.
Während ich die letzten Bran Flakes löffelte, dachte ich an Boardman und wie es ihm gelungen war, altbewährten Schneid und ebensolches Gerät zu rehabilitieren. Er hatte gezeigt, dass es eben doch möglich war, den Radsport der übertechnisierten und unterkühlten Generation Armstrong zu entreißen, die teilnahmslos ihre elektronischen Schaltungen bediente und den Anweisungen ihrer Pulsmesser und directeurs sportifs im Ohr folgte.
Ich blätterte geräuschvoll die Zeitungsseite um und fühlte ein Kribbeln rechtschaffener Entschlossenheit meine Wirbelsäule hinaufwandern. An jedem anderen Tag wäre dieses neurologische Zucken rasch durch meine Synapsen geflackert und alsbald erloschen. Doch angereichert mit den Worten des Survival-Experten Ray Mears sorgten sie vollkommen unerwartet dafür, mein Hirn mit groben Klumpen ernsthafter Absichten zu verkleben.
Das Interview, das ich zum Abschluss meiner Zeitungslektüre las, brachte zwei zwingende Wahrheiten ans Licht: Zum einen war Ray genauso alt wie ich, zum anderen hing er seinen Tropenhelm an den Nagel. Ray kündigte an, fortan nur noch von vergangenen Abenteuern berichten zu wollen, statt neue Expeditionen zu planen: »Irgendwann erreicht man einen Punkt, an dem man zurückblickt und die Aussicht genießt, weil man sich auf der Leiter nicht mehr so anstrengen muss.« Allmächtiger. Ein Ex-Abenteurer mit 47. War ich auch schon an diesem Punkt angelangt? Von wegen. Du vielleicht, Mears, aber ich hatte noch ein paar Sprossen in mir.
Ich reckte das Kinn und kratzte die borstigen Stoppeln, die darauf wuchsen. Gut, in meinem Alter würde ich wohl nicht mehr im Wald hausen, mich von Baumrinde ernähren und mir aus Singvögeln ein Zelt basteln. Aber gewiss hätte ich noch einige Radkilometer in den Beinen, genug für eine anständige Rundfahrt. Etwas Episches, eine Herausforderung klassischen Zuschnitts. Ein authentisches Abenteuer boardmanscher Prägung, ein Leck-Mich an Lance, ein Tribut an die Helden von damals mit ihren Löwenherzen und käsigen Gesichtern.
Der Stundenweltrekord war etwas, überlegte ich, was Fahrer sich normalerweise gegen Ende ihrer sportlichen Laufbahn vornahmen. Einen solchen krönenden Abschluss wollte auch ich der meinigen verpassen. Ich würde mir ein letztes Mal die Seele aus dem Leib fahren, bevor sie es von alleine tat.
Klar, hätte ich geahnt, dass Lance Armstrong sich in den folgenden Monaten immer tiefer in den Treibsand der Schande hineinstrampeln würde, hätte ich mir – und Ihnen – den ganzen Ärger, der jetzt folgt, ersparen können. Beschweren Sie sich bei Lance. Das machen heutzutage eh alle.
* * *
Wie schön wäre es gewesen, sich meinem Unterfangen in gebührender Weise zu nähern. Beispielsweise durch eine Reihe von Begegnungen in baufälligen Velodromen und mittels der persönlichen Schilderungen von Leid und Ruhm eines greisen Veteranen, die idealerweise auf dem Sterbebett vorgetragen wurden. Aber für einen ungeduldigen Mann im Zeitalter von Google kam das natürlich nicht in Frage.
»Härtestes Etappenrennen aller Zeiten«, gab ich in die Suchmaske ein.
Klick.
Ungefähr 3.900.000 Ergebnisse (0,38 Sekunden)
www.bikeraceinfo.com/giro/giro1914.html
»Der Giro 1914 war zweifellos die härteste große Landesrundfahrt aller Zeiten. Nur acht Fahrer waren in der Lage, dieses atemberaubend schwere Rennen zu beenden.«
Die Bestätigung dieser krassen Einschätzung erhielt ich eine Woche später auf den Seiten einer knappen Zusammenfassung des Rennens, die mit ein paar aussagekräftigen Fotos angereichert war. Das dünne Büchlein war von einem altgedienten italienischen Sportjournalisten in seiner Muttersprache verfasst worden, was gewisse Schwierigkeiten mit sich brachte: 1985 hatte ich einen Kurs in Wirtschaftsitalienisch belegt, um einer umwerfend schönen Frau nah sein zu können, bevor ich ihre beachtlich haarigen Unterarme bemerkte und nach der Hälfte aufgab. Erstaunlicherweise stellte sich diese ausgetrocknete Pfütze an Sprachkenntnissen als ausreichend heraus, um zumindest den Titel von Paolo Facchinettis Abhandlung zu übersetzen. Für Untertitel und Klappentext benötigte ich allerdings eine Online-Hilfe.
DER GIRO D’ITALIA 1914: DER HÄRTESTE ALLER ZEITEN
Diese großartigen Männer auf ihren Tretmaschinen
81 Männer fuhren los, und nur acht kamen an. Schreckliche Witterungsbedingungen, fürchterliche Straßen und 400 Kilometer lange Etappen erwiesen sich selbst für die größten Champions von il ciclismo eroico als zu viel …
Il ciclismo eroico verkörperte, wie ich herausfinden sollte, genau den Geist, den ich wiederzubeleben hoffte. In den letzten Jahren haben die Italiener große Zuneigung für ihr »heroisches Zeitalter des Radsports« entwickelt, als dieser Sport in Italien über allem stand und italienische Fahrer die Szene beherrschten. Zwischen den zwanziger Jahren und den frühen Fünfzigern gewannen Italiener fast ebenso oft die Tour de France wie die Franzosen selbst, während sie ihre eigene Landesrundfahrt, die sich als zweitwichtigste und allerstrapaziöseste etabliert hatte, fast unangefochten dominierten.
Dass das härteste Radrennen aller Zeiten ein Giro gewesen sein musste, erschien mir angesichts seiner furchterregenden Reputation nur folgerichtig. Einige Einschätzungen aus den vergangenen Jahren:
»Der Giro d’Italia: Warum erwachsene Männer weinen«, schrieb das Magazin Peloton über die Ausgabe von 2011.
»Eine ungeheure und brutale physische Prüfung«, urteilte 2012 Dan Hunt, der für die Ausdauerdisziplinen zuständige Cheftrainer der britischen Bahn-Nationalmannschaft.
»Es ist ein noch schlimmeres Gemetzel als die Tour. Man fragt sich immer wieder: Warum zum Geier tue ich mir dieses Scheißrennen an?«, ließ sich Sir Bradley Wiggins zitieren.
Natürlich würde ich mich also dem Giro stellen müssen, dem Rennen, bei dem Lance Armstrong – ha! – nur ein einziges Mal anzutreten gewagt hatte und Elfter geworden war. Das Rennen, mit dem Eddy Merckx im Jahr 1968 seinen Siegeszug bei den großen Landesrundfahrten begann und 1974 auch beendete. Und das Rennen, das Fausto Coppi weltberühmt machte, den Inbegriff des tragischen Helden und eine der vielleicht größten gebrochenen Sportpersönlichkeiten aller Zeiten: einen fünfmaligen Giro-Sieger, der in den 1950er Jahren eine zweimonatige Haftstrafe wegen Ehebruchs verbüßte, offenherzig über den ungezügelten Gebrauch von Aufputschmitteln im Sport plauderte und im Alter von 40 Jahren an Malaria verstarb.
Wegen seiner bescheidenen und unangepassten Art hatte ich immer viel übrig gehabt für Coppi, einen Hänfling von einem Mann mit Vogelgesicht und Hühnerbrust, dessen Körperbau keinen Sinn ergab, bis man ihn auf ein Rad setzte. Sein weicher, unermüdlicher Tritt brachte ihm 1940 mit zwanzig seinen ersten Giro-Sieg ein und zwei Jahre später einen Stundenweltrekord, der 14 Jahre lang Bestand hatte. Mit zweiunddreißig stellte er in Alpe d’Huez auf dem Weg zu seinem zweiten Tour-Sieg eine Bestmarke auf, die drei Jahrzehnte lang niemand zu übertreffen vermochte.
Welchen überirdischen Status Coppi erreicht hatte, verdeutlicht die Tatsache, dass mein Vater – ein Mann, der sich nicht die Bohne für Sport jeglicher Art interessiert – bei einem kürzlich durchgeführten Fotoquiz legendärer Sportler, bei dem unter anderem Pelé, Björn Borg und Muhammed Ali dabei waren, nur ihn identifizieren konnte. (Fairerweise sollte ich anmerken, dass mein Vater einen Teil seiner Kindheit in Rom verbrachte und dort lebte, als Fausto auf dem Weg zu seinem ersten Giro-Sieg durch die Stadt kam. »Auf jeder Mauer in der Stadt stand Viva Coppi«, erzählte er mir. »Aber ehrlich gesagt habe ich sein Gesicht nur wegen des Ehebruch-Prozesses wiedererkannt.«)
Der Giro d’Italia stellte also genau die Art epischer Herausforderung dar, auf die ich aus war: ein hartes Rennen für echte Helden, das man mit Schneid allein gewinnen konnte, ohne danach auszusehen. Ich fing gerade an, mich mit der Aufgabe anzufreunden, als ich den Fehler machte, mich näher mit Paolo Facchinettis Bericht von der ganz besonders beschwerlichen sechsten Ausgabe des Giro zu befassen:
Der »Rekord-Giro« von 1914 in Zahlen:
• längste durchschnittliche Etappendistanz aller Zeiten: 396,25 km
• geringste Anzahl ins Ziel gekommener Fahrer: 8
• höchster Prozentsatz an Aufgaben: 90 %
• längste Distanz einer Einzeletappe: 430 km, Lucca–Rom
• längste Fahrzeit einer Einzeletappe: 19:34:47 Std., Bari–L’Aquila
Die Aufzählungszeichen des Verderbens aus Paolos Vorwort rückten mein geplantes Unternehmen schlagartig ins rechte Licht – ein gleißendes, entsetzliches Licht. Eine durchschnittliche Distanz von 400 Kilometern? Als ich die Strecke der Tour de France fuhr, hätten mir hundert Kilometer beinahe den Rest gegeben. Und damals war ich der dreißig noch näher als der vierzig. Ich war jünger als der älteste Toursieger. Jünger, viel jünger als David Beckham, als er seinen Rentenvertrag bei Paris St. Germain unterschrieb. Inzwischen war ich jenseits der vierzig und näherte mich längst mit großen Schritten der fünfzig. Mit 35 hat man noch Mumm in den Knochen. Mit 47 ist man froh, wenn man sie noch alle beisammen hat.
Das Beste, was ich in Sachen Inspiration finden konnte, war der Boxprofi Bernard »The Executioner« Hopkins, der soeben im Alter von 46 Jahren die IBO- und WBC-Titel im Halbschwergewicht gewonnen hatte. Aber auch wenn Hopkins ein schönes Beispiel dafür war, zu welchen körperlichen Leistungen man in diesem Alter noch fähig ist, so war er gleichzeitig auch ein alarmierendes Mahnmal, welchen Preis man dafür zu zahlen hatte. Vor einer anschließenden Titelverteidigung äußerte er sich gegenüber der Presse mit den Worten: »Ich habe vor einem Monat erfahren, der Arzt wird vor der Pressekonferenz hoffentlich hier sein, um das näher zu erläutern, aber ich muss gestehen, dass ich nicht menschlich bin. Ich bin ein Alien. Nein, im Ernst, ich bin vom Mars.«
So sehr ich mich auch mühte, sie zu verdrängen, kamen jetzt die Erinnerungen an meine einzige nennenswerte Unternehmung auf zwei Rädern im vorigen Jahrzehnt wieder hoch. Als die Tour de France 2007 in London startete, fuhr ich mit dem Fahrrad die Strecke nach Canterbury ab. Zur Vorbereitung hatte ich ein ähnliches Programm absolviert, wie es mir sieben Jahre zuvor zu Ehre gereicht hatte: einfach gar nichts machen und die Sache mit reiner Willenskraft durchziehen – mit dem »Koffer der Tapferkeit«, wie es der altgediente Radsportkommentator Paul Sherwen einmal so treffend ausgedrückt hat, um Fahrer zu beschreiben, die von irgendwoher die Kraft nehmen, sich weiter zu schinden. Wie ich leider feststellen musste, war daraus bei mir im fortgeschrittenen Alter eher eine »Handtasche der Übelkeit« geworden. Nachdem ich sie in einer Parkbucht nahe Ashford geleert hatte, war bei mir der Ofen aus. Viele unsägliche Stunden später bestieg ich entkräftet einen Zug Richtung Heimat, schob mir Pommes in die blasse Schnauze und ergab mich matt der neuen Realität: Ich war aus dem Alter raus, in dem man mangelnde Vorbereitung noch durch bloße Entschlossenheit wettmachen konnte.
Vielleicht war ich sogar zu alt, um mich noch anständig vorbereiten zu können. Ein paar Jahre nach diesem Debakel fuhr ich mit meinem halbwüchsigen Sohn zum Mountainboarden. Dabei rollten wir auf Skateboards mit Ballonreifen einen Abhang in Surrey hinab. Da wir nur gemütlich dahinkollerten, glaubte ich, größere Probleme ausschließen zu können, aber weit gefehlt. Bei einem scheinbar harmlosen Sturz auf unserer letzten Fahrt riss mir ein wichtiger Schultermuskel, nämlich derjenige, der dafür sorgt, dass man seinen Alltag bewältigen kann, ohne wie ein 498-jähriger Greis aus Chelsea zu wirken.
Die anschließende Reha dauerte vier Monate, so dass ich viel Zeit hatte, um über meine bevorstehende Zukunft im Zustand greisen Siechtums nachzudenken: »Das ist Mr. Moore da drüben beim Fernseher. Der arme Kerl ist letzte Woche leicht gestürzt. Nein, Mr. Moore, das ist nicht die Tour de France, das ist ›Countdown‹ – die Tour startet erst in sechs Monaten … Nein, nicht Minuten, Monate. MO-NA-TE. Schenken Sie ihm ein Lächeln, da freut er sich.«
Jede körperliche Tätigkeit, die ich in Angriff nahm, führte mir unmissverständlich vor Augen, dass ich es locker angehen lassen sollte, statt mir das genaue Gegenteil in den Kopf zu setzen. Ein Jahr lang wöchentliches Badminton bescherte mir einen Tennisarm und kaputte Knie, richtete aber nichts gegen meine grässlich gedeihenden Männermöpse aus. Ich wendete unsere Matratze, so wie ich es in jedem Frühling tat, dann kam ich zwei Tage lang nicht mehr von ihr herunter.
Damit hätte ich einen Schlussstrich unter die ganze blödsinnige Idee ziehen sollen. Den Giro d’Italia von 1914 zu fahren, war, gelinde gesagt, nichts für alte Männer. Andererseits versprach mein geplantes Unternehmen aber auch viele Stunden, ausgefüllt mit herrlich zweckfreien Tätigkeiten – etwas, was den Bedürfnissen von Männern meines Alters im Allgemeinen doch sehr entgegenkommt.