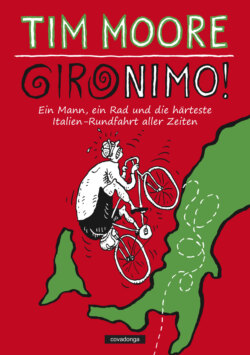Читать книгу Gironimo! - Tim Moore - Страница 9
IV
ОглавлениеLenkergriffe (Holz), 22 mm Innenmaß
Doppeltrinkflaschenhalter, 2 Metalltrinkflaschen
T/L: Lagerschalen? Klemmring??
Vorbau Lager/Schalen (?)
Pedalhaken
Flügel-Achsmuttern
Kettenspanner
Kurbelkeile – der kaputte ist zu dick, der andere zu lang; brauche 9 mm / 9,5 / 10??
Handschuhe mit Häkelbesatz
Deppenmütze
Deppenbrille
Diese sonderbare Mischung aus Weisheit und Ahnungslosigkeit war die Einkaufsliste, die ich zum Anjou Vélo Vintage Festival mitnahm. Schon bevor meine sportlich-elegante Rennmaschine als rustikale Bauernmühle entlarvt worden war, hatte ich mich auf diese Veranstaltung gefreut. Aus dem gemütlichen Bummel über den Trödelmarkt war nun aber eine fieberhafte Suche nach authentischen Teilen geworden, um mein Projekt vor dem Scheitern zu bewahren. Ich hatte im Vorfeld sogar einen schönen Traum gehabt, in dem naive, profitscheue Händler hinter ihren Tapeziertischen nur darauf warteten, mir ihre bestens erhaltenen Teile zum Spottpreis überlassen zu dürfen. Der absurde Höhepunkt war ein gerahmter Schaukasten, in dem ein uraltes, aber makelloses Stucchi-Trikot, wie es Alfonso Calzolari beim Giro 1914 getragen hatte, aufbewahrt wurde. Wegen des 13-Euro-Preisschilds fiel es mir schwer, nicht freudeschreiend aufzuwachen.
Roger Rivière hatte mir das AVV ans Herz gelegt, und ich hatte wiederum Jim und Matthew zwecks Gesellschaft und fachkundiger Beratung überredet, mich zu begleiten. Ende Juni fuhr uns Matthew in seinem Auto runter an die Loire. Das Fahrzeug schien allemal groß genug für unsere Zwecke zu sein, war es letztlich dann aber doch nicht.
Das Festival fand in dem hübschen Städtchen Saumur statt und lockte zahlreiche Freunde alter Fahrräder samt deren entzückenden Begleiterinnen in Nahtstrümpfen und Pillbox-Hüten an. Abgesehen von einer vorübergehenden Schmelze der Stirnlappen aufgrund einer Überdosis Dixieland-Beschallung verlebten wir drei ein ganz ausgezeichnetes Wochenende.
Um vor der Schlacht am kalten Radbüfett meine Nerven zu beruhigen, verbrachte ich den Morgen jenes schicksalhaften Samstags damit, mir die ausgestellten klassischen Fahrräder anzuschauen. Wie zum Hohn stieß ich als Erstes auf genau das La Française-Diamant, auf dem Maurice Garin 1903 die Tour gewonnen hatte. Als ich meinen Blick über seine verhasste Schwärze gleiten ließ, unterdrückte ich ein mit Verwünschungen in Richtung Max getränktes Knurren, das bald einem erleichterten Schnaufen wich. Nur ein Gang und keinerlei Bremsen! Ein Hoch auf elf Jahre technischen Fortschritts: Das Peugeot daneben wies bereits vertraute Felgenbremsen und eine Flip-Flop-Nabe auf, die dem Fahrer zumindest zwei unterschiedliche Übersetzungen bescherte, auch wenn er dafür anhalten, das Hinterrad ausbauen und andersherum wieder einsetzen musste. Vielleicht noch wichtiger war, dass das Rad einen Freilauf besaß, so dass er eine Abfahrt absolvieren konnte, ohne die Füße von den Pedalen nehmen zu müssen (die nervenaufreibende Methode Garin) oder sich die Beine durch die irrsinnige Rotation pürieren zu lassen.
Ich ließ Matthew und Jim mit ein paar Hochradbesitzern mit Jagdmützen und Tweed-Knickerbockers zurück – Jim sprach fließend Französisch, nachdem er ein paar Jahre als Halbprofi im Land gelebt hatte – und machte mich zu einem ersten Rundgang über den Trödelmarkt auf. Zwei Stunden später war ich um 74 Euro ärmer und hatte ein Drittel der Posten auf meinem Einkaufszettel abgehakt. Mein mit Abstand teuerster Kauf war ein Drahtgitter-Doppeltrinkflaschenhalter, der sich nach blödsinniger, aber historisch korrekter Art an der Vorderseite des Lenkers anbringen ließ. Ein maroder und schreiend ungelenker Verhau verschweißter Kleiderbügel, der aber, wie ich betrübt einsah, wohl der einzige wäre, der sich auftreiben ließ. Ein anderer Händler hatte einen Satz originaler Blechtrinkflaschen, aber sie passten nicht ins Gestell, hätten mir vermutlich eine Nahrungsmittelvergiftung beschert und kosteten 250 Euro das Paar.
Ich war auf meinem zweiten Rundgang und feilschte um ein Paar Wildlederhandschuhe mit Strickbesatz, als Jim mir auf die Schulter tippte. »Hier werden echt ein paar schöne alte Räder verhökert«, sagte er, mich an sein Vorhaben erinnernd, seinen Laden um eine Auswahl klassischer Modelle zu erweitern. Ich hatte ein paar Stände gesehen, an denen vollständige historische Rennräder feilgeboten wurden, aber da ich ganz auf meine Ausrüstung und Komponenten fixiert war, hatte ich sie nicht weiter beachtet. Ich fühlte mich enorm geschmeichelt, als Jim – der radladenbesitzende, halbprofessionelle Jim – mich bat, mir ein paar Maschinen anzuschauen, die er ins Auge gefasst hatte. Ich musste an unsere Unterhaltung über Tretlagerbauweisen während der Hinfahrt zurückdenken – echt, das hätten Sie erleben müssen –, während der sich gezeigt hatte, dass ich kein vollkommen ahnungsloser Vollidiot mehr war.
»Wovon man bei Tretlagern auf jeden Fall die Finger lassen sollte, sind die Thompsons«, lautete meine fundierte Analyse, die ich mir im Laufe zahlreicher Online-Diskussionen in den vergangenen Wochen angeeignet hatte.
»Die was?« Keiner von beiden hatte jemals davon gehört.
Jim interessierte sich vor allem für porteurs, alte Räder mit Gepäckträger über dem Vorderrad. Gemeinsam nahmen wir ein paar Exemplare unter die Lupe, rieben uns nach traditioneller Art die Kinne und sogen scharf Luft durch die Zähne. Eins der Räder befand sich an einem Stand, der nominell von zwei stoppeligen, triefäugigen und sehr französischen Männern beaufsichtigt wurde, die vor allem damit beschäftigt waren, ihre öligen Finger durch das nicht eben üppige, nach hinten geklatschte Haar zu streichen und sich aus dem Bierkasten unter dem Tisch zu erfrischen. Wir hatten das doch etwas sehr marode porteur der beiden gerade verworfen, als Jim mit dem Kopf auf ein Rad deutete, das sich im hinteren Bereich des Standes verbarg. »Guck dir das mal an«, sagte er.
Das tat ich. Ohne Zweifel war es uralt: schmutzig, rostfleckig und bremsenlos. Die unbereiften Holzfelgen waren verzogen und abgeblättert, und die Hälfte der Speichen war glatt durchgerostet. Aber es war ein Rennrad und von angemessen klassischer Bauart. Das Steuerrohr war nicht so verwegen gewinkelt wie bei einer Maschine aus der Garin-Ära, aber doch mehr als bei den Rädern aus den 1920er Jahren, die beim AVV ausgestellt wurden. Am verchromten Lenker waren kupferbeschlagene Holzgriffe angebracht. Besonders auffällig war, dass der leidgeprüfte Brooks-Rennsattel an einer dieser putzigen, v-förmigen Sattelstützen montiert war, die, wie mein weniger ahnungsloses, aber dafür umso langweiligeres Ich inzwischen wusste, nach dem Ersten Weltkrieg aus der Mode gekommen waren.
Jim rief die Standbetreiber herbei und zeigte mit dem Daumen auf das Rad. »Quelle année?« Der eine der beiden gähnte ausgiebig, massierte sich den Skalp, leerte sein Kronenbourg und erhob sich schließlich. Auf dem Weg zu uns verschwand er kurz in einem erschütternd abgeranzten Transporter und kam mit einem zerknüllten Stückchen Papier wieder heraus. Statt zu antworten, entknüllte er den Zettel und reichte ihn Jim. Ich schaute ihm über die Schulter: Es war die Fotokopie einer Seite aus einem alten Radkatalog. Seite 207, um genau zu sein, überschrieben mit »HIRONDELLE 1914« und weitgehend ausgefüllt von der detaillierten Skizze eines Fahrrads, das mit der Bezeichnung »No 7 COURSE SUR ROUTE« beschriftet war. Die Form des Lenkers, das Profil der Gabel … ein rascher Vergleich der Geometrie bestätigte, dass das Rad aus dem Katalog mit dem Rad vor uns übereinstimmte. Durch ein vorsichtiges Rubbeln mit meinen frisch erstandenen Handschuhen rieb ich genug Dreck ab, um mich zu vergewissern: Da waren, grün auf schwarz in farbiger Realität, die Backgammon-Spitzen, die auch auf der Zeichnung Ober- und Unterrohr schmückten, ebenso das Steuerkopfschild aus Messing. »Manufacture Française d’armes et cycles«, las Jim vor. »Saint-Étienne.« Ich rubbelte ein bisschen fester und legte zwischen diesen Worten einen fliegenden Vogel frei. »Das ist eine Schwalbe«, sagte Jim. »Une hirondelle.«
Ich schluckte, aufgeregt, aber auch ein bisschen verängstigt und vor allem verunsichert. Ich war hergekommen, um die fehlenden Teile meines – räusper, spuck – Brillant aufzustöbern und hatte die meisten schon aufgetrieben. Ich hatte das Rad vom rostigen Grund auf neu aufgebaut, ich hatte es demontiert, neu lackiert, das ganze verfluchte Ding mit meinem Blut, meinem Schweiß und meinen Mannestränen getränkt … aber, aber, aber es war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht 1914 gebaut worden und auf jeden Fall kein richtiges Rennrad, und dieses Hirondelle hier war nachweislich beides. Ich unterdrückte ein verdrossenes Kreischen, zumindest versuchte ich es. Der Händler schreckte angesichts des heiseren Gurgelns, das meinen zusammengepressten Lippen entwich, leicht zurück.
»C’est combien?«, erkundigte sich Jim unvorsichtigerweise. Ein ziemlich großer Teil von mir hoffte auf eine Summe im hohen vierstelligen Bereich, um dieser verstörenden neuen Möglichkeit rasch einen Riegel vorzuschieben.
Der Händler genoss einmal mehr das behagliche Gefühl fettiger Finger auf dem schütteren Schädel. »Quatre cents.«
Vierhundert Euro – verdammte Axt, genau dahin, wo es wehtat.
»Trois cents«, stieß ich hervor, woraufhin er mit einem mächtigen Schnauber tödlicher Kränkung das Frankometer anschmiss und sich ein mächtiger Wortschwall ergoss, von dem ich kaum eine Silbe verstand.
»Er sagt, der Lenker allein sei so viel wert«, übersetzte Jim. »Wie wäre es, wenn wir ihm vorschlagen, ihn abzubauen und ihm hundert für den Rest bieten?« Ein verlockender Vorschlag, aber nur zehn Sekunden später hatten wir uns nach bewährter Art in der Mitte getroffen und per Handschlag geeinigt. Benommen schlurfte ich auf der Suche nach einem Geldautomaten davon.
Zehn Minuten später zählte ich sieben 50-Euro-Noten in eine geschwärzte Pranke und fühlte mich ausgesprochen erleichtert. Ja, ich stand wieder am Anfang, und ja, ich hatte teuer dafür bezahlen müssen, indem ich 350 Euro für ein kaputtes und nicht ganz vollständiges Rad hinblätterte, um den 400 Euro teuren Vorgänger zu ersetzen, für dessen Restaurierung ich einen Großteil der vergangenen zwei Monate geopfert (lies: verplempert) hatte. Ja, jetzt wo ich mir meine Neuerwerbung genauer ansah, erkannte ich auch, dass das Kettenblatt und die Pedale nicht passten, dass die Ritzel und beide Naben dermaßen verrostet waren, dass auch Zitronensäure nicht mehr helfen würde, und dass das Tretlager – ja, im Ernst – ein nicht originales, verfluchtes Thompson war.
Aber als ich das schmutzige Ding schulterte und mich an der Seite von Jim durch das drollig behütete Gedrängel kämpfte, erschien mir das alles zunehmend bedeutungslos. Nüchtern und pragmatisch betrachtet, enthielten Max’ Dosen und Schachteln sämtliche Kleinteile, die dem Hirondelle fehlten oder ersetzt werden müssten – Bremsen, Klingel, Pumpe, Naben, Achse, Pedale, Ritzel. All die Stunden auf der Terrasse wären also nicht vergebens gewesen: Viele, streng genommen sogar die meisten der Komponenten, die ich mühsam aufbereitet hatte, würde ich für mein No 7 Course sur Route gebrauchen können.
Ungeachtet solcher Banalitäten aber war mein neues Rad einfach ein echt geiles Teil. Es sah richtig gut aus und fühlte sich auch gut an. So gut, dass mir die Ereignisse der letzten Stunden beinahe wie eine Sequenz aus dem bereits geschilderten Traum vorkamen, den ich im Vorfeld des Festivals gehabt hatte. Die Finger um das verkrustete Oberrohr gekrallt und das im Katalog verewigte Gegenstück wie ein billet-doux in der Gesäßtasche verstaut, fühlte ich mit dem Hirondelle schon jetzt eine Verbundenheit, die ich bei seinem unglückseligen Vorgänger nie verspürt hatte. Ein glücklicher Zufall hatte uns zusammengeführt, hier an dieser sonnendurchfluteten Uferpromenade, an der es vor Spinnern in Filzhüten und dubiosem alten Plunder nur so wimmelte. Meine Nummer 7 war »die Eine«; wir waren füreinander bestimmt. Ich war in den Urlaub nach Frankreich gefahren und hatte mich in eine schäbige alte Landpomeranze verliebt.
Der Rest des Wochenendes verging, angereichert mit neu entfachter Begeisterung und mittäglichem Bechern, wie im Flug. Wir verbrachten den Abend an einem hübschen Platz voller Bars und schauten auf einem winzigen Fernseher dabei zu, wie die französische Fußballnationalmannschaft bei der EM scheiterte. Die festliche Stimmung um uns herum ging nahtlos in eine alkoholreiche Mahnwache über, bei der wir gerne mit von der Partie waren. Ich hatte das Hirondelle neben meinen Stuhl gelehnt, und als wir uns schwerfällig erhoben und aufbrechen wollten, kam ein charmanter junger Festivalbesucher mit einem hübschen Rennrad aus den Fünfzigern vorbei und warf einen Blick darauf. »Ah, une Hirondelle!« Unseren gänzlich instabilen Zustand erfassend, fuhr er auf Englisch fort. »Diese Rad war süperpopulär bei die Polisei in, öh, frühere Zeiten.« Ich nickte glasig. »Tatsächlisch ist sie die alte Name für die Polisei in la France – les Hirondelles.«
Das war nicht unbedingt das, was ich hören wollte – mir fielen wieder die Zollbeamten auf dem Brillant-Poster ein –, trotzdem schenkte ich ihm ein breites Lächeln. Ich lächelte immer noch, wenn auch etwas matter, als wir das Hirondelle am nächsten Morgen in Matthews Auto zwängten, zusammen mit einem »Anjou Vélo Vintage«-Plakat, das ich auf dem Weg zurück zum Hotel von einem Zaun gefummelt hatte. Wahrscheinlich hatte ich vor meiner neuen Flamme gleich mal den coolen Macker markieren wollen.
Das große Finale des Festivals war ein Jedermannrennen auf Retrorädern durch das Pays de la Loire. Bevor wir uns auf den Heimweg machten, schauten wir beim Start zu. Es war ein windiger Morgen: Die klassischen geblümten Röckchen brachten jetzt gewisse erfreuliche Nachteile mit sich, und unter dem Jubel der Zuschauer verlor einer der drei Kardinäle auf einem dreisitzigen Tandem sein rotes Käppchen. Als das kunstvoll kostümierte Peloton mit rasselnden Klingeln und furzenden Hupen vorsichtig vorbeieierte, kam mir in den Sinn, dass diese 50 Kilometer lange Fahrt über Landstraßen so ziemlich das Härteste war, was diese liebenswerten, aber gebrechlichen Velozipede jemals durchmachen müssten. Und auch das Härteste, was ihre ulkig bemützten Fahrer jemals erleben würden. Ich versuchte, mir ernsthaft vorzustellen, dass auf mich und meine rostige Antiquität, die gerade Matthews Sitzbezüge und Jims Nacken arg in Mitleidenschaft zog, in nur zwei Monaten eine weitaus größere Herausforderung wartete. Dass wir nach 50 Kilometern die Ziellinie überqueren und einfach weiterfahren würden Richtung Horizont, weitere 3.100 Kilometer. Wie Forrest Gump auf einem albernen alten Rad.
Von nackter Angst getrieben fuhr ich heim und nahm mein Trainingsprogramm wieder auf, diesmal zu einer Art Dachboden-Biathlon abgewandelt, bei dem ich einen Sport ausübte (Indoortraining auf der Rolle), während ich einen anderen schaute (Fußball). Als die Tour de France begann, fuhr ich diesmal eifrig mit, den Kopf gesenkt, und sah zu, wie mir der Schweiß vom Kinn tropfte, genau auf mein verzerrtes Spiegelbild, das sich auf dem glänzend schwarzen Rahmen meines Rades abzeichnete. Um mich zu motivieren, trat ich gegen den zukünftigen Sir Bradley Wiggins und seine Freunde mit einem nach meinem Dafürhalten fairen Handicap an und versuchte, wenigstens halb so schnell zu fahren wie sie. Ich will nicht prahlen, aber unter diesen Bedingungen belegte ich beim Zeitfahren auf der neunten Etappe einen sehr beachtlichen dritten Platz.
Allmählich kam ich in Schwung, und das war auch gut so. Denn mittlerweile ließ sich die Zeit bis zu meiner Abreise sinnvoller in Wochen als in Monaten bemessen. Ich wandte mich an Ghisallo, einen italienischen Laufradhersteller, der als Einziger noch Holzfelgen im Sortiment hatte, und bestellte ein Paar sechsschichtiger, überlappend gefügter Birkenholzlaufräder mit dem für die damalige Zeit korrekten Profil. Cerchi Ghisallo schien ein prächtiges Unternehmen zu sein. Benannt wurde es nach der berühmten Radfahrer-Wallfahrtskirche Madonna del Ghisallo oberhalb des Comer Sees, wo die Firma im Übrigen auch ihren Sitz hat und seit 1946 als Familienbetrieb geführt wird. Das erklärte Ziel des Unternehmens lautet, jährlich mindestens 500 und höchstens 1.000 Felgen zu bauen. Ich stieß auf ein Interview mit dem betagten Firmenleiter, in dem sich der Fragesteller redlich, aber vergeblich bemühte, die Herstellung der Ghisallo-Felgen als ein akribisches Werk der Liebe darzustellen.
»Können Sie die technischen Abweichungen zwischen den neun verschiedenen Felgenvarianten beschreiben, die Sie anbieten?«
»Gibt keine.«
»Wirklich?«
»Jau.«
»Aber was ist mit Ihrem speziell verstärkten Modell, dem Rinforzato?«
»Ha! Ist doch bloß ein Name.«
Mit einem mächtigen Seufzer machte ich mich daran, die ganzen Teile von meinem alten alten Rad abzubauen, die ich für mein neues altes Rad bräuchte. Und mit einem noch mächtigeren Seufzer überwand ich meinen Stolz und wandte mich der schwierigsten Aufgabe von allen zu. Um den Teilnehmern von 1914 auf gebührende Weise die Ehre zu erweisen, musste ich alles so authentisch wie möglich gestalten. Ich musste leiden, wie sie gelitten hatten, mich schinden, wie sie sich geschunden hatten, fahren, was sie gefahren waren und tragen, was sie getragen hatten. Und so machte ich mich daran, mich einzukleiden wie ein riesiger Hanswurst.
Die Gabe des Internets, selbst auf die abwegigsten Fragen verbindliche, detaillierte Antworten parat zu haben, ist ein zweischneidiges Schwert. Seine glänzendere, schärfere Seite hatte sich als sehr nützlich dabei erwiesen, präzise das von den Fahrern der Vorkriegsjahre bevorzugte Design von Holzlaufrädern zu bestimmen und die Kontaktdaten des einzigen Herstellers solcher Stücke zu ermitteln. Meine Suche nach der üblichen Kleidung der Fahrer bescherte mir einen kräftigen Hieb auf den Hintern mit der anderen Seite, der rostigen und schartigen.
Ein tonton namens Émile hegte eine sehr spezielle Obsession für die Einzelheiten klassischer Radsportbekleidung und betrieb eine Website, auf der er seine gewaltige Sammlung an Replikaten präsentierte. Insbesondere die Outfits aus der Zeit von 1910 bis 1920 waren mehr als gewöhnungsbedürftig. Die Trikots der damaligen Zeit waren langärmelige Rollkragenpullover aus schwerer Wolle und sahen eher nach etwas aus, das man früher beim Hochseefischen trug. Das versprach ein Riesenspaß zu werden, wenn ich mich darin im Hochsommer durch Italien quälte.
Der Preis von 175 Euro für einen Satz Felgen erschien mir für italienische Wertarbeit nicht überzogen, vor allem im Vergleich mit der noch üppigeren Summe, die ich einem Typen aus Parma namens Fausto dafür überweisen musste, mir einen Wollpullover zu stricken. Ebenso wie Ghisallo war auch Fausto meine einzige Wahl: Émile hatte mir versichert, dass niemand sonst maßgeschneiderte Replika-Trikots aus dieser Epoche herstellte. Zusammen mit meiner PayPal-Kohle schickte ich Fausto meine Maße und die Anweisung, das Trikot aus einfacher weißer Merinowolle zu fertigen. Er bot an, ohne Aufpreis ein der damaligen Zeit entstammendes Teamlogo auf die Front zu sticken – Calzolaris geschwungenes »Stucchi« hätte sich ganz wunderbar auf meiner Brust gemacht –, aber mein sklavisches Streben nach Authentizität schob dieser reizenden Idee einen Riegel vor. »Die Teilnehmer des Giro von 1914 fielen unter drei Kategorien«, schrieb Paolo Facchinetti. »Accasati, die professionellen Teams angehörten, isolati, die als Profis, aber unabhängig fuhren, und aspiranti, verwegene Amateure, die nicht viel mehr als Radtouristen waren und von denen die meisten nicht einmal die erste Etappe überstanden.« Natürlich widerstrebte es mir, mich mit diesen todgeweihten Stümpern gleichzusetzen, aber es war die einzig glaubwürdige Option. Ich war ein aspiranto, und als solcher könnte ich gemäß dem von Paolo dargelegten Reglement nur ein schlichtes weißes Trikot tragen.
Bei den Wollshorts und Socken, die niemand zu reproduzieren bereit war, die aber auch nicht weiter außergewöhnlich waren, musste ich improvisieren. Die Schuhe – enge schwarze Treter zum Schnüren – schienen sich von den Anfängen des Radsports bis in die siebziger Jahre hinein kaum verändert zu haben. Auf Le Bon Coin und dem französischen eBay fand ich mehrere antike Exemplare. Richtig schlimm wurde es oberhalb des Halses. Émiles Seite und die Bilder in Paolos Buch duldeten keinen Widerspruch: In meinem Browser-Verlauf würden schon bald die Suchbegriffe »klassische Schutzbrille blaue Gläser« und »Bäckermütze weißes Leinen« verewigt sein. Ich hätte Zeit sparen können, indem ich einfach »unheimlicher Lüstling 70er Jahre« eingegeben hätte.
Den Großteil meiner wachen Stunden verbrachte ich nach wie vor auf der Terrasse am Montageständer, wo ich mit dem Rad, wohlwollend formuliert, stete Fortschritte machte. Seit drei Jahren versprach ich, das Haus zu renovieren, und als meine Frau diese Aufgabe jetzt einem polnischen Burschen anvertraute, stand es mir nicht zu, mich zu beklagen (was ich natürlich trotzdem tat). Der Typ schien sich sehr dafür zu interessieren, was ich draußen veranstaltete. Am Ende seines ersten Arbeitstages kam er raus in den Garten, um seine Pinsel zu reinigen, und strich neugierig um mich herum, während ich halbherzig am Tretlager herumstocherte.
»Ist alt«, sagte er schließlich.
Ich bestätigte, dass es so war.
»Warum werfen Sie nicht in Müll?«
Als ich am Morgen nach meiner Rückkehr aus Anjou im Bett lag, hatte ich eine Art Offenbarung erlebt. »Dans son jus«, war eine von den tontons oft gebrauchte Redewendung, und auch an den Ständen auf dem Festival hatte ich sie oft gehört. »Im eigenen Saft«, das bedeutete: unverfälscht, original, wie es ist. Ähnlich wie der bei eBay gern angeführte »rustikale Charme« wird der Begriff häufig ins Spiel gebracht, um eine traurige Rostlaube, die 30 Jahre lang unter einer nach Katzenpisse stinkenden Plane vor sich hin gegammelt hat, so etwas wie einen reizenden romantischen Zauber zu verleihen. Der »dans son jus«-Ethos war die Antithese zum fabrikneuen Ideal, das Lance anstrebte, mir aber wurde plötzlich klar, dass ich von Anfang an ein Rad mit kleinen Fehlern gewollt hatte, ein Rad, das einiges durchgemacht hatte, das alt war und auch so aussah.
Mein Hirondelle war beileibe keine reinrassige Vollblutrennmaschine: In einem Katalog von 1914, den ich hatte auftreiben können, war das »No 7« als das Einsteigermodell der Firma angepriesen worden, für »junge Leute und Radfahrer, die Geschwindigkeit mögen«. Bei einem Listenpreis von 160 Franc waren selbst Bremsen ein optionales Extra. Aber Nummer 7 gab einen liebenswerten Underdog, und instinktiv schien es richtig, ihr ein paar Ecken und Kanten zuzugestehen. Kein Sandstrahlen mehr, keine Umlackierung und mit Sicherheit keine Neuvernickelung (um ein Haar hätte ich 70 Pfund dafür verschleudert, den Lenker neu zu beschichten). Ich öffnete die Augen und sagte zu meiner Frau: »Ich werde sie so nehmen, wie sie ist. Ich will sie in ihrem eigenen Saft.«
Ich läutete meinen neuen Vorsatz mit einem neuerlichen verhängnisvollen Geplänkel mit la méthode Piotr ein. Nachdem ich durch kurzes beherztes Rubbeln die Original-Rahmennummer freigelegt hatte – 87277, in goldenen Lettern auf die schwarze Sattelstütze geprägt –, gingen ein wenig die Gäule mit mir durch, und ich entfernte weite Teile der grünen Backgammon-Spitzen am Unterrohr. Das schöne Dekor war hinüber. Also rubbelte ich auch den Rest mit einem feuchten Lappen ab und pinselte stattdessen alles mit einem stinkenden Rostschutzlack ein. Jede säurebehandelte Komponente wurde der gleichen geruchsintensiven Behandlung unterzogen: Lenker, Kurbeln, Bremshebel, Pedale, Klingel. Als ich damit fertig war, sah ich mich zufrieden auf der Terrasse um, auf der nun eine Menge klebrige, im eigenen Verfall einbalsamierte Metallteile verstreut lagen. Der polnische Maler hatte von einem Fenster im Obergeschoss aus alles beobachtet. Ich lächelte ihn an, und er brach in schallendes Gelächter aus.
Die Tour de France ging zu Ende, und die Olympischen Spiele fingen an. Oben auf dem Dachboden trat ich beim Straßenrennen der Männer einen großen Gang und einen etwas kleineren beim Beachvolleyball. Alle paar Stunden klingelte es an der Tür, und ich rannte wie ein Irrer die Treppe hinab, um eine neue Lieferung entgegenzunehmen. Kurbelkeile, Schmiermittel, noch ein Eimer von dem ruinös teuren Pferdegeschirrreiniger, um den originalen Brooks-Rennsattel meines Hirondelle auf Vordermann zu bringen, der anmutig und bequem war, aber so zerfurcht wie die Haut eines sterbenden Elefanten.
Im Zustand nervöser Beklommenheit riss ich eine gepolsterte, mit Briefmarken aus Übersee zugepflasterte Versandtasche auf und förderte die »klassische Chemikerbrille mit Lederdichtung« zutage, die ich bei einem kanadischen eBay-Händler erstanden hatte. Lieber Himmel, was für ein abgefahrenes Teil: eine John-Lennon-Brille für Steampunk-Schweißer. Ich setzte sie auf und fühlte mich sofort ausgesprochen komisch. Das Leder – dicke, seitliche Scheuklappen, dazu ein Schutzpolster über der Nase – verengte die Welt um mich herum zu einem klaustrophobischen Korridor, der nach muffigem Chemielabor roch. Unter dem außerordentlichen Gewicht der alten Sicherheitsgläser, die so wie dick waren wie Zwei-Pfund-Münzen, kippte mein Kopf nach unten – was nicht schlimm war, da sich direkt vor mir ein Spiegel befand. Nachdem ich eine Woche später die gläsernen Mühlsteine von einem etwas konsternierten Optiker durch dünnere, blau getönte Linsen ersetzen ließ, fiel das Gewicht schon wesentlich erträglicher aus. Der Blick in den Spiegel hingegen nicht.
Dem Briefträger war kaum eine Pause vergönnt. Ein paar einfache Merinowollsocken. Zwei Metalltrinkflaschen, im Retrolook gehalten, aber aufgrund gesundheitstechnischer Überlegungen keineswegs alt (nachdem ich sie ein paar Minuten auf der Terrasse herumgekickt hatte, um sie ein wenig auf alt zu trimmen, schaute ich auf und begegnete dem ungerührten Blick des Malers). Vier hellgraue, speziell für Cyclocross-Rennen konzipierte Vittoria-Schlauchreifen, die, wie ich in Anjou erfahren hatte, den von Calzolari verwendeten ballonartigen »palmers« noch am ehesten entsprachen. Die bauschige weiße Leinenmütze, eine Abscheulichkeit sondergleichen, die noch mehr nach Gilbert O’Sullivan aussah, als ich befürchtet hatte. Die auf klassisch gemachte Sattelpacktasche eines südkoreanischen Spezialherstellers, die wunderschön war, aber auch so winzig, dass ich mich fragte, wie ich den ganzen Kram, den ich mitzunehmen plante, darin unterbringen sollte. Eine wollene Radhose, erstanden auf der französischen eBay-Plattform und auf beiden Beinen mit der mir immer noch rätselhaften Beschriftung »DALISTEL« versehen. Der Gummizug hatte ebenso wie der gepolsterte Schritt schon bessere Tage gesehen – Tage, über die ich lieber nicht nachdenken wollte. Es waren hochtaillierte Minishorts, wohl aus den Zeiten des jungen Eddy Merckx. Ich zog sie an; sie fielen runter.
Eines Tages erhielt ich zwei große Pakete von jenseits des Ärmelkanals. Das erste enthielt die Schuhe von Gerard Lagrost. Ich hatte sie auf Le Bon Coin gefunden und anschließend einen vergnüglichen E-Mail-Verkehr mit dem eben erwähnten Eigentümer/Verkäufer unterhalten. Seine unwiderstehliche Eröffnungsfloskel: »Hallo, englischer Radelmann-Freund! Ich habe 67 Jahre.«
Gerards Schuhe waren aus robustem Leder handgenäht: schwarzes Obermaterial mit Schnürung, zwecks Belüftung großzügig perforiert, die Sohlen mit rostigen Nägeln und Nieten angebracht und verstärkt. Häufiger Kontakt mit gerillten Pedalen hatte im Ballenbereich der Sohlen zwei Reihen sauberer Abrücke hinterlassen, die von der langen Karriere im Sattel zeugten, die ihr Vorbesitzer genossen hatte. Gerard verriet mir, dass er diese Schuhe auf einer alljährlichen, 900 Kilometer langen Fahrt von Paris nach Perpignan getragen hatte. Er schickte mir Bilder von dem Rad, auf dem er diese Reisen unternommen hatte – ein gelbes Tourenrad, das er von seinem Vater geerbt hatte –, sowie von dem Peugeot-Stadtrad Baujahr 1910, auf dem er heute noch herumjuckelte.
Gerard Lagrost gehörte zur Generation europäischer Männer, die internationale Radtouren nicht wegen eines albernen Selbstfindungstrips unternahmen – für so was war ich zuständig –, sondern als billige und gesunde Art, von A ins weit entfernte B zu gelangen. Sein rührendes Bedürfnis, mich an seinen Erinnerungen teilhaben zu lassen, war, wie mir schwante, der Erkenntnis geschuldet, dass es mit dieser Generation langsam zu Ende ging.
Um mich zu revanchieren, schickte ich ihm einen Schnappschuss meines Hirondelle auf dem Montageständer. »Nächsten Monat möchte ich auf diesem Rad 3.162 Kilometer fahren und dabei Ihre getreuen Schuhe tragen«, schrieb ich, und die Tastatur erstrahlte buchstäblich vor dramatischer Bedeutsamkeit. Vielleicht war es aber auch nur das Schmiermittel.
Binnen einer Stunde erhielt ich seine Antwort: »Ich freue mich, dass Sie meine Schuhe genießen.«
Das zweite Paket war wesentlich größer und enthielt ein glänzendes, bambusgrünes Paar hölzerner Felgen von Ghisallo. Erneut verspürte ich diesen doppelten Kitzel, verzaubert einerseits von der zeitlosen Schönheit der lackierten Birkenringe und andererseits von der bloßen Tatsache, genau so empfinden zu müssen. Vertrautere Gefühle stellten sich ein, als ich versuchte, eine Verbindung zwischen Felgen und Rahmen herzustellen. Die Speichen und Naben von den ausgedienten Super Champions zu entfernen, kostete mich einen grauenvollen Morgen, an dem nur der Maler seinen Spaß hatte. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, immerhin fast die Hälfte der Speichen an den Ghisallos zu befestigen. (»Sind Räder aus Holz?« »Ganz genau.« »Aber … sind neu!«)
Am nächsten Morgen wandte ich mich erneut an Jim und fügte mich einem weiteren Kompromiss. Die alten Speichen waren, wie wir übereinkamen, sowohl von falscher Länge als auch gefährlich schrottreif. Ich verwarf sie zugunsten von 72 neuwertigen Speichen aus Jims Lagerbestand. Vier Stunden später kehrte ich mit einem fast fahrtüchtigen Rad im Kofferraum heim.
Ungeduld hatte schon seit langem an meiner Tür gekratzt und jetzt platzte sie in Begleitung ihres Dienstmädchens, der blindwütigen Stümperei, herein. Mit Hilfe eines kleinen Hammers, eines Sohns und eines länglichen Stücks Holz löste ich den Lenkervorbau auf eine Weise vom Lenkkopf, die Lagerschalen, Muttern und winzige Stahlkugeln über die ganze Terrasse verteilte.
Beim Wiederaufbau verlegte ich mich auf eine Technik, die ich schon bei der Montage von Achsen und Naben angewandt hatte und die da lautete: Schließe etwaige kleine Lücken mit Dichtungen, stopfe größere mit Kugellagern, kleistere das Ganze dann mit reichlich Schmiere zu und schraube es fest, bevor zu viel davon wieder herausfällt.
Was das Tretlager betraf, musste ich wohl oder übel mit dem allgemein verpönten Thompson vorliebnehmen, das jemand – vermutlich der skalpkratzende Verkäufer – mit roher Gewalt und damit sehr nachhaltig in das Gewinde am unteren Ende des Rahmens gehämmert hatte. Thompson-Tretlager waren billig und tückisch, erforderten ständige Nachbesserungen und hatten schon Heerscharen von Kurbeln den Rest gegeben (sorry, es kommt nicht so oft vor, dass ich kompetent über technische Aspekte schwadronieren kann, da müssen Sie jetzt durch …). Ich fügte mich in mein Schicksal und verlegte mich auf die einzig sinnvolle Lösung: Gewalt. Nachdem ich zwei Wochen lang vergeblich versucht hatte, die rechte Kurbel sanft von der Achse zu lösen, ging ich auf die Straße, klemmte das stur ineinander verkeilte Paar in die Schlitze eines Gullydeckels und prügelte ihm mit einer Gerüststange die Scheiße aus dem rostigen Leib. Der rote Dunst färbte sich braun, als der Deckel in die Luft flog und das ganze Gedöns ins flüssige Verderben plumpste. Ohne nachzudenken, führte ich mit bloßen Armen eine Bergung durch, setzte das Gitter wieder ein und prügelte geräuschvoll weiter. Der Erfolg, als er sich schließlich einstellte, wurde mit einem feuchten, brünstigen Grunzen und einem gedämpften polnischen Gekicher gefeiert.
Als Nächstes waren die Kurbelkeile dran. Erneut wich behutsames Friemeln bald lustvoller metallischer Züchtigung. Die linke Kurbel fügte sich nach nur einem halben Dutzend Hammerschlägen in die vorgesehene Öffnung. Nach ihrer Leidenszeit im Gullydeckel war ich nicht überrascht, dass die rechte Kurbel sich nur widerwillig an ihren neuen zylindrischen Gefährten gewöhnen wollte. Ich tat mein Bestes, die beiden anständig miteinander bekanntzumachen, doch sie zierten sich, so dass ich mit hochroter Birne und einer schändlichen Tirade nachhelfen musste. Während ich auf ihn einprügelte, verbeulte sich das Endstück des Keils, und er brach schließlich wie ein hölzerner Zelthering nach Jahren hämmernder Misshandlungen entzwei. Er stecke nicht allzu tief im Gewinde, aber es sah nicht so aus, als sollte er in absehbarer Zeit wieder herauskommen. Zu spät jetzt, die wahllose Ansammlung von Dichtungen und Lagern und Schalen zu hinterfragen, die ich in das Tretlager getrieben hatte: Es gab eh kein Zurück mehr.
Ich hatte sämtliche von Max erstandenen antiken Bremselemente sorgfältig auf einem Grillrost zu einem Museum der Entschleunigung drapiert, jetzt aber schnappte ich mir alle Teile, die wie zusammengehörige Paare aussahen und brachte sie irgendwie am Rad an. Bremshebel an den Lenker, Bremszangen an Gabel und Sitzstrebe, alles verbunden mit uralten, metallummantelten Bremszügen.
Mein neuer Hang zu unüberlegter Bedenkenlosigkeit war keine gute Voraussetzung für die Aufgabe, die sich mir als Nächstes stellte. Die tontons hatten mir verraten, dass herkömmliche Bremsbeläge für hölzerne Laufräder nicht taugten: Die durch die Reibung entstehende Hitze brachte das Gummi zum Schmelzen, was die Felge mit einer zähflüssigen schwarzen Pampe überzog. Die einzigen effektiven Bremsklotzmaterialien, wie sie seit den Tagen Calzolaris bis zum Aufkommen von Alufelgen in den Vierzigern benutzt wurden, waren Kork und Leder.
Ich erkundigte mich bei Ghisallo nach einem Händler für solche Bremsklötze und bekam mitgeteilt, dass es keinen gab. Ugo, mein Kontaktmann bei der Firma, erklärte mir höflich, dass die Kunden, die Ghisallo-Laufräder an ihren klassischen Rädern anbrachten, in der Regel reine Sammler waren, fast durchweg ältere Liebhaber, die nicht im Traum daran dachten, ihre kostbaren Museumsstücke vom Ausstellungsständer zu nehmen und auf die Straße zu schieben. Weitere Erörterungen mit den tontons förderten die groteske Wahrheit zutage: Es gab nur eine Lösung, und die würde ich im Alkohol finden. Über ein Hackbrett im Esszimmer gebeugt machte ich mich sofort ans Werk, ein Teppichmesser in der einen, einen Weinkorken in der anderen Hand. Als ich meiner Familie erläuterte, was genau ich da eigentlich trieb, erntete ich nur ein gleichgültiges Murmeln, woran sich wohl das ganze Ausmaß der Absonderlichkeiten erkennen ließ, die sie mich in letzter Zeit hatten anstellen sehen.
Nach diesem kleinen Ausflug in die Welt feinmechanischer Präzision gingen die Dinge am nächsten Tag wieder ihren gewohnten, grobschlächtigen Gang. Ich hämmerte die komisch angewinkelte Sattelstütze an den Rahmen, dann hämmerte ich den betagten Brooks-Sattel an die komisch angewinkelte Sattelstütze. Ich sah von meinem Vorhaben ab, die ziemlich schrottreifen, kupferbeschlagenen Lenkergriffe zu restaurieren und griff stattdessen auf ein neues altes Paar zurück, das ich in Anjou erstanden hatte und jetzt kurzerhand mit reichlich Kleister tränkte und an die Lenkerenden wemste.
Ich schnappte mir aus meinem Haufen an Zahnkränzen zwei Freilaufritzel – das eine mit ein paar Zähnen mehr als das andere, was es mir unterwegs erlauben würde, die Übersetzung zu wechseln, indem ich einfach das Hinterrad wendete – und schmiss sie unbesonnen ins Terpentinbad. Als ich sie wieder herausschöpfte, war auf dem größeren der beiden die schmerzliche Aufschrift FEMINA freigelegt worden: Mein Herr, Sie haben einen Damengang. Schlimmer noch, das Ritzel saß fest. Ich schob es unten in den Ofen, um es bei geringer Hitze zu trocknen, dann vergaß ich es zwei Tage, in denen es viele schöne Stunden mit unserem Abendessen verbrachte und der Lasagne ein leichtes Aroma von Kohlenwasserstoff verlieh. Seine Funktionstüchtigkeit wurde, wenn auch geräuschvoll und widerwillig, durch ein 48-stündiges Bad in einer Wanne mit überschüssigem Getriebeöl wiederhergestellt. Besser als gar nichts: Ab auf die Flip-Flop-Nabe damit, gefolgt von einer Kette, die in einem wenig verheißungsvollen Orange schimmerte.
Matthew kam vorbei, und gemeinsam zwängten wir die Reifen mit viel Körpereinsatz auf die Felgen – eine aberwitzige Geduldsprobe wie aus einem Slapstickfilm, so als versuche man, ein passgenaues Gummilaken über einen eingefetteten Billardtisch zu spannen. Am nächsten Abend schuftete ich, das Ziel vor Augen und erpicht darauf, es hinter mich zu bringen, bis in die späte Augustdämmerung. Schnapp, klapp, kloink, dran mit der ollen Klingel, der Blechpumpe, vier der von Max geerbten eleganten, aber ziemlich spröden Flügelmuttern und mit dem schamlos abscheulichen Trinkflaschenhalter, einer klapprigen und brüchigen Zeitbombe.
Mit wüster Mähne und ebensolchem Blick taumelte ich keuchend einen Schritt zurück und betrachtete mein Werk, das wie am Galgen im Montageständer hing. Ich hatte es geschafft, ich hatte es wirklich geschafft, ich hatte ein hundert Jahre altes Rad gebaut, mit einem Lenker, der das Vorderrad bewegte, mit Pedalen, die rotierten, und mit einem Hinterrad, das sich dabei drehte und – hurra! – auch stoppte, wenn man einen Hebel betätigte, der ein Kabel spannte, das ein handgeschnitztes Stückchen Kork gegen die hölzerne Felge drückte. Mit zitternden Händen befreite ich das Hirondelle aus dem Ständer, dann trug ich es durchs Haus und auf die Straße.
Zum ersten Mal schwang ich ein Bein über das uralte Oberrohr, parkte meinen Hintern auf dem uralten Sattel und setzte einen Fuß auf das uralte Pedal. Das Hirondelle eierte voran in die langen Schatten der Vorstadt und fühlte sich dabei unerwartet leicht und agil an. Mein Puls raste und mein Verstand gleich mit. Ich stellte mir die allererste Fahrt von Nummer 7 vor hundert Jahren vor, der ganze Stolz eines jungen Galliers in Kniebundhosen, der lange darauf gespart hatte. Und ich stellte mir ihre vorerst letzte vor, bevor sie quietschend in irgendeiner Scheune abgestellt wurde, eine klapprige, mit Muskelkraft betriebene Peinlichkeit, die von einem Moped oder einem 2CV abgelöst wurde. Ich fragte mich, wie die Kombination aus altem Rad und altem Mann mit der Herausforderung fertig würde, die vor ihnen lag, und zwar schon sehr bald: Das Datum auf meinem Flugticket nach Mailand war nur noch zwei Wochen entfernt. Vor allem wünschte ich mir sehnlichst, dass der polnische Maler, der just an diesem Tag seine Arbeiten vollendet hatte, da gewesen wäre, um das erleben zu können. Aber dann brach der Bremszug der Vorderradbremse glatt durch das Gehäuse am Hebel, und ich war außerordentlich froh, dass er es nicht war.
Das Wort »unheilvoll« könnte ersonnen worden sein, um diese Jungfernfahrt und das halbe Dutzend, das sich daran anschloss, zu beschreiben, außerdem die Worte »warum?«, »aua« und »Scheißideee«. Am nächsten Tag hämmerte ich die Bremshebel wieder in halbwegs funktionale Form und machte mich auf den Weg zu Matthews Freund Suneil, um mich in der Kunst der Schlauchreifenwartung unterweisen zu lassen. Zwei Meilen im Schritttempo waren genug, um alle vier Weinkorkenbremsklötze in den Rinnstein zu schicken, zusammen mit drei albernen kleinen Federn, die für die Rückführung der Bremszangen zuständig waren, wenn man den Bremshebel losließ. Suneil machte mich freundlicherweise darauf aufmerksam, dass ich sämtliche Hebel verkehrt herum angebracht hatte, aber selbst nachdem dieser signifikante Makel behoben war, büßte ich auf der Heimreise noch einen Bremsklotz und zwei Federn ein.
Meine nächste Fahrt um den Block endete mit umgedrehtem Lenker. Bei der folgenden verschoben sich die Kurbeln von der traditionellen Sechs-Uhr-Position auf Viertel nach sieben. Ein einsames, heiseres Kreischen aus der Gegend des Tretlagers schwoll zu einem vielstimmigen rasselnden Geschrei an. Das Hinterrad geriet plötzlich aus der Flucht, und nach Stunden demoralisierender Fummelei an den Speichen realisierte ich, dass das Problem die Achse war, die sich in der Mitte durchgebogen hatte. Ich fand in einer von Max’ Schachteln ein einzelnes Ersatzexemplar sowie eine Reihe lederner Pedalriemen, die ich im irrwitzig anmutenden, aber letztlich erfolgreichen Bestreben, diese zum Schweigen zu bringen, um ausgewählte Teile des Rads zurrte.
Zwei Tage vor meiner Abreise fuhr ich auf dem Hirondelle zu Lance’ Werkstatt in Ealing. Im Gepäck hatte ich drei Reservebremsklötze und ein halbes Dutzend Federn aus einem Restposten von 150 Stück, den ich bei eBay erworben hatte. Ich brauchte nur jeweils ein Exemplar, erreichte mein Ziel aber dennoch schiebend: Auf halbem Wege löste sich eins der Pedale buchstäblich in seine Bestandteile auf und verteilte sich fröhlich in einem Hagel aus Metallsplittern und Lagerkugeln auf der Busspur. Fragen fundamentaler Natur wurden an meine antike Maschine gerichtet und mit einem langgezogenen, entnervten Schnauben beantwortet.
Lance hatte mir freundlicherweise angeboten, mein Rad einer letzten eingehenden Prüfung zu unterziehen, und wenngleich offensichtlich mindestens deren drei nötig waren, fühlte ich mich allein schon dadurch erleichtert, in seiner Werkstatt zu sein. Dieser Ort sah aus wie eine wahrgewordene Männerfantasie: eine gemütliche, ölverschmierte Männerhöhle, beherrscht von der leeren Hülle eines alten Jaguars und einem Mafiamobil aus den Tagen von Al Capone, dessen Dach Lance gerade lärmend mit einem Schlosserhammer bearbeitete. Zwischen den Werkzeugkästen und Regalen stapelten sich Schaukästen vollgestopft mit Modellautos, klassischen Sonnenbrillen, emaillierten Werkstattschildern und einer nackten Schaufensterpuppe mit Radkappen als Titten. Und von der niedrigen Betondecke und an der Wand hingen haufenweise Fahrräder, ein Dutzend oder mehr klassische Bahn- und Rennmaschinen im erstklassigen Zustand.
Dies war das Reich eines Mannes, der all das wusste, was ich wissen wollte, und der all das tun konnte, was getan werden musste. Lance legte den Hammer nieder, kam herüber, bückte sich neben das Hirondelle und sagte: »Was zum Geier hast du mit den Kurbelkeilen gemacht?«
Ich verbrachte den Rest des Tages dort, nahm die wohlverdiente Schelte hin und half dabei, das Hirondelle ein Stück weit fahrtauglicher zu machen. Lance wies mich an, das verbliebene Pedal abzubauen und zu entsorgen – »kein Verlust, sind der letzte Dreck« –, und holte aus einem verborgenen Lager alter Komponenten ein wesentlich robusteres Paar hervor. Mit chirurgischer Präzision entfernte er den halbzerdrückten Kurbelkeil und bearbeitete mit einem Gerät, das er »polnische Drehbank« nannte – ein Elektrobohrer mit Schmirgelstück –, ein Ersatzexemplar, so dass es ins Gewinde passte. Ich schaute dabei zu, wie er den neuen Keil feinfühlig hineinklopfte. »Beim Hämmern nie den Unterarm benutzen. Lass Handgelenk und Finger tun, was du in deinem Geist siehst. Eine Sache des Feingefühls.« Erst später erfuhr ich, dass Lance seine Metallbaulehre bei Rolls-Royce gekrönt hatte, indem er einen Stahlwürfel arbeitete, der geometrisch präziser war als alle anderen, die sämtliche Lehrlinge der Firma vor oder nach ihm jemals zuwege brachten.
Trotz allem schien ihn das lächerliche, korkgebundene Bremssystem des Hirondelle nicht weiter zu beunruhigen. Zumindest nicht mehr als die mannigfachen rasselnden Störgeräusche oder die leichte Eiform, die in beiden Laufrädern hartnäckig erkennbar war. »Alles, was angeschraubt ist, ist an sich egal«, erzählte er unbekümmert. »Einfach austauschen oder von einem einheimischen Vogel reparieren lassen. Italiener machen alles, wenn du ein paar ciaos und benissimos einstreust und versprichst, nicht ihre Schwester zu bumsen.«
Lance stöpselte eine Werkstattleuchte ein und setzte seine Harry-Palmer-Bifokalbrille auf. »Bei den tragenden Teilen sieht das anders aus«, murmelte er, hielt die Lampe dicht an die wesentlichen Verbindungsstellen des Hirondelle und schaute sie sich mit zusammengekniffenen Augen ganz genau an. »Siehst du das hier?« Ich versuchte es, sah nichts, brummelte aber trotzdem beipflichtend. »Haarriss. Wenn der sich ausbreitet, wirst du’s schon hören. Ganz praktisch an altem Stahl.« Er stand auf und demonstrierte es mit einem schrecklichen, steinerweichenden Kreischen. »Bin echt neidisch, Tim, bist ein verfluchter Glückspilz. Pass auf dich auf.«
Eine ziemlich bemerkenswerte Ansage. Auf meiner erstmals zwischenfallsfreien Heimfahrt bekam ich noch eine weitere zu hören. Als ich an der gefürchteten Mehrfachkreuzung am Ende unserer Straße auf Grün wartete, hörte ich von Ferne einen Ruf den Verkehr der North Circular Road übertönen: »Hey, Kumpel! Kumpel!« Ich blickte mich um und entdeckte den Rufer, einen flaumbärtigen jungen Burschen auf einem schlichten schwarzen Fixie fünf Spuren neben mir. »Spitzenrad, Kumpel! Fährst du die L’Eroica, oder was?« Bis dahin hatte das Hirondelle auf der Straße nur mit den markerschütternden Misstönen, die es während der Fahrt von sich gab, für Aufsehen gesorgt.
»Allerdings!« rief ich zurück, bevor die Ampel umsprang und eine Kolonne Busse sich zwischen uns schob. Als sie weg waren, war er es auch.
An diesem Abend wurde ich von einer seltsamen neuen Stimmung erfasst, die sich mit dem dritten Glas Rotwein eingeschlichen hatte. Ich ging zum Wohnzimmerfenster und schaute auf das Hirondelle hinaus, das am Montageständer lehnte und im Licht der Suchscheinwerfer-Terrassenbeleuchtung unserer Nachbarin schimmerte. Hoffnung, Erregung, Vorfreude: Zum ersten Mal konnte ich mir tatsächlich vorstellen, mein Vorhaben erfolgreich in die Tat umzusetzen und auf dem uralten Veloziped den geisterhaften Spuren Alfonso Calzolaris durch ganz Italien zu folgen. Beim vierten Glas ahnte ich, dass sich zwischen uns beiden, der alten Mühle auf der Terrasse und mir, etwas Besonderes entwickelte. Zwei aus dem gleichen morschen Holz, ein Paar nicht mehr ganz taufrischer Oldtimer, die es gemeinsam ein letztes Mal allen zeigen wollten. Ich habe vielleicht nicht erwähnt, dass meine Familie zu diesem Zeitpunkt seit drei Tagen mit den isländischen Schwiegereltern verreist war und dass ich bei ihrer Rückkehr bereits fort sein würde, unterwegs auf einer gigantischen Reise von unbekannter Dauer. Beim fünften Glas fiel es mir wieder ein.
Die nächsten 48 Stunden verbrachte ich im Zustand heller Panik. So vieles war noch zu tun, und das meiste davon war von wesentlicher Bedeutung für das gesamte Unternehmen. Ich brachte an der Sattelstütze die Halterung für meine Packtasche an. Ich bastelte aus Segeltuch eine Einlage für den Trinkflaschenhalter, um das nervtötende Geklapper der Metallflaschen in ihrem Drahtverhau zu dämpfen. Ich kramte Max’ rostigstes Paar Pedalhaken heraus und schraubte sie an Lance’ Pedale an, dann brachte ich daran das verkrustetste Paar Pedalriemen an.
Die Haken trugen die Modellbezeichnung »Christophe«, zu Ehren von Eugène Christophe, dem Mann, der wie kein anderer zum Sinnbild für die ganze heroische Abscheulichkeit der frühen großen Etappenrennen geworden ist. Als er 1913 als Führender der Tour de France in den Pyrenäen einen Gabelbruch erlitt, schulterte er sein fahruntüchtiges Rad und trug es viele Meilen durchs Gebirge hinab bis zum nächsten Dorf, wo er sich bei einem Schmied eigenhändig eine neue Gabel hämmerte. Zu den zahlreichen Stunden, die er wegen dieses Missgeschicks ohnehin schon eingebüßt hatte, kam noch eine Zeitstrafe hinzu, weil er regelwidrig fremde Hilfe angenommen hatte: Ein Rennoffizieller hatte gesehen, dass ein Junge aus dem Dorf den Blasebalg bedient hatte. Das waren noch Zeiten. Und irgendwie waren das jetzt auch mehr oder weniger meine Zeiten.
Außerdem packte ich. Das hätte eigentlich nicht lange dauern sollen, da ich nicht viel mitzunehmen plante. Zwölf Jahre zuvor war ich, damals noch jünger, fitter und dümmer, mit zwei randvoll gepackten Satteltaschen zu meiner Tour de France aufgebrochen und hatte so unverzichtbare Leichtgewichte mitgenommen wie sechs Ausgaben des Procycling-Magazins und einen 1.123 Seiten starken Frankreich-Reiseführer. Ich hatte außerdem ein reichhaltiges Sortiment an Après-Rad-Kleidung mitgeführt, um für sämtliche Stimmungen und Anlässe gewappnet zu sein, weiterhin einen Elektrorasierer, der so viel wog wie ein neolithisches Handbeil, und einen Glücksziegelstein. (Ich wünschte, der letzte Posten wäre nur ein Scherz – zack, Wunsch erfüllt!)
Einer solchen Bürde waren das Hirondelle und ich mit unseren zusammengerechnet 146 Lenzen nicht gewachsen, zudem bot meine südkoreanische Segeltuchtasche auch gar nicht genug Platz, um den ganzen Krempel unterzubringen. Gleichzeitig war es aus Gründen der Authentizität unerlässlich, alles mitzuführen, was ich und das Rad zum Überleben brauchten. Essen, Trinken, Ersatzteile, Werkzeug, einen knielangen Südwester: Die Regeln von 1914 verfügten, dass die Fahrer dies alles mitschleppten. Dementsprechend kam eine zweite Garnitur Radklamotten nicht in Frage. Ich würde meine gesamte Kleidung, die ich beim Fahren trug, jeden Tag waschen müssen: die Socken, die Radhose, das Trikot, jeden einzelnen wollenen, stinkenden Quadratzentimeter.
Der Anstand und die Gefahr, nicht bedient zu werden, geboten mir, abends dann in normale Alltagskleidung zu wechseln, also stellte ich ein einzelnes, leichtgewichtiges Outfit zusammen. Meine Schuhe erschienen mir allesamt zu schwer, also ging ich mit der Digitalküchenwaage zum TK Maxx um die Ecke und wog das gesamte Angebot in Größe 42 ab. (In dem Laden kann man sich wirklich alles erlauben: Einmal habe ich dort sogar erlebt, wie ein achtköpfiges Teilnehmerfeld ein spontanes Huckepackrennen rund um die Haushaltswarenabteilung veranstaltete.)
Das 516 Gramm schwere Paar scheußlicher Segeltuchslipper, mit dem ich heimkam, nahm die Hälfte meiner hinter dem Sattel befestigten Packtasche ein. Einen Schuh füllte ich mit winzigen Toilettenartikeln: eine Minitube Zahnpasta, eine abgesägte Zahnbürste, Waschmittel/Shampoo-Konzentrat, vier Einwegrasierer und ein winziges Fläschchen Rasieröl/Kettenschmiere. Dazu eine verschrumpelte Tube Savlon für den Kampf gegen sattelbedingte Wundstellen, die von meiner Tour de France übrig geblieben war. (Wie sehr ich mich schon jetzt auf dieses morgendliche Ritual freute: Eine Handvoll vorne in die Hose, eine Handvoll hinten rein und dann mit einem behaglich schmierigen Gefühl im Schritt die Hoteltreppe runter zum Frühstück.) In den anderen Schuh passte nicht mehr hinein als die keineswegs authentischen, aber leider unvermeidlichen zeitgenössischen Begleiter Handy plus Kamera plus Ladegeräte. Ich stopfte mein erbärmliches Häufchen Kleidung in das bisschen Platz, das noch verblieben war, zwängte zwei Straßenkarten von Norditalien im Maßstab 1:200.000 und Paolos Buch hinein und zerrte dann unter größter Anstrengung die Taschenriemen durch ihre letzte Öse.
Max hatte mir eine alte lederne Werkzeugtasche überlassen, die sich genau in den Winkel zwischen Ober- und Unterrohr schmiegte. Obwohl ich nur das Allernotwendigste für etwaige Reparatur- und Wartungsarbeiten einpackte – selbst meine leichteste Zange wog fast so viel wie einer der scheußlichen Segeltuchschuhe –, platzte das Täschchen fast aus den uralten Nähten. Hilflos blickte ich auf den beachtlichen Haufen Zeugs, das noch einzupacken war, dann schob ich das Hirondelle zum vorletzten Mal aus der Haustür.
Nur noch 16 Stunden bis zur Abreise, und dies war meine erste Erfahrung mit Pedalhaken: ein selbst für meine Verhältnisse bemerkenswerter Mangel an Vorbereitung. Im Ruhemodus war es kein Problem, den ersten Fuß in seinen kleinen Käfig zu schieben, aber den zweiten während der Fahrt dort unterzubringen, erschien wie ein Kniff, für dessen Beherrschung ich möglicherweise 3.162 Kilometer brauchen würde. Die maßgeblichere Fertigkeit bestand jedoch darin, einen Fuß wieder herauszuziehen, bevor man zum Stillstand kam. Das war umso wichtiger, da ich schon bald wie ein Hampelmann aussehen würde, der es nicht anders verdiente, als sich an jeder Ampel wie ein Idiot auf die Fresse zu legen. Vielleicht käme ich mit den Haken ja besser zurecht, wenn ich die Schuhe von Gerard Lagrost trug. Und vielleicht hätte ich eh längst mal versuchen sollen, diese Schuhe für mehr als elf Sekunden zu tragen.
Ich unternahm einen letzten Beutezug durch den Londoner Westen. Bei Matthew heimste ich zwei alte Konusschlüssel und ein eigentlich verbotenes modernes Minitool ein, bei Suneil eine Rolle Felgenband für Schlauchreifen und eine Flasche Pannenmilch, bei Jim einen Speichenschlüssel von passendem Durchmesser. Keiner von ihnen bekam feuchte Augen und legte mir eine zitternde Hand auf die Schulter, diese herzlosen Schweine, aber trotzdem fuhr ich mit dem Gefühl heim, dass ich nicht nur mich selbst enttäuschen würde, sollte ich die ganze Geschichte in den Sand setzen. Vielleicht beschloss ich deswegen, als ich die Brücke an der U-Bahn-Station Boston Manor überquerte, dem Hirondelle zum ersten Mal so richtig die Gerte zu geben. Ich ging aus dem Sattel, trat in die alten Kurbeln und sauste an zwei von der Arbeit heimkehrenden Pendlern in Warnwesten vorbei. Das ganze Rad knirschte und quietschte und kreischte und bebte, aber ich trat weiter, schneller, immer schneller, zunehmend verblüfft, dass die Karre nicht einfach auseinanderbrach. Und froh, dass es, sollte es doch so weit kommen, nur ein paar Meter von der Brentforder Niederlassung von Evans Cycles geschähe.
Meine Nachbarin Bernie war in ihrem Vorgarten, als ich unsere Straße hinabrollte.
»Das ist also das berühmte Rad«, sagte sie. »Ist es wirklich einhundert Jahre alt?«
»Nicht komplett.« Mit einer Hand, die aussah, als hätte ich nach einem Tankerunglück mehrere Möwen aus einer Öllache geborgen, hielt ich eine Plastiktüte hoch, in der sich die soeben gerissene Kette befand.
»Oh«, sagte Bernie, warf einen skeptischen Blick auf die bei Evans erworbene Ersatzkette, auf das Hirondelle und dann auf mich. »Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist?«
Offenbar stellte sich nicht nur Bernie diese Frage. Auf der Matte lag eine Vintage-Postkarte, auf dem eine Dame aus der Belle Époque mit der Pumphose voran von ihrem außer Kontrolle geratenen Rad abgeworfen wird. Die Karte war von meinen Eltern, der Gruß auf der Rückseite weniger ein bonne voyage als ein letzter verzweifelter Versuch, mich zur Vernunft zu bringen. »Fahr langsam und sei vorsichtig!«, stand dort in der Handschrift meines Vaters, das letzte Wort doppelt unterstrichen. »Noch kannst du es dir anders überlegen«, hatte meine Mutter daruntergeschrieben. »Wir lieben dich, wofür auch immer du dich entscheidest.«
Neben der Karte lag ein schmales Päckchen mit Briefmarken aus Übersee. Ich riss es auf, und die Alarmsirenen elterlicher und nachbarlicher Sorge begannen zu verstummen. In dem Päckchen befand sich eine maßgefertigte Rahmentasche aus schwarzem Leder, gerade groß genug, um eine Brieftasche und ein Handy unterzubringen, mit soliden Druckknöpfen auf den Riemen, die man um das Oberrohr schnürte. Ich hatte die Tasche zwei Monate zuvor bestellt, und sie war in letzter Minute noch eingetroffen. Ich hielt sie in das schwindende Licht und sah, dass mein Sonderwunsch auf packende Weise erfüllt worden war. Knapp oberhalb der unteren Naht, in adäquat archaischer Schrift ins Leder geprägt, standen dort die Worte: »ALFONSO CALZOLARI«.
Irgendeine Drüse spritzte mir einen Cocktail nackter Emotion direkt in die Wirbelsäule. Wer hielt dies überhaupt für eine gute Idee? Bernie offenbar nicht, ebenso wenig meine Eltern, ich eigentlich auch nicht. Aber ich kannte einen Mann, der es anders sah und dessen Namen ich jetzt vor Augen hatte. Dann schmiss ich die alte Kette in die neue Tasche, schnallte sie um das Oberrohr des Hirondelle und fuhr direkt zurück zu Evans, wo ich ein kleines Ersatzkettenglied kaufte und vergeblich versuchte, mir den Kaufpreis des nur eine Stunde zuvor erworbenen, aber inzwischen nachhaltig verschmutzten Stücks erstatten zu lassen.