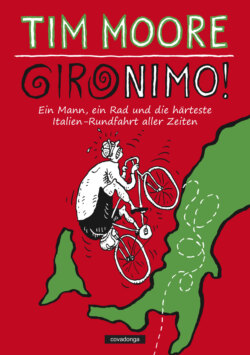Читать книгу Gironimo! - Tim Moore - Страница 7
II
ОглавлениеSeitdem Paolos Buch eingetroffen war, hatte mich die Abbildung des Rennrads der Marke Stucchi fasziniert, auf dem der Giro 1914 gewonnen worden war. Den Diamantrahmen mit seinen dünnen Rohren lediglich als schlicht zu bezeichnen, wäre maßlos untertrieben: eine Rennmaschine ganz ohne Schaltung, mit klobigem Lenker und steinhartem Sattel, in der Werkhalle der Mailänder Firma scheinbar aufs Geratewohl aus einzelnen Teilen zusammengezimmert. Ich musste jedes Mal lächeln, wenn ich das Rad sah: unverfälscht, simpel und ehrlich, der anmutige Gegenentwurf zu den heutigen, 6.000 Euro teuren Profirädern mit ihrer reizlosen, von Strömungswiderstand, Werkstoffkunde und Biomechanik bestimmten Geometrie.
Nach einer Weile verhärtete sich dieses Lächeln zur Fratze grimmiger Entschlossenheit. Mit einem Rad wie diesem wäre ich in der Lage, Eddy Merckx und Chris Boardman und il ciclismo eroico auf gebührende Weise die Ehre zu erweisen. Der Generation Armstrong würde ich es schon zeigen: Weg mit Energy-Gels und Titan, her mit Schmalzbroten und schwerem Stahl. War es nicht sterbenslangweilig (und vermutlich auch völlig sinnlos), wenn ich Monate investierte, um für dieses Unterfangen halbwegs in Form zu kommen? Nein, stattdessen würde ich mich fortan einfach auf das konzentrieren, was Männer in meinem Alter eh am besten können: rostigen alten Plunder anhäufen.
Meine ersten Recherchen förderten gute und schlechte Nachrichten zutage: Hundert Jahre alte Rennräder waren weiter verbreitet, als ich erwartet hatte, aber auch wesentlich teurer. Bei eBay wurden für restaurierte Modelle Preise ab 1.500 Pfund aufwärts aufgerufen. Selbst für ein in irgendeinem Schuppen vor sich moderndes Schnäppchen würde ich mindestens 700 Pfund hinblättern müssen. Italiener, wie ich ebenso erfreut wie ernüchtert feststellte, pflegten eine besonders innige Beziehung zu den Rädern aus der goldenen Ära des Sports. Erfreut, weil ich mich schon auf einer Welle der Nostalgie durch malerische Bergdörfer radeln sah, und ernüchtert, weil dies wohl nicht auf einer authentischen italienischen Maschine geschehen würde. Stucchi war eine nicht mehr fabrizierte Marke, deren verbliebene Exemplare offenbar nur noch Ausstellungszwecken dienten. Das Gleiche galt für Räder von Maino, Ganna, Globo und Atala, die 1914 ebenfalls am Start gewesen waren. Das Beste, was ich auftreiben konnte, war ein Bianchi von 1913, damals Stucchis ärgster Konkurrent und die einzige Firma, die auch heute noch produziert. Doch die Pedale passten nicht zusammen, und das gute Stück sollte 3.400 Euro kosten.
Schließlich zwangen mich Ahnungslosigkeit und aufkommende Unruhe dazu, die letzte Grenze männlicher Verzweiflung zu durchbrechen: Ich bat um Hilfe. Auf meiner Suche nach zeitgenössischen Herstellern war mir eine bestimmte Website immer wieder untergekommen, ein französisches Forum für Liebhaber klassischer Räder namens »Tonton Vélo« (was so viel wie »Onkel Stahlross« heißt, aber auf Französisch vermutlich etwas weniger nach dem Spitznamen eines gesuchten Päderasten klingt). Die tontons wussten, wovon sie sprachen, waren gleichzeitig aber erfreulich entspannt bei der Sache. Für jeden fanatischen, bis zum letzten Schräubchen authentischen Nachbau gab es die Geschichte eines verbeulten alten Schrottesels, der in Nachbars Garten aufgetan, in WD-40 eingelegt und durch die Gegend gefahren wurde, bis er in der Mitte durchbrach.
Als Nation, die das Fahrrad erfunden und das erste Radrennen ausgetragen hatte und noch immer die größte dreiwöchige Landesrundfahrt der Welt veranstaltet, hätte ich von Frankreich erwartet, dass es die Relikte aus der damaligen Zeit in allerhöchsten Ehren hielt und mit den entsprechenden Preisschildern versah. Damit lag ich falsch. Wie die schiere Zahl der Berichte über Scheunenfunde vermuten ließ und die dazugehörigen Diskussionen über vergleichsweise bescheidene Summen bestätigten, gab es keinen besseren Ort auf der Welt, um ein äußerst altes Fahrrad zu erstehen. Ich meldete mich bei »Tonton Vélo« an, rief Google Translate auf und bat im Unterforum »Rennräder vor 1945« um Beistand.
Fast sofort erhielt ich eine private Mitteilung von einem Nutzer namens Roger Rivière. Das hätte mir eine Warnung sein sollen: Rivière hatte bei der Tour de France 1960 traurige Berühmtheit erlangt, als er völlig benebelt von Aufputschmitteln eine Begrenzung durchbrach, einen Abhang hinabstürzte und den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbrachte. Wie auch immer, dieser andere Roger machte mich freundlicherweise auf ein Festival für klassische Räder in Nordfrankreich aufmerksam, wo ich vielleicht fündig werden würde. Darüber hinaus schickte er mir einen Link zu einer Anzeige auf Le Bon Coin, dem größten Online-Schnäppchenmarkt seines Landes. Die Anzeige war von Max, der dort den bereits erwähnten Berg ausgedienter Teile für 400 Euro anbot.
Da er schon mit Max gesprochen hatte, hielt Roger das Angebot für einen ziemlich günstigen Deal. Zusätzlich zu einem großen Sortiment willkürlicher Einzelteile umfasste die Sammlung die vollständigen Komponenten zweier altehrwürdiger Maschinen. Eine davon war ein Rennrad aus den 1940er Jahren, das mich außer als Gratis-Dreingabe nicht weiter interessierte. Das andere aber war ein La Française-Diamant.
Nach Ansicht eines per E-Mail geschickten Fotos konnte Roger das Rad lediglich auf den ungefähren Zeitraum zwischen 1910 und 1920 datieren, aber das sollte mir reichen. Ich wusste nicht viel über den Hersteller, aber ich wusste genug: Maurice Garin, der Sieger der allerersten Auflage der Tour de France, hatte damals auf einem La Française-Diamant triumphiert.
Mein Herz machte einen Satz und drohte dann die umliegenden Organe zu erdrücken, als ich bei Google auf eine bewegende Aufnahme stieß, die Garin samt prächtigem Schnauzbart bei der Siegerparade von 1903 auf seinem geschmückten La Française-Diamant zeigte. Eigentlich hatte ich ein italienisches Rad gewollt, aber das vom ersten Tour-de-France-Sieger erwählte Ross war natürlich nicht zu toppen. Aus lauter Begeisterung buchte ich sofort eine Fähre, bevor ich nach draußen ging und den Beifahrersitz aus meinem Auto ausbaute, um Platz zu schaffen für den ganzen wunderbaren Krempel. Dafür brauchte ich vier Stunden, was für das komplexe Bauvorhaben, das vor mir lag, nichts Gutes verhieß.
Von Vorfreude und Energydrinks aus dem Supermarkt befeuert, machte ich mich auf die Reise in den hintersten Winkel der Bretagne, wo mich beim Anblick meiner Beute eine gewisse Beklemmung erfasste. Ich glaubte aus Max’ Worten heraushören zu können – seine Englischkenntnisse schienen sich mit der Begrüßungsformel erschöpft zu haben –, dass das meiste von dem Krempel aus dem Lagerraum eines örtlichen Radgeschäfts stammte, das geschlossen worden war, als der in die Jahre gekommene Betreiber in den Ruhestand ging.
Wenn es mir für einen kurzen Moment gelang, die vor mir stehende mechanische Mammutaufgabe zu vergessen, konnte ich in dem Haufen viel Zauber und Schönheit entdecken. Da war eine braune Papiertüte voller hübsch gravierter Messingklingeln. Ein schöner alter geschwungener Lenker, der aussah, als wäre er aus einem Pariser Metroschild gearbeitet. Mehrere hundert originalverpackte Speichen aus der Zeit zwischen den Weltkriegen. Ein bis zum Rand mit rostigen Ritzeln gefüllter Bleicheimer. Ein halbes Dutzend hölzerner Felgen, eine Kiste mit Bremszubehör und ein Schuhkarton mit Pedalteilen, eine verstaubte Ansammlung von Ledersätteln und Werkzeugtaschen … dazu die bereits erwähnten Vierkantschrauben und ein paar tausend rätselhafte Teile mehr, und eines war klar: Mir würde nun ein ziemlich großer Haufen echt uralten Radplunders gehören. Max, ein untersetzter Bursche mittleren Alter mit kleinem grauen Schnauzbart, hob die Brauen und lächelte erneut. »Il y a beaucoup«, sagte ich.
Mit meinen spärlichen Französischkenntnissen, die in etwa so eingerostet waren wie der Krempel vor mir, fragte ich Max, wo er den ganzen Ramsch herhabe und warum er ihn jetzt verkaufe. Statt einer Erklärung führte er mich durch die Garage in einen Kellerraum, in dem ein auf Hochglanz poliertes klassisches Motorrad stand.
»Ma Vélocette«, seufzte Max und deutete zärtlich auf diese Sinfonie aus glänzendem schwarzen Lack und Chrom. Ich entnahm seinen Ausführungen, dass er das La Française-Diamant zu seinem nächsten Projekt auserkoren hatte. »Mais, uh, ma femme …« Mit einem resignierten, von bastelwütigen Ehemännern auf der ganzen Welt perfektionierten Achselzucken gab Max mir zu verstehen, warum er das Vorhaben widerwillig auf Eis hatte legen müssen.
Sonderlich weit war er im Übrigen noch nicht gekommen. Eine einzige Bremszange war vernickelt worden, und er hatte den Rahmen grob mit einer weißen Grundierung lackiert. Das bot einen eher traurigen Anblick, aber immerhin hatte Max wohlweislich vorher das Steuerkopfschild mit dem La-Française-Diamant-Emblem vom Rahmen entfernt.
Dieses wurde nun wie eine Reliquie in einem winzigen Gläschen verwahrt: ein Miniaturfirmenschild mit dem Namen der Marke darauf, deren Herkunftsort – Paris – und fünf sternförmig angeordneten Diamanten. Genau das Hersteller-Emblem, das bei der ersten Austragung der Tour de France das Zielband durchtrennt hatte. Ich schaute es mit dem gleichen Entzücken an, mit dem bei Indiana Jones der eine Nazi den verlorenen Schatz geöffnet hatte, dann steckte ich es mir lieber schnell in die Tasche, bevor mein Gesicht zu schmelzen drohte.
Es war fast dunkel, als ich meinen Wagen bis unters Dach mit dem ganzen Schrott vollgepackt hatte und mich mit einem Wendemanöver, das infolge der eingeschränkten Sicht überaus heikel ausfiel, auf den Rückweg durch die Bretagne machte. Während rostige Rohre mich im Nacken kitzelten und ich wegen des säuerlichen Geruchs nach Eisen und Öl permanent die Nase rümpfte, sinnierte ich erneut darüber, welcher Teufel mich geritten hatte, mir eine Aufgabe vorzunehmen, an der schon ein weitaus fähigerer Mann gescheitert war (oder zumindest das Interesse verloren hatte). Bei zahlreichen köstlichen Crêpes, die Madame Max zubereitet und mir mundgerecht gefaltet einverleibt hatte, war ich über die vielen maßgeblichen Qualitäten aufgeklärt worden, die ihren Gatten auszeichneten und mir vollkommen abgingen. Max war gelernter Klempner und ein Bastler vor dem Herrn, der nicht nur alte Motorräder auf Vordermann brachte, sondern auch Modelle japanischer Architektur aus dem 19. Jahrhundert anfertigte. Er hatte die Möbel hergestellt, auf denen wir saßen und an denen wir aßen, und war außerdem Landschaftsgärtner und Kommunist. Es gab aber durchaus Gemeinsamkeiten. Denn wie sich herausstellen sollte, war Max darüber hinaus auch ein gewaltiger Maulheld.
Als ich ein paar Tage später in der Zeitung blätterte, stieß ich auf die große Aufnahme eines demontierten Fahrrads, Teil eines Projekts eines kanadischen Fotokünstlers, der Alltagsgegenstände in ihre einzelnen Komponenten zerlegt und dann ablichtet. Ich hatte mir Fahrräder immer als einen Triumph zweckmäßiger Ingenieurskunst vorgestellt. Für mich waren sie stets eine Erfindung gewesen, deren weltweiter Erfolg vor allem auf ihrer mechanischen Simplizität beruhte. Das demontierte Rad auf dem Foto war ein recht schlichtes Raleigh aus den 1980er Jahren, und doch war diese Maschine, wie ich erfuhr, aus sage und schreibe 893 Teilen zusammengesetzt. Eine überwältigende Menge, die in adretten, nach geometrischen Formen angeordneten Häufchen um den Rahmen gruppiert war. Daneben waren eine auf ähnliche Weise zerlegte Digitalkamera und eine Kettensäge zu sehen, die es zusammen auf 48 Einzelteile brachten.
Ich starrte auf dieses entsetzliche Bild und spürte, wie mir der Appetit verging. Ungewollt wurde vor meinem geistigen Auge meine bisherige Karriere als Radmechaniker abgespult. Das dauerte nicht lange. Mit zwölf konnte ich einen Platten reparieren, sofern dafür nicht die Demontage des Hinterrads erforderlich war, dafür war mein Vater zuständig. Mit vierunddreißig war ich in der Lage, Bremsbeläge auszutauschen. Die Zeit zwischen diesen herausragenden Triumphen war eher vom Scheitern als von Erfolgen geprägt. Mechanisches Geschick war nicht mein Freund. Mechanisches Geschick rief nicht an und schrieb auch nicht. Trotz vieler, mit schmutzigen Händen und ebensolchen Flüchen zugebrachten Stunden war es mir nie auch nur im Ansatz gelungen, die billigen Dreigangschaltungen meiner frühesten Gefährte vernünftig einzustellen. Die Vorrichtungen der Marke Sturmey-Archer neigten dazu, einen genau dann im Stich zu lassen, wenn man sie am dringendsten benötigte, etwa wenn man aus dem Sattel ging, um die ersten steilen Rampen des Hanger Hill zu bewältigen, oder wenn es ratsam war, überstürzt die Flucht vor den Reißzähnen eines unangeleinten Kampfhundes zu ergreifen. Und wenn sie einen im Stich ließen, dann bekam man das auch zu spüren. Hatte man Glück, führte der jähe Verlust des mechanischen Widerstands lediglich dazu, dass man mit dem Unterleib heftig auf den Sattel krachte. Hatte man Pech, war es das Oberrohr.
Anstatt mich damit zu beschäftigen, wie sie funktionierten und was zu tun war, falls sie es einmal nicht taten, konzentrierte sich meine Leidenschaft für Fahrräder fast ausschließlich auf mögliche Verschönerungen. Einen beträchtlichen Teil meiner Kindheit in Ealing verbrachte ich vor dem Schaufenster von B & L Accessories in der St. Mary’s Road, wo ich sehnsüchtig auf Gummiballonhupen und Rallyestreifen-Aufkleber schaute und im Gefühl demütiger Unwürdigkeit auf die ausgestellten Tachometer von Huret. Mein größter Wunsch war es, meinen Lenker mit einer dieser verchromten französischen Schönheiten zu verzieren. Welche Wonne, sich vorzustellen, wie die rote Nadel auf einer rasenden Abfahrt den Hanger Hill hinab zitternd über die Art-Deco-Ziffern wanderte, bis über die bei 40 Meilen pro Stunde endende Skala hinaus. Dann blickte ich mit einem unterdrückten Seufzer auf den Preis – eine vergessene, aber exorbitante Summe – und sah ein, dass ich weiterhin mit meinem kleinen, an der Gabel montierten Kilometerzähler vorlieb nehmen musste, der mir vorgaukelte, der heimische Gunnersbury Park habe in etwa dieselben Ausmaße wie Belgien.
Im Laufe der folgenden Jahre sorgte ein wachsendes Maß an Zuverlässigkeit dafür, dass grobmotorisches Ungeschick und strunzdoofe Unfähigkeit ein immer geringeres Handicap für Radeigentümer darstellten. Als sich das 20. Jahrhundert seinem Ende näherte, befuhr ich den Londoner Südwesten auf einem schäbigen Trekkingbike aus chinesischer Fabrikation, dem auch ein fahrlässiger Verzicht auf jegliche Pflege und Wartung nichts anhaben konnte. Nichts nutzte sich oder brach ab, und sämtliche Probleme, die auftauchten, bewegten sich im Rahmen meiner mechanischen Möglichkeiten, sofern nicht die Demontage des Hinterrads erforderlich war, dafür war mein Bruder zuständig. Das brandneue, recht schnittige Rennrad, mit dem ich im Jahr 2000 meine Tour de France unternahm, war sogar noch genügsamer. Auf einer Strecke von mehr als 3.000 Kilometern hatte ich nur einen einzigen Platten zu beklagen. Hin und wieder lief einer der 27 Gänge nicht mehr ganz rund, aber sobald mir das daraus resultierende drrr-tschick hinlänglich auf den Sack ging, um über mögliche Abhilfemaßnahmen nachzudenken, hörte es auch schon wieder auf. Ich hatte damals ausreichend Werkzeuge und Ersatzteile eingepackt, um beispielsweise eine Robotervogelscheuche bauen zu können, brauchte den ganzen Kram aber nicht ein einziges Mal. Irgendein Dahergelaufener kümmerte sich sogar um den Platten, bevor ich es selbst tun musste.
Aber das war Schnee von gestern. Die Herausforderung, aus einem Haufen Schrott ein fahrtüchtiges Fahrrad der Marke La Française-Diamant zu bauen, stellte eine raue und rostige Rückkehr zur Ära der notdürftigen Flickschusterei dar. Ich war seit einer Woche aus der Bretagne zurück und hockte mit langsam verpuffender Begeisterung auf der Terrasse. Der Haufen der Teile, die ich definitiv nicht brauchen würde – in erster Linie das Rad aus den Vierzigern und drei kaputte Holzfelgen –, wurde von den beiden Haufen mit Teilen, die ich auf jeden Fall oder vielleicht brauchen würde, deutlich in den Schatten gestellt. Den ersten Haufen verstaute ich im Schuppen, den letzten türmte ich unter einer blauen Plastikplane auf, die scheinbar sämtliche Katzen der Gegend mit einem Klo verwechselt hatten. Ich brauchte vier Stunden, um aus dem Rest etwas zusammenzupfuschen, das entfernt an die Pinseleien auf Radwegen erinnerte, und das ganze Gemenge auf meinem neu erworbenen Montageständer aufzubocken.
Aus der Ferne betrachtet sah es gar nicht so übel aus: Sattel, zwei Räder, Lenker, ab dafür. Aber je mehr man sich dem Gerät näherte, desto ersichtlicher wurden die Mängel. Die Holzfelgen, die sich als resistent gegen mein ungeschultes Gefummel erwiesen hatten, waren mehr schlecht als recht mit drei Speichen und Kabelbinder an der Nabe befestigt. Der so hübsch gearbeitete Lenker war durch und durch von dem Rost zerfressen, der meine Hände in den folgenden Monaten mit einer ständigen ockerfarbenen Patina überziehen sollte. Der einzige Sattel, den an der Sattelstütze zu montieren mir gelang, war vermutlich erst vor kurzem an der Somme ausgegraben worden.
Alles andere glänzte durch Abwesenheit. Aus dem Bremsgedöns, das Max mir überlassen hatte, war ich beim besten Willen nicht schlau geworden – insgesamt waren es vielleicht zwei Dutzend Sets, die in einer hölzernen Bierkiste durch Rost zu einer einzigen Skulptur verschmolzen waren. Ebenso hatte ich gar nicht erst versucht, mich mit den Lagerschalen, den Dichtungen und den verstaubten, ölverschmierten Einmachgläsern voller Kugellager zu beschäftigen. Diese Teile waren alle mehr oder weniger wichtig für das Tretlager, das gewissermaßen als »Motorraum« des kompletten Fahrrads in das kreisrunde Loch unten im Rahmen gehörte, dort, wo Unter- und Sitzrohr zusammenliefen. Daher hatte ich auch noch keine Pedale montiert (acht standen zur Wahl), keine Kurbeln (sechs), kein Kettenblatt (drei) und keine Kette (kreisch, nur die eine).
Ich schaute mir das Teil mit halbgeschlossenen Lidern an, dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es war schon zutreffend, dass sich Fahrräder in den letzten hundert Jahren nicht groß verändert hatten. Es war aber noch weitaus zutreffender, dass dieses Fahrrad hier sich enorm verändern müsste, und zwar bald, wollte ich darauf vor dem ersten Schnee die Alpen hinauffahren. Für einen Optimisten wäre dieses radähnliche Kreuzigungsopfer auf dem Montageständer vielleicht so etwas wie ein Anfang gewesen. Für einen Pessimisten aber – nennen wir ihn Tim – sah es eher nach dem Ende aus, wie ein überambitioniertes, »aufgegebenes« Projekt, das ein ratloser Depp bei eBay reingestellt hatte, um wenigstens ein paar Euro, sagen wir 400, wieder reinzuholen.
Ganz offensichtlich brauchte ich Hilfe, und meine geschätzten tontons konnten mir nach ein paar Mausklicks zumindest ein wenig davon geben. Viele ihrer Ratschläge erwiesen sich als erfreulich unkompliziert. So lernte ich beispielsweise, dass sich die äußeren Spuren der Korrosion durch ein langes Bad in einer reinigenden Lösung aus Zitronensäure wie von Zauberhand beseitigen ließen. Alles an dieser Technik war großartig: die leicht anrüchige Anschaffung und Anlieferung großer Mengen an Chemikalien … der ganze, ein Dutzend Bratenformen und eine Schutzbrille umfassende Prozess des Anrührens und Eintauchens auf der Terrasse … die Mutantenbutterblumen, die inzwischen an der Stelle zwischen den Pflastersteinen wachsen, wo ich etwas von der Lösung verschüttet habe. Und welch wunderbarer Anblick es war, den in Zeitlupe sich vollziehenden Wandel alten Metalls vom korrodierten Schrott zur funkelnden, gebrauchsfertigen Komponente zu verfolgen, das geisterhafte Wiedererscheinen der Seriennummern nach Säurebad und anschließender beherzter Bearbeitung mit der Drahtbürste. Ganz besondere Freude bereiteten mir die ausgewählten Stahlkurbeln, die nach der beschriebenen Behandlung den matten Glanz der Unzerstörbarkeit verströmten, wie etwas, das von einer Dampflokomotive aus viktorianischer Zeit stammte.
Ich wusste gar nicht, was mich mehr begeisterte: der restaurative Effekt der Säure oder die Tatsache, dass sich diese hundert Jahre alten Teile auf so simple Art und Weise in einen einwandfreien, einsatzbereiten Zustand versetzen ließen. Abnutzung und Korrosion der Pedale deuteten darauf hin, dass sie zunächst mehrere Dekaden einem höchstintensiven Gebrauch standhalten mussten und anschließend viele weitere Jahrzehnte in einer feuchtkalten Kammer vergessen worden waren. Doch ein einziges Säurebad genügte, und sie waren so gut wie neu. So was wird heutzutage ja gar nicht mehr gebaut. Wozu auch, wenn die Mechanik mit billiger Elektronik interagieren muss, die nach ein paar Jahren erwartungsgemäß und endgültig den Geist aufgibt? Wer repariert schon einen DVD-Player oder eine Festplatte, wenn es günstiger ist, sich einfach Ersatz zu beschaffen? Nichts wird mehr mit Blick auf Dauerhaftigkeit hergestellt. Ist ein modernes Auto erst einmal zehn Jahre alt, hat praktisch jeder Schaden, der ernsthafter ist als eine leere Batterie, den unweigerlichen Abtransport zum Schrottplatz zur Folge. Nichts wird mehr anständig konstruiert. Selbst Löffel halten heutzutage höchstens zehn Jahre. Vor allem, wenn man ständig Zitronensäure mit ihnen umrührt.
Wie sich herausstellte, besaß ich ein ziemliches Talent dafür, Dinge in Zeug einzuweichen und einzuschmieren und sie anschließend abzuspülen oder abzureiben. Ich entfettete Achsen, Naben und Lager mit Terpentin. Den verkrusteten Sattel frischte ich mit dem gesamten Inhalt einer Dose Pferdegeschirrreiniger auf, die ich viele Jahre zuvor für viel Geld erstanden hatte (ich war stark verkatert, Sie wissen ja, wie das ist). Ich wählte die besterhaltene Klingel aus (auf deren vergoldeter Glocke in ornamentaler Belle-Époque-Pracht für F. Pellen Cycles aus Saint Renan geworben wurde, nicht weit von dem bretonischen Kaff entfernt, in dem Max zu Hause war), dazu die vorzeigbarste alte Pumpe, und bearbeitete beides kräftig mit Zahnbürste und Metallpolitur. Dann stellte ich fest, dass ich einen Großteil der Beschichtung abgerubbelt hatte, und machte etwas weniger kräftig weiter. Das waren glückliche Tage voller anspruchsloser, halbwegs gezielter Beschäftigungen, die mir wie eine exzellente Vorbereitung erschienen – wenn auch nicht unbedingt auf meine geplante Reise, aber zumindest auf die Tage heiterer Demenz. Ich glaube, ich hätte ewig so weitermachen können. Das hätte ich auch fast getan, bis ich mich eines Tages dabei ertappte, eine zweite Reserveklingel zu polieren, und einsah, dass es an der Zeit war, mich anderen Dingen zu widmen.
Dafür brauchte ich den Beistand meines Freundes Matthew, der mir vor vielen Jahren schon beim Einrichten meines Tour-de-France-Rads geholfen hatte. Außer sich als Rektor einer erschreckend großen Schule in Wembley zu verdingen, hat Matthew seither einen großen Teil seiner Zeit darauf verwendet, immer imposantere Räder zu kaufen, instand zu setzen und hochzurüsten, um sie über viele tausend Meilen zu fahren. Als ich ihn auf meine Terrasse führte, erwartete ich ein konsterniertes Stöhnen oder gar einen Aufschrei des Entsetzens, aber Matthew betrachtete das rostige Gestell, das verbogene Holz und die Bratformen voller zischendem Altmetall mit gemessener Nonchalance. Er hockte sich hin, um in den Gläsern und Schachteln zu stöbern, und als ich ihn nicken, die Augen zusammenkneifen und mit einigen Teilen hantieren sah, erinnerte ich mich, wie ich damals eine Woche vor meinem Tour-Start vor seiner Tür gestanden hatte. Ich erinnerte mich insbesondere an das verlegene Lachen – nicht dein Ernst, oder? –, mit dem er fast jede meiner in letzter Minute vorgebrachten Fragen quittiert hatte.
Matthew war logischerweise davon ausgegangen, dass ich mir als verantwortungsvoller Vater dreier Kinder zumindest die Grundprinzipien der Wartung angeeignet hatte, bevor ich mich auf eine 3.639 Kilometer lange Radtour begab. Da ich inzwischen zwölf Jahre älter war, hätte ich, sollte man meinen, auch zwölf Jahre weiser sein müssen. Matthew leerte Schachteln mit Gewinderingen aus und drückte mir Unterlegscheiben in die ahnungslosen Pfoten. Ganz offensichtlich waren die Tätigkeiten, die Matthew nun durchführte, für jeden vernunftbegabten Radfahrer mittleren Alters kalter Kaffee. Natürlich würde er mich nicht damit langweilen, mir in allen Einzelheiten darzulegen, welche Werkzeuge für den Ausbau des Lenkkopfs benötigt wurden oder welche Schmiermittel anzuwenden waren oder was genau ein Lenkkopf überhaupt war. Und natürlich würde ich mir nicht die Blöße geben, danach zu fragen. Denn das wäre vermutlich nicht viel anders gewesen, als hätte sich Neil Armstrong beim Countdown noch mal beiläufig danach erkundigt, wofür all die bunten Knöpfe eigentlich gut seien.
Jedes Jahr im Frühling stattete ich Matthew einen Besuch ab, um mit ihm eine oder zwei Giro-Etappen anzuschauen, außerdem im Sommer eine oder zwei Tour-Etappen. Bei meiner Begeisterung für beide Veranstaltungen spielten technische Aspekte nach wie vor eine untergeordnete Rolle, was mich aber nicht davon abhielt, mit herablassenden Bemerkungen und Grunzlauten schamlos einzustimmen, wann immer er an den Ausführungen eines Eurosport-Experten zum Thema Übersetzung oder Fahrposition Anstoß nahm. Wenn er mich während einer der endlosen Werbepausen in den Schuppen führte, um mir sein neuestes Rad oder seine jüngste Titan-Veredelung vorzuführen, sah ich mich genötigt, meine Ahnungslosigkeit mit ein paar herkömmlichen Standardschrauberfloskeln zu überspielen: »Schönes Teil« oder auch »War wohl nicht ganz billig«. So ähnlich lief es auch ab, wenn sich das Gespräch auf das Thema Autopflege, Dachrinnenreinigung oder Umgehung der Hanger Lane zur Rushhour verlagerte. Kurzum: Ich hatte mich einem Freund gegenüber, den ich seit mehr als 30 Jahren kannte, auf entwürdigende Weise als sachkundiger erwachsener Mann ausgegeben.
Matthew ließ mich mit einer Reihe nützlich aussehender Werkzeuge, einem langsam vor sich hin siedenden Gefühl panischer Unzulänglichkeit und der Nummer von Jim Kent zurück, einem ehemaligen Lehrerkollegen. Jim war anscheinend der richtige Mann – freundlich, kompetent, hilfsbereit – am richtigen Ort: einem Radladen. Drei Tage später machte ich mich mit dem Kofferraum voller extrem sauberer, aber mir nach wie vor weitgehend rätselhafter Radkomponenten auf den Weg zu There Cycling in Hanwell, wo ich den ersten von vielen Nachmittagen in Jims kleiner Werkstatt verbrachte, Tee trank, über Lance Armstrong lästerte und an seinem Zentrierständer herumwerkelte wie ein Dorftrottel, der mit Ofenhandschuhen Flachs zu spinnen versucht. »Na ja, ein Rad ist ein Rad«, meinte er lapidar, als ich ziemlich ratlos meine Bierkisten und Schuhkartons zwecks eingehender Begutachtung auf seinem Werkzeugboden ausleerte. »Alles ist machbar, alles lässt sich reparieren.«
Jim ließ sich nicht einmal von meinem besten Satz originaler Holzfelgen beirren, auf dem nach gründlicher Reinigung die bewegende Aufschrift »SUPER CHAMPION« sowie die sauber ausgenagten Spuren von einem Dutzend bretonischer Holzwürmer zum Vorschein gekommen waren. »Könnte gehen, wenn du ein paar Speichen mehr einbaust«, sagte er mit einem Blick auf die einsamen drei, die ich jeweils einzusetzen geschafft hatte. »Hast du schon mal alte Räder repariert?«
»Nicht viele«, antwortete ich lakonisch, ganz im Geiste jenes Schotten, den ich einmal auf die Frage, wie oft seine Nation die Fußballweltmeisterschaft gewonnen habe, in gleicher Weise hatte antworten hören. »Aber was Fahrräder betrifft, bin ich lernwillig.«
Ich ließ Jim in der Werkstatt zurück und schaute mir eine Weile sein Schaufenster an. There Cycling war auf Fahrräder im Retrostil spezialisiert. Ein schrilles Gefährt, das an die Zeiten eines Maurice Garin erinnerte, hatte es mir ganz besonders angetan: glänzender schwarzer Rahmen, lederne Lenkergriffe, wulstige braune Reifen. Es nannte sich Pashley Guv’nor und zielte in erster Linie auf ein posierfreudiges Hipster-Publikum ab, aber als ich meine Augen und Finger über seine wunderbare, dunkle Karosserie gleiten ließ, verspürte ich einen kribbeligen Anflug von Hoffnung und Verlangen. Was immer ich auch tun müsste oder wen auch immer ich überreden müsste, es für mich zu tun, genau so sollte auch mein La Française-Diamant aussehen. Ich würde das LFD nicht nur auf die Straße bringen, sondern auch auf den Corso Sempione in Mailand, zu nächtlicher Stunde am 24. Mai 1914, im Gaslicht schimmernd, bereit für den Giro d’Italia, von Sponsoren und Fans an der Startlinie belagert.
Dieses Vorhaben – eigentlich eine Ausgeburt wahnhaften Irrsinns – reifte dank der mitreißenden Mitwirkung von Lance McCormack zu froher Erwartung heran. Lance war ein Freund von Jim und schaute an meinem zweiten Nachmittag in der Werkstatt von There Cycling vorbei, um mein Projekt in Augenschein zu nehmen. Lance gefiel mir sofort, eine silbermähnige Kreuzung aus mechanischer Allwissenheit, kostspieligem Tuch und schelmischem Schandmaul. Wie sich herausstellte, einte uns ein rührendes Band: Wir waren beide in den Siebzigern in Ealing aufgewachsen und hatten beide einen Großteil der Dekade damit verbracht, unsere Nasen sehnsüchtig an das Schaufenster von B & L Accessories zu pressen. »Kann sein, dass wir gleichzeitig da waren«, sagte Lance. »Nase an verrotzter Nase.«
Im Gegensatz zu mir hatte Lance seinen jugendlichen Enthusiasmus in eine Karriere als Konstrukteur von Maßanfertigungen überführt. Wenn er nicht gerade für betuchte Oldtimer-Liebhaber klassische Automobile nach allerhöchsten Ansprüchen restaurierte, dann tat er das Gleiche mit klassischen Fahrrädern für sich selbst. Seinen Sohn hatte er Merlin getauft, aber nicht etwa nach dem bärtigen Zauberer aus der Sage, sondern zu Ehren eines führenden Herstellers von Titanrahmen.
»Hübsches Scheißding«, sagte er, als er sich herunterbeugte, um ein Kettenblatt aus einer der Schachteln zu fischen. Das war es wirklich: ein feingliedriger Kreis stählerner Herzen, den ich für das Tretlager meines LFD zu verwenden hoffte.
»48, stimmt’s?«
»Erst in drei Wochen«, antwortete ich, bevor Lance’ Miene – und dann seine Stimme – mir nahelegten, mich etwas weniger blöd anzustellen. Er sprach natürlich von der Zahl der Zähne, die das Kettenblatt hatte, und eine Zählung bestätigte seine Einschätzung.
»Herrje. Kennst du die L’Eroica?«
Inzwischen schon: L’Eroica ist der Name eines jährlich ausgetragenen Rennens für historische Rennräder, das über die strade bianche der italienischen Chianti-Region führt, die Überbleibsel jener weißen Schotterstraßen, die 1914 das nationale Straßennetz bildeten. »Bin ich vor ein paar Jahren mit einem 48er gefahren. Vor dem Start kommt ein alter Kauz an und meint: ›Quaranta otto? Verrückter Engländer!‹« Lance imitierte das gequälte Schenkelreiben, mit dem der Senior sein Urteil unterstrichen hatte. »Hatte verdammt recht, der Kerl. Ich litt wie ein bekackter Hund. Wohlgemerkt, zwei andere Typen sind damals verreckt.« Lance ließ diese verstörende Info im Raum stehen und wühlte weiter munter in den Kisten. »Sieht aus, als hättest du alles beisammen«, meinte er schließlich. »Kommt halt darauf an, wie weit du damit kommen willst. Ich mag es, wenn ein Rad so aussieht wie damals, als der erste Eigentümer es aus dem Laden schob.« Er hielt inne, um mir auf seinem Handy ein Foto des aktuellen Prunkstücks seiner Flotte zu zeigen, ein Hetchins von 1947, in genau dem von ihm beschriebenen Zustand. »Falls es das ist, was dir vorschwebt, kann ich dir helfen.«
Das war es unbedingt, und so fuhr ich ein paar Tage später mit Max’ schäbigem weißen Rahmen in ein altes Gewerbegebiet am Grand Union Canal in Uxbridge. Das Gelände war der vielleicht männlichste Ort der Welt, ein marodes Labyrinth finsterer Wellblechhütten, die alle ihren ganz eigenen mechanischen Lärm und Geruch verströmten. In der schummrigsten und entlegensten Hütte waren die von Lance empfohlenen Sandstrahlgebläse untergebracht. Ernüchternderweise bestand mein erster ernsthafter Schritt voran in meinem Projekt streng genommen darin, einen Schritt zurück zu machen, nämlich Max’ grässliche Grundierung wieder zu entfernen. Ich vergewisserte mich mittels eines Zettels, den Lance mir mitgegeben hatte, dass ich an der richtigen Hütte war, und prägte mir noch einmal seine daneben gekritzelte Anweisung ein: »NICHT ZU HART RANGEHEN!«
Im Inneren hatten sich drei Männer um eine Sandstrahlkabine versammelt, in der etwas Metallisches von Farbe und Rost befreit wurde. »IM ZWEIFEL BLEIBEN LASSEN«, lautete ein Warnhinweis neben der infernalischen Maschine, und während ich darauf wartete, dass einer ihrer drei Bediener Notiz von mir nahm, fragte ich mich, wie oft ich diesen weisen Rat in den nächsten Monaten wohl missachten würde. Schließlich bemerkte mich ein Mann mit einer unangezündeten Selbstgedrehten im vergilbten Bart und bedeutete mir, dass wir uns draußen unterhalten könnten.
Mit einem Namen wie Elliot Percival sollte man seine Zeit eigentlich darauf verwenden, Napoleon auszuspionieren oder Dienstmägde zu entjungfern, aber der Mann, der mir jetzt gegenüberstand, hatte sich nach mehreren Jahrzehnten als Software-Entwickler stattdessen dem Sandstrahlgebläse zugewandt. »Ich wollte einfach mal dreckig werden«, sagte er und kratzte eine Wange, die von der erfolgreichen Umsetzung dieses Vorhabens zeugte. »Heutzutage weiß ich nicht einmal mehr, wie man einen Computer einschaltet.« Mein Rahmen und die demontierte Gabel wurden rasch in Augenschein genommen. »Sieht alt aus. Wie alles, was Lance anschleppt.«
Ich zuckte nachlässig die Achseln. »Hundert Jahre, so um den Dreh.« Ein männliches Schniefen, eine dramatische Pause. »Nicht zu hart rangehen.«
Ich hatte keine Ahnung, was ich da erzählte, aber es fühlte sich toll an, es auszusprechen, draußen im staubigen, terpentingetränkten Sonnenlicht zu stehen und mit rauchenden Kerlen in Blaumännern zu quatschen. Orte wie dieser waren jetzt mein Revier. Männer wie Elliot waren jetzt meine Leute.
Mit neu entfachter Begeisterung zog ich meinen Blaumann in den folgenden Wochen kaum noch aus. Da ich schon fast alles, was Max mir verhökert hatte, in Zitronensäure versenkt hatte, suchte ich nach neuen, schmutzverkrusteten Haushaltsgegenständen, die ich einem reinigenden Bad unterziehen könnte: Dosenöffner, Gartenscheren, das Handstück unserer elektrischen Zahnbürste. Meine ersten zaghaften Schritte in Richtung fachgerechter Wartung unternahm ich mit der Pumpe, die hübsch aussah, aber nicht funktionierte. Mein Herz machte einen jubilierenden Sprung, als ich feststellte, dass der aufbewahrte Schlauch einer lange entsorgten Luftpumpe genau in die entsprechende Öffnung passte, und dann noch einen, als eine Lederscheibe aus meiner Schublade alter Dichtungen sich als perfekter Ersatz für den verwitterten Schrott im Inneren der Pumpe erwies. Nie war ein lautes Zischen so enthusiastisch bejubelt worden.
Was für ein Fest. Ich hatte das Gefühl, endlich selbst Teil jener reichen einheimischen Bastler- und Tüftler-Tradition zu werden, die von der industriellen Revolution bis in mein frühes Erwachsenenalter währte, als das Auseinandernehmen kaputter Gegenstände und das anschließende Wiederinstandsetzen mit Hilfe der verwertbaren Teile anderer kaputter Gegenstände eine der Kernkompetenzen des britischen Mannes gewesen war. Auch mein Vater hatte sich in dieser Disziplin hervorgetan, insbesondere was den letztgenannten Aspekt anging. Weitläufige Bereiche im Haus meiner Eltern sind auch heute noch der Lagerung alten Schrotts vorbehalten, »den man vielleicht noch mal gebrauchen kann«. Die Schwestern meiner Mutter erzählten sich früher gegenseitig abenteuerliche Geschichten über die Beutezüge meines Vaters: Einmal machte eine der Tanten schmerzhafte Bekanntschaft mit dem Armaturenbrett unseres Ford Zephyr, nachdem ihr Schwager beherzt in die Eisen gegangen war, weil er eine einzelne Schraube im Rinnstein erblickt hatte. (»Ja nun«, meinte er 30 Jahre danach, »war immerhin eine Drei-Zoll-Kreuzschlitzschraube.«)
Leider habe ich von meinem Vater nicht das mechanische Talent, dafür aber die Sammelleidenschaft für wertlosen Plunder geerbt, weswegen das Regal unter unserer Treppe von einem Plastikschrank dominiert wird, in dem sich überzähliger Ikea-Kleinkram, ausgebaute Waschmaschinenmotoren und weitere drei Dutzend Schubladen voller nie entsorgter Eisenwaren befinden, unter anderem eine mit der Aufschrift »Drecksnägel«. Zwanzig Jahre lang hatte ich die Versuche meiner Frau, die immer größer werdende Sammlung zu rationalisieren, zurückgewiesen und mit schwindender Glaubwürdigkeit darauf gepocht, dass ihre große Stunde eines Tages schlagen werde. Und jetzt war es so weit.
Wie aus dem Nichts begannen bedeutende Dinge sich zu vollziehen. Ich holte meinen sauber geblasenen Rahmen samt Gabel bei Elliot ab und gab beides ein paar Meter weiter in der von Lance empfohlenen Karosseriebaubude ab, zusammen mit zwei Litern original antikem, schwarzem Zelluloselack, die ich unter großen Schwierigkeiten aufgetrieben hatte. (Der Gebrauch der Substanz ist so aufregend, dass die EU sie 2007 verboten hat.) Drei Tage später war ich wieder auf meiner Terrasse und knibbelte mehrere Meter Luftpolsterfolie ab, um den tiefen und zeitlosen Glanz meines frisch lackierten Rahmens freizulegen. Ich war ganz hin und weg davon, wie hin und weg ich war. Wer war dieser neue Tim, der angesichts einer Raute aus Metallrohren, die irgendein Vogel in Uxbridge schwarz gesprüht hatte, fast außer sich war vor Erregung? Der beinahe so etwas wie Scham empfand angesichts des Kontrasts zwischen der schimmernden Herrlichkeit dieses Diamantrahmens und den kaum vorzeigbaren Komponenten, die er daran anbringen wollte? Der sich nicht nur vornahm, diesen Kontrast zu beseitigen, sondern das auch mehr oder weniger schaffte?
Dank der tonton-Archive entdeckte und meisterte derselbe neue Tim auch »la méthode Piotr«, was nach einer Praxis klingt, mit der man eine ganze Gemeinde gegen sich aufbringen kann, tatsächlich aber nur eine potente Poliertechnik bezeichnet, die nach dem polnischstämmigen tonton benannt ist, der sie ersonnen hat. Die Piotr-Methode geht so: Man tränke sehr feine Stahlwolle in Autopolitur und reibe sie sanft ein, dann sanft wieder aus, dann noch mal und noch mal und noch mal. Tim 2.0 erstand zudem eine Reihe Mikrofasertücher und mehrere feine Polierwerkzeuge für seinen Elektrobohrer. Er ließ aus Frankreich eine große Dose rostfreien Metalllacks kommen, eine grauenvoll übelriechende Substanz, die zwei Wochen zum Trocknen brauchte und für viele der hartnäckigen Flecken verantwortlich war, die noch heute unsere Terrasse besudeln. Der neue Tim war alles in allem ein echter Pfundskerl, ein unermüdlich emsiger Fürst des Firnis, der, wie so viele vor ihm, erst an der Großen Rundmachung des Rades scheitern sollte.
Matthew hatte bereits angedeutet, welches meine härteste Prüfung sein würde, als er vom Laufradbau – der Tätigkeit, eine Nabe mittels einer Ladung Speichen mit der Felge zu verbinden – als der »dunklen Kunst« sprach. Ich hatte die Sache wochenlang aufgeschoben, bis ich eines schönen Morgens nicht anderes zu tun hatte, außer vielleicht Künsten nachzugehen, die mir noch dunkler erschienen, wie zum Beispiel aus den Bremsen und dem Tretlager schlau zu werden. Aber zur Sache: Nachdem das letzte Kind Richtung Schule verschwunden war, hockte ich mit einer hölzernen »Super Champion«-Felge zwischen den Knien auf der Terrasse. Auf den Fliesen um mich herum lagen viele Päckchen der neuen alten Speichen von Max in verschiedenen Längen und Stärken, daneben eine große Erbsendose (sehr fein), deren Inhalt – ölige Blechnippel – von Max als très important gepriesen worden war, und ein detaillierter Leitfaden, den ich mir von der fabulösen Website von Sheldon Brown ausgedruckt hatte, dem inzwischen leider verstorbenen Guru unter den Fahrradmechanikern. Die Speichen eines Rades in der von Sheldon empfohlenen Anordnung »36, dreifach gekreuzt« zu drapieren, war eine Sache von Minuten. Insgesamt 240 waren es handgestoppt, nachdem ich zwei Mal gleich den Einstieg vermasselt hatte und danach ein Versuch in einem ganz besonders kurzweiligen Fiasko geendet war. Bis ich schließlich auch das zweite Rad fertighatte, war das letzte Kind aus der Schule heimgekehrt, hatte zu Abend gegessen und sich schlafen gelegt.
Am nächsten Tag regnete es. »Denk nicht mal daran, diesen Dreck hier drinnen zu veranstalten«, sagte meine Frau, als sie zur Arbeit ging. Das schrie nach einer griffigen Riposte Nippel und Schläuche betreffend, aber mir war schon lange der Spaß am Thema vergangen. Trotzdem wollte ich die Sache endlich hinter mich bringen, also fing ich, als ich das Haus endlich für mich hatte, direkt auf dem Küchenboden damit an, den Dreck zu veranstalten.
Im Laufe der folgenden 72 Stunden stellte ich fest, dass meine Kinder inzwischen ein Alter erreicht hatten, in dem ein aufgebracht schimpfender Vater nicht mehr gefürchtet, sondern bemitleidet und hinter seinem Rücken ausgelacht wird. Mein wütendes, verdrehtes Gehocke bescherte mir außerdem die das Leben zur Hölle machende Berufskrankheit Stellmacherkrampfarsch, meine erste Erfahrung mit arbeitsbedingtem Leiden, seitdem ich in meiner Schulzeit mit Asteroidfinger und Geizhalsdarm gerungen hatte.
Mein Bruder, der ein wesentlich verständigerer Radschrauber ist, als ich es bin, und auf einschlägige Erfahrungen zurückgreifen kann, kam eines Tages herüber, um mich zu beraten. Das Streben nach Rundheit, erläuterte er, war eine Sache filigraner Justierungen, eine Viertelspeichendrehung im Uhrzeigersinn hier, eine klitzekleine halbe Speichenbiegung gegen den Uhrzeigersinn dort. Er erklärte mir die Physik – das Spannen einer Speiche zog die Felge in Richtung der Kante, durch die die Speiche gezogen war, oder irgendetwas in der Art –, dann demonstrierte er mir die Praxis. Abgerundet durch geneigten Kopf und leises Lächeln bot er ganz das Bild eines gütigen Klavierstimmers in Ausübung seiner gelehrten Tätigkeit. Zehn Minuten nachdem er gegangen war, mühte ich mich mit dem Rad wieder fluchend wie ein besoffener Piratenkapitän auf hoher See ab. Ich schleppte den kolossalen Montageständer ins Haus und rammte entnervt eine Felge in das Ausfallende meines LFD-Rahmens, um meine zum Scheitern verurteilte Jagd nach der Kreisform besser kontrollieren zu können. Mein ungeschicktes Wüten mit dem Speichenspanner bereitete so manchem alten Nippel ein trauriges Ende und machte zudem meinen geschundenen Schultergelenken den Garaus. Meine Daumen brannten, mein Hintern winselte um Gnade.
Als meine Frau heimkehrte und die Küche von einem Stellmacherlehrling und den vielen Werkzeugen seines nicht beherrschten Handwerks in Beschlag genommen vorfand, blieb ihr der lautstarke Protest nach einem Blick auf meine entsetzliche, von Zorn, Schweiß und WD-40 entstellte Fratze im Halse stecken. Die Familie verzog sich mit einer Mahlzeit aus der Imbissbude ins Wohnzimmer und ging dann schweigend nach oben und zu Bett.
Fünf Stunden später kroch ich auf allen vieren hinterher. Es war mir gelungen, ein Laufrad ohne Seitenschlag zu vollenden, aber das hatte seinen Preis. Um die störrische Verwindung der Felge auszugleichen, hatte ich auf eine völlig neuartige Mischung zurückgreifen müssen: 32 Speichen hatten dasselbe Maß, die übrigen vier fielen einen halben Zoll länger aus. Ich glaube nicht, dass Sheldon Brown das gutgeheißen hätte, und freilich eierte das Rad ein wenig, als ich es rotieren ließ, um es von der Seite zu begutachten, aber eigentlich sah es ganz gut aus. Jedenfalls besser als die zweite Felge, die eher an das maßstabsgetreue Modell der Olympiaskulptur von Anish Kapoor erinnerte.
»Weißt du, was ein Möbiusband ist?«, fragte mich mein Sohn drei Tage später, als es wieder gefahrlos möglich war, das Thema Laufräder anzusprechen. Ich googelte den Begriff und verstand, was er meinte. Dann packte ich die Felgen und alles, was mit ihrer verfluchten Justierung zu tun hatte, in eine große Plastiktüte und verstaute sie in der hintersten Ecke des Schuppens.