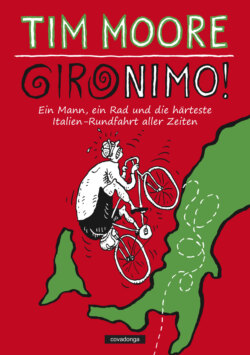Читать книгу Gironimo! - Tim Moore - Страница 8
III
Оглавление»Bitte, Herr Coppi«, fragte der arglose junge Reporter, »können Sie uns verraten, was dazugehört, um ein so großer Champion zu werden?«
»Dafür muss man drei Dinge tun«, entgegnete der Campionissimo, beugte sich vor und sprach in bedeutungsvollem, vertraulichem Tonfall. »Rad fahren«, gespannt rückten die Umstehenden näher, »Rad fahren und nochmals Rad fahren.«
Mir standen noch zahlreiche harte Prüfungen am Zentrierständer in der Werkstatt von There Cycling bevor, aber um meine Seele als Vorbereitung darauf zu reinigen, zog ich mich, wenn auch etwas verspätet, in mein Trainingslager zurück.
Die wichtigsten Bestandteile diesen hochmodernen Camps waren ein Rollentrainer und ein großer Fernseher. Praktischerweise befand sich das alles auf unserem Dachboden. Um ein Kettenblatt mit 48 Zähnen zu treten, würde ich meine körperliche Fitness deutlich verbessern müssen, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass mir das in den folgenden Wochen auch ein Stück weit gelang.
Der Grundstein meines Programms – und offen gestanden auch alle anderen Steine, dazu die Dachziegel, die Türen und Fenster – bestand darin, während der Liveübertragungen richtiger Radrennen zu trainieren. Der Giro d’Italia 2012 startete am 5. Mai – natürlich in Dänemark – und ab dem Prolog saß ich im Sattel, um meine Beine wieder an dauerhafte kreisförmige Bewegung und meinen Schritt an das leicht verstörende Gefühl dicker Polsterung zu gewöhnen. Ich riss das Velux-Fenster auf, zog mich bis auf Shorts, Socken und Schuhe aus und stellte ein paar Wasserflaschen auf einen Tisch neben dem Rollentrainer. So war ich dabei, wie besessen in die Pedale tretend, als Mark Cavendish gegen Ende der dritten Etappe bei Tempo 70 böse zu Fall kam und sich schließlich auf einem Bein, das gut in die Auslage eines Schlachters gepasst hätte, über die Ziellinie schleppte. Ich war dabei, als er sich irgendwie wieder so weit erholt hatte, um drei Tage später den Massensprint zu gewinnen. Und ich war, im Wiegetritt den auf Maximum eingestellten elektromagnetischen Widerstand bearbeitend, auch bei der Königsetappe dabei, einer furchterregenden Höllenfahrt über mehrere Alpengipfel, die mit einer Bergankunft oben auf dem knapp 2.800 Meter hoch gelegenen Stilfser Joch endete. Dieser Anstieg hatte mir schon einmal fast den Rest gegeben, als ich ihn neun Jahre zuvor in Angriff genommen hatte, am Steuer eines Peugeot 206.
Allerdings war ich nur dabei, aber nicht wirklich mittendrin. Um genau zu sein, schaffte ich es kein einziges Mal, eine einzelne Etappe länger als drei Stunden mitzufahren – dafür war es einfach zu langweilig auf der Rolle.
Mal abgesehen von meinen mannigfachen körperlichen Defiziten bereitete mir insbesondere meine Unfähigkeit Sorgen, die gleiche Konzentration wie das Peloton an den Tag zu legen: Meine Selbstdisziplin war kläglich klein und meine Begabung zur inneren Motivation anscheinend nicht existent. Ich ließ mich von der traumhaften Landschaft ablenken oder von der voluminösen Haarpracht des Rennarztes, dann schaute ich schließlich weggetreten runter und bemerkte, dass meine Beine aufgehört hatten zu treten. Wann immer ich vor der Wahl stand, mich entweder auf dem Dachboden eine Stunde lang auf den Rollentrainer zu setzen oder aber auf der Terrasse dämlich auf die einzelnen Teile des La Française-Diamant zu glotzen, setzte sich dämliches Glotzen jedes Mal durch.
Anfangs versuchte ich immer, eine Trittfrequenz aufrechtzuerhalten, die dem Überschwang des Eurosport-Kommentators angemessen war – Holen sie den großen Dänen noch ein? Ich glaube nicht, dass sie es schaffen, ich glaube nicht, dass sie es können! –, aber früher oder später verfiel ich unweigerlich in ein lahmarschiges Stampfen, das eher dem kaum verständlichen, eintönigen Geschwafel des neben ihm in der Reporterkabine hockenden Experten Sean Kelly entsprach. Kellys packende Heldentaten als unbezwingbarer Asphaltfresser der achtziger Jahre mit dem stockenden Genuschel eines gälischen Untoten, mit dem er heute seine Brötchen verdient, in Einklang zu bringen, war ein freudloses Unterfangen. Faselte Sean davon, dass ein Fahrer »äh, echt ganz schön leidet« – was er mindestens ein Dutzend Mal pro Etappe tat –, klang er dabei in etwa so mitreißend wie ein gelangweilter Sprachcomputer, der »Blue Monday« summt. Ich habe mich sehr bemüht, echt ganz schön zu leiden, ganz ehrlich, aber sobald ich mir vorstellte, wie Sean seinen Osterinsel-Schädel Richtung Mikrofon neigte, wurden meine Pedale zu Blei. Dass sich zwischen mir und meinen Kollegen im Fernsehen ein ausgeklapptes Schlafsofa befand, auf dem kuschelige Kissen verstreut lagen, machte die Sache nicht einfacher.
Während mein virtueller Giro d’Italia langsam versandete, versuchte ich, seinen zahlreichen Enttäuschungen etwas Positives abzugewinnen. Zwölf Jahre zuvor hatte ich mich mit etwa 19 Trainingskilometern in den Beinen zu meiner Tour de France aufgemacht. Wäre es nicht sagenhaft, redete ich mir ein, wenn auch ein Mann in meinem fortgeschrittenen Alter eine solche Mammutaufgabe ohne entsprechende Vorbereitung durchstehen könnte? Sagenhaft und möglicherweise von bahnbrechender medizinischer Bedeutung. Was dem einen monumentale Faulheit, ist dem anderen ein kühnes und selbstloses wissenschaftliches Experiment.
Mein Trainingsprogramm siechte also dahin, und nun mussten auch meine Restaurationsarbeiten noch zwei empfindliche Rückschläge hinnehmen. Eines Nachmittags war ich in Jims Werkstatt, auf den Knien, eines der windschiefen Laufräder in den Zentrierständer eingespannt, als Lance hereinschneite.
»Authentizität ist natürlich wichtig«, sagte er mit einem skeptischen Blick auf das Rad und den bunten Haufen ungleicher Speichen, die ich daran anzubringen hoffte. »Aber das gilt auch für Komfort und Sicherheit.« Er bückte sich, um die Felge in Augenschein zu nehmen. »Sind das Holzwürmer?« Ich sagte, dass das schon möglich sei. Lance richtete sich auf und zog die Manschetten seines tadellosen Überziehers gerade. »Nichts gegen ein bisschen Nervenkitzel, mein Freund, aber auf den Felgen würde ich nicht mal zum Einkaufen fahren, geschweige denn eine verdammte Tour quer durch Italien.«
Als ich nach Hause kam, wartete in meinem Posteingang eine zweite Meinung. Einer von Jims Stammkunden, angesichts meiner jämmerlichen Versuche am Zentrierständer offenbar in Sorge, hatte mich mit Harry Rowland bekanntgemacht, dem Guru der britischen Laufradbauer. Ich hatte Harry ein paar Bilder meiner missratenen Holzfelgen sowie der alten Speichen und Nippel gemailt. Seine Antwort fiel kurz und unmissverständlich aus: »Die letzten Holzfelgen habe ich vor 25 oder 30 Jahren verbaut, aber selbst damals hatte ich Probleme. Wenn ich mir Ihre Sachen so ansehe, würde ich auf jeden Fall neue Speichen und Nippel und wohl auch neue Felgen empfehlen.«
Schweren Herzens akzeptierte ich das fachmännische Urteil. Mein Streben nach sklavischer Reproduktion war damit vorbei: Mein 100 Jahre altes Rad würde nicht 100 Prozent authentisch sein. Zwei Tage später erlitt dieser Prozentsatz einen noch viel schwereren Rückschlag. Ich hatte Roger Rivière ein paar aktuelle Fotos geschickt und stolz den umlackierten Rahmen und die erneuerten Komponenten präsentiert, woraufhin er in einer knappen Antwort um eine Aufnahme des Steuerkopfschilds mit dem Markenemblem bat, das am Rad befestigt war. Das hatte ich mir eigentlich als Sahnehäubchen zum krönenden Abschluss aufheben wollen, aber als ich mich Roger zuliebe daranmachte, es am Steuerrohr anzubringen, schwante mir mit einem Mal, was hinter seiner Nachfrage steckte. Die Aussparungen im Emblem stimmten überhaupt nicht mit den Montagebohrungen im Rahmen überein. Ich klickerte eine panische E-Mail heraus, woraufhin Roger sich behutsam erkundigte, ob mir die Worte aufgefallen seien, die in die Kurbeln und den Sattel gestanzt waren? Das waren sie natürlich schon, aber meine Vermutung, dass »BRILLANT« ein besonders hochwertiges Stück aus LFD-Produktion kennzeichnete, erwies sich als tragischer Irrtum: Brillant, erklärte mir Roger, war ein völlig anderer Fahrradhersteller, der mit La Française-Diamant nicht das Geringste zu tun hatte.
Ich googelte den Namen und stieß auf historische Werbeposter für Brillant-Räder. Die Epoche stimmte, aber die Szenarien nicht. La Française-Diamant hatte mit Maurice Garin und anderen schnauzbärtigen Rennfahrergrößen geworben, die um die Steilkurven von Velodromen flogen oder ihre Konkurrenten auf zuschauergesäumten Straßen locker im Sprint bezwangen. Brillant hingegen schien sich eher an gemächliche Zollbeamte zu richten, die den lieben langen Tag auf Windmühlen blickten. Auf dem einzigen Poster, das eines ihrer Räder in Aktion zeigte, wurde das Gefährt von einer verängstigten Gestalt gesteuert, die stark an Kenny aus South Park erinnerte. Im Internet waren keine Anhaltspunkte dafür zu finden, dass Brillant jemals ein eigenes Team hatte oder eines ihrer Räder in einem Rennen zum Einsatz gekommen war.
Ich schlurfte matt auf die Terrasse und sah mein Rad mit neuen Augen an, den Augen eines weniger leichtgläubigen Schwachkopfs. Natürlich war der Sattel, der breit genug war, um bequem den Arsch eines Kugelstoßers aufzunehmen und sich über ein riesiges, doppelt gefedertes Gestell spreizte, kein Rennsattel. Vergleichbares galt für die klobigen, unverwüstlichen Kurbeln und den Lenker, der eher eine schnarchige als eine schneidige Fahrposition begünstigte. Roger und ich hatten uns beide von Max’ Ansammlung von Krempel verwirren und von seiner Warmherzigkeit einlullen lassen. Der durchtriebene Hund hatte mir einen Bären aufgebunden.
»Verfluchte Drecksscheiße«, erschien mir eine recht angemessene Beschreibung für diese Entwicklung, gleichwohl probierte ich noch lautstark eine Reihe von Alternativen aus. Die ganze schöne Zeit, die ich investiert hatte, die ganze schöne Säure, die ich vergossen, verschüttet und eingeatmet hatte, die ganze schöne, sauer verdiente Kohle – das alles für eine schrottreife Mühle, die allenfalls für dicke Krankenschwestern taugte. Aber es gab kein Zurück mehr, und auch noch so viele Wutanfälle im Garten würden mir nicht weiterhelfen. Ich musste das Beste aus der verfahrenen Situation machen und das Rad formerly known as LFD auf die Straße bringen und fit machen für genau die Art schwerfälligen alten Sack, für den es konstruiert worden war. Echt brillant.
* * *
Die Geschichte des Transports ist eng verknüpft mit den beiden ihrerseits eng verwandten menschlichen Antrieben, Dinge zu erfinden und diese dann umgehend für rücksichtslosen Wettstreit zu missbrauchen. Die ersten Pferdefuhrwerke zogen schon bald die Streitwagen von Ben Hur hinter sich her. Als vor über 2.500 Jahren erstmals Drachenboote auf dem Jangtse gegeneinander antraten, waren Todesopfer fast obligatorisch: Falls niemand über Bord ging und ertrank, legten die Besatzungen die Ruder nieder und bewarfen sich gegenseitig mit Steinen, bis einer sein Leben aushauchte. 1784, nur wenige Monate nachdem die Brüder Montgolfiere ein Schaf, eine Ente und ein Hähnchen in den Himmel über Versailles geschickt hatten, fand in Heveningham Hall in Suffolk das erste Ballonrennen für abenteuerlustige Draufgänger statt. Da die vorherrschenden Winde die Teilnehmer alsbald auf die Nordsee hinaustrugen, ist es wohl kein Wunder, dass die Geschichte den beschämten Mantel des Schweigens über den Ausgang des Rennens gebreitet hat.
So ähnlich spielte es sich auch mit dem Veloziped ab, dem »schnellen Fuß«, dessen Name allein schon etwas Rasanteres implizierte als ein bloßes Fortbewegungsmittel. Das erste Fahrrad wurde 1818 von Karl Freiherr von Drais patentiert, als Reaktion auf eine Hungersnot, die einen Großteil der deutschen Pferdepopulation dahingerafft hatte. Für den Antrieb seiner pedallosen, mehr als 20 Kilogramm schweren Laufmaschine, der »Draisine«, war noch der Einsatz der hochwohlgeborenen Füßchen erforderlich, was einen ziemlich albernen Anblick bot, der im oberen Rheintal sicher noch für größere Heiterkeit gesorgt hätte, wäre der Freiherr nicht im Namen des ansässigen Erzherzogs als Steuereintreiber unterwegs gewesen. Und dabei legte er erstaunliche Eile an den Tag: Die Draisine erreichte zügige 15 km/h, was ausreichte, um die Einwohnerschaft Karlsruhes so sehr zu verängstigen, dass sie das Gefährt von den Straßen der Stadt verbannte.
Die Erfindung des Freiherrn löste eine wahre Draisinen-Welle aus, die durch ganz Europa und 1819 bis in die USA schwappte. Den Spitznamen »Dandy horse« verdankte das Gerät seiner Beliebtheit bei jungen Schnöseln, die auf den Bürgersteigen der Städte ihren Geschwindigkeitsrausch auslebten und in halsbrecherischen Slalomfahrten die Sohlen ihrer Schühchen abwetzten. Ein Hersteller aus London verkaufte allein in den ersten Monaten des Jahres 320 Exemplare und betrieb im West End zwei Fahrschulen. Doch saftige Ordnungsgelder von zwei Pfund für gefährliche Fahrweise, der Unmut der Bevölkerung und exorbitante Schusterkosten bereiteten dem »Dandy horse« binnen eines Jahres ein rasches Ende.
Ein halbes Jahrhundert lang geriet die Draisine in Vergessenheit, eine Scheinblüte des Transportwesens, deren Erbe später von tapferen, Hohn und Spott nicht scheuenden Pionieren des Sinclair C5 und des Segway angetreten wurde. Es sollte bis 1867 dauern, ehe einem Schmied aus Paris, der in seiner Werkstatt an den Champs-Élysées an einer der alten Laufmaschinen herumwerkelte, die entscheidende Weiterentwicklung gelang, die aus dem nutzlosen Deppenspielzeug ein brauchbares Fortbewegungsmittel machte. Nach den Maßstäben des Dampflokzeitalters stellte die Erfindung von Pierre Michaux nicht gerade die Quadratur des Kreises dar: Inspiriert vom Mechanismus, der seinen Schleifstein antrieb, brachte er zwei eiserne Kurbeln an der Vorderachse der Laufmaschine an und schraubte Pedale daran. Das war die Geburtsstunde des »Boneshaker«, und fast umgehend kam er auch in waghalsigen Wettkämpfen zum Einsatz.
Noch im selben Jahr fanden die ersten Rennen statt, und im November 1868 versammelten sich mehrere tausend Schaulustige in einem Park in Bordeaux, um bei den ersten Damenmeisterschaften dabei zu sein (dank einer »übermenschlichen Anstrengung« auf der Zielgeraden zog Mademoiselle Julie noch an Mademoiselle Louise vorbei und gewann mit einer Nasenspitze Vorsprung). Noch bevor die neue Firma von Michaux im Jahr 1869 das erste internationale Veloziped-Rennen ausrichtete, forderte der neue Rausch der Geschwindigkeit sein erstes Todesopfer: Ein 15-jähriger Junge verlor an einem steilen Hang die Kontrolle über sein Gefährt, fiel in die Rhone und ertrank.
Dieser tragische Zwischenfall zeitigte ebenso wie die anderen, die rasch darauf folgten, keinerlei mäßigende Wirkung: »Schneller, immer schneller«, lautete das Motto. Angedachte Bremssysteme wurden verächtlich verworfen, stattdessen überlegte man, wie man aus der Konstruktion von Michaux noch ein paar km/h mehr herauskitzeln könnte. Das grundsätzliche Manko seines Antriebssystems war, dass jede volle Pedalumdrehung auch eine volle Umdrehung des Vorderrads bedeutete, an dem die Kurbeln angebracht waren. Versuchen Sie mal, mit dem Dreirad Ihres Sprösslings Tempo zu machen, und Sie verstehen den limitierenden Zusammenhang, bevor man Sie höflich bittet, den Spielplatz zu verlassen. Infolgedessen wurden die Velozipede mit immer größeren Vorderrädern ausgestattet, und so entstanden die Hochräder. Das Aufkommen von Stahlspeichen ebnete den Weg für erheblich größere Felgen und damit für erheblich größere Geschwindigkeiten. Und so wurde die Entwicklung des Fahrrads einmal mehr von großkotzigen Tempofreaks an sich gerissen. Hochräder waren erwiesenermaßen kompliziert und gefährlich, aber sie waren schnell, und das war das Einzige, was zählte.
Bald wurden Geschwindigkeiten von mehr als 50 km/h erreicht und im Velodrom von Herne Hill ein Stundenweltrekord von 38,17 Kilometer aufgestellt: Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass sich die Bestmarke trotz enormer technischer Fortschritte und regelmäßiger unerschrockener Versuche fast aller namhaften Champions auch heute noch im 40er-Bereich bewegt. Die Laufräder wurden immer größer – manche Hochradfahrer thronten drei Meter über dem Boden – und die Rahmen immer leichter. Ein Hersteller brachte ein Spitzenmodell für Bahnrennen auf den Markt, das nicht einmal sechs Kilogramm wog, was selbst heute, im Zeitalter von Titan und Carbon, mit weniger aberwitzigen Felgendurchmessern schwer zu unterbieten ist.
Wackliger, federleichter Größenwahn, steigende Geschwindigkeiten und der hartnäckige Verzicht auf Bremsen führten zu einer stetigen Zunahme hässlicher Unfälle: Alltägliche und zumeist fatale Abgänge über den Lenker mit anschließendem Aufprall des Schädels auf dem Straßenpflaster erwarben sich den scherzhaften Spitznamen »header«, also »Köpper«. In einem Buch über die Geschichte des Fahrrads findet sich die ebenso eigenartig präzise wie durch und durch entsetzliche Behauptung, dass jeder Zusammenprall zwischen Hochrad und Fußgänger bei einer Geschwindigkeit von mehr als 18 km/h zu 100 Prozent tödlich verlaufe und dass in der Hochzeit des Gefährts jedes Jahr mehr als 3.000 Menschen auf diese Weise ums Leben kamen.
Das Streben nach Geschwindigkeit und die erforderlichen technischen Mittel, um sie immer weiter zu steigern, machten die Hochräder zu einer kostspieligen Angelegenheit: Ein Exemplar des Marktführers Starley kostete mehr als das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Arbeiters. Der Boneshaker von Michaux – einfach, praktisch, günstig – hatte eine Revolution und Räder für jedermann versprochen. Die maßlosen und selbstmörderisch idiotischen Hochräder ließen diesen Traum schleunigst über den Lenker gehen.
Das 1885 vorgestellte Rover Safety Bicycle brachte das dringend benötigte Umdenken. Die Sicherheitsniederräder verdankten ihren Namen ihren in etwa gleich großen, relativ kleinen Laufrädern, die den Schwerpunkt nach unten verlagerten und es dem Fahrer ermöglichten, im Ruhezustand die Füße auf den Boden zu stellen, was das header-Risiko in jeder Hinsicht drastisch verringerte. Das Rover war keineswegs eine Neuerung: Das erste Sicherheitsrad war bereits zehn Jahre zuvor in den Handel gekommen. Und es war auch nicht billig: Das erste von J. K. Starley, dem Neffen des Königs der Hochräder, hergestellte Rover, kostete 20 Pfund und 15 Shilling, wofür man, um mal ein paar sinnlose Vergleiche ins Spiel zu bringen, fünf maßgeschneiderte Anzüge oder knapp 1.400 Liter Bier bekommen hätte.
Das Rover Safety Bicycle war im Grunde nichts weiter als die durchdachte Weiterführung der sinnvollen Aspekte seiner »sicheren« Vorgänger. Ein diamantförmiger Rahmen, ein Lenker, der mittels einer Gabel am Vorderrad befestigt war, Pedale unterhalb des Sattels, die das Hinterrad mittels Kette und Getriebe bewegten: Es stellte sich als erstaunlich krisensichere Konstruktion heraus. Heutzutage könnte man auf der ganzen Welt die Silhouette des Rovers auf Fahrradverbotsschilder malen, und jeder wüsste Bescheid. Ein beachtlicher Erfolg, insbesondere angesichts der Tatsache, dass 1885 auch das erste Automobil mit Verbrennungsmotor vorgestellt wurde: der dreirädrige, per Exzenterstange gesteuerte Benz Patent-Motorwagen Nummer 1, der mit den Fahrzeugen von heute in etwa so viel gemein hat wie ein Landstreicher mit Banjo.
Starleys Leitprinzip war die Entwicklung einer Maschine, mit welcher »der Fahrer mit dem geringsten Grad an Erschöpfung die größtmögliche Kraft auf die Pedale bringen kann«. Im Vergleich mit dem Laufen erforderte seine Erfindung 80 Prozent weniger Energie, war aber vier Mal schneller. Dank dieser erstaunlichen und unübertroffenen Effizienz hat das Rover Safety Bicycle sämtliche Entwicklungen der letzten mehr als 125 Jahre, die mit Sicherheit die turbulentesten der Menschheitsgeschichte waren, fast unverändert überdauert.
Im Verbund mit John Dunlops neuen luftgefüllten Reifen versprach Starleys Rad eine lockere und reibungslose Fahrt. Man musste auch nicht wagemutig, jung oder männlich sein, um sich auf ein Rover zu schwingen: Auch Frauen konnten es benutzen, ohne schwere Kopfverletzungen zu riskieren oder ihre Schlüpfer zeigen zu müssen. Endlich konnten sie in die Stadt fahren oder auch aus der Stadt heraus, ohne ständig eine Aufsichtsperson am Hals zu haben. Die radikale amerikanische Frauenrechtlerin Susan B. Anthony schrieb, dass »das Fahrrad mehr für die Emanzipation der Frauen getan hat als alles andere auf der Welt«.
Die Verkaufszahlen gingen durchs Dach und die Preise runter. Um die Jahrhundertwende brachten Starley und seine zahlreichen Nachahmer allein in Europa jedes Jahr eine Million Fahrräder unter die Leute. Als Édouard Michelin einen abnehmbaren Reifen vorstellte, der bequem am Straßenrand repariert oder ausgewechselt werden konnte, löste das eine soziale Revolution aus. Auch ausgedehntere Ausflüge waren nun problemlos möglich, und das Freizeitverhalten erlebte eine radikale Wandlung. Picknicks im Grünen, Tagesausflüge in die Stadt oder ans Meer, längere Touren in den Ferien: Das alles war jetzt jedermann zugänglich. Und wenngleich das Sicherheitsrad nicht so schnell war wie die Hochräder – jedenfalls noch nicht –, so war es in jedem Fall besser geeignet für den aufkommenden Wahn, ungemein lange, transnationale Radrennen zu veranstalten.
Ich möchte diesen kurzen historischen Exkurs damit beschließen, J. K. Starley meinen tiefempfundenen Dank für seine Erfindung auszusprechen, die den Hochrädern den Garaus machte und es mir damit erspart hat, auf einem dieser Höllengefährte 3.000 Kilometer über die von den schlechtesten Autofahrern Europas heimgesuchten Straßen eiern zu müssen und dabei möglicherweise zu sterben.
* * *
So wie er auf den Aufnahmen von 1914 aussah, wie sie in Paolos Buch zu finden waren, entsprach Alfonso Calzolari sogar noch weniger dem Bild eines Modellathleten als der storchengleiche Fausto Coppi. Ein glattrasierter, winziger Kerl mit dickem, zurückgegeltem Haar und einem kantigen, etwas zu groß geratenen Gesicht, der zerbrechlich und furchtsam auf dem Rad sitzt, als sei er frühzeitig gealtert: schlammverkrustet, unterernährt und von den Elementen verwittert. Aber gebadet, gefüttert und für die Siegesfeierlichkeiten feingemacht wirkt Calzolari selbstsicher, gedrungen und zäh, wie einer dieser pflichteifrigen Mafia-Schergen. Ein Dreikäsehoch mit Eiern groß wie Kokosnüsse.
Alfonso Calzolari kam 1887 in Vergato, 40 Kilometer südlich von Bologna, als Sohn eines Zimmermanns zur Welt. Die Familie zog bald in die Stadt, wo Alfonso als Teenager Arbeit in einer Bettenfabrik fand. Von seinen ersten Ersparnissen kaufte er sich ein klappriges gebrauchtes Rad und fuhr, angespornt von seinem Vater, jeden Tag nach der Arbeit zur Radrennbahn Montagnola in der Nähe des Bahnhofs, um ein paar Runden zu drehen. Alfonso war eifrig bei der Sache und legte bei seinen ersten Amateurrennen erstaunliche Zähigkeit an den Tag, ohne allerdings besondere Siegqualitäten zu entwickeln. Erst mit zweiundzwanzig gewann er seinen ersten Wettkampf – ein kleines lokales Vereinsrennen – und es dauerte noch ein weiteres Jahr, ehe er mit einem achten Platz bei den nationalen Amateurmeisterschaften auf sich aufmerksam machte.
Dank seiner Unermüdlichkeit, die ihm 1914 so gute Dienste erwies, biss Alfonso sich trotz anhaltender Erfolglosigkeit im Sattel durch. Er verdingte sich immer noch in der Bettenfabrik und weil er sich keine Zugfahrten leisten konnte, radelte er an den Wochenenden auf seiner alten Kiste zu Rennen in ganz Norditalien, landete unter ferner liefen und radelte wieder heim. Nach mehreren Podiumsplatzierungen Anfang 1912 erhielt er endlich einen Vertrag als »Nachwuchsprofi« beim Rennstall L’Italiana. Allerdings keinen besonders gut dotierten: Als L’Italiana ihn im gleichen Jahr für den Giro nominierte, musste er in der Bettenfabrik darum betteln, für die Dauer der Rundfahrt freigestellt zu werden. Kaum eine Woche später war er wieder an der Arbeit, er hatte nur vier Etappen durchgehalten.
Seinen Job schmiss Calzolari erst 1913, als er im fortgeschrittenen Alter von 26 Jahren endlich einen richtigen Vertrag bei einem richtigen Rennstall erhielt. Stucchi, einer der führenden Radfabrikanten der damaligen Zeit, erwartete Resultate von seinen Profis, aber Alfonso gelang im ersten Jahr für das Team nur ein einziges nennenswertes Ergebnis: ein Sieg bei der Emilia-Rundfahrt. Der Rest der Saison fiel mehr oder weniger einem gebrochenen Schlüsselbein zum Opfer. Er trat beim Giro d’Italia an, bevor der Bruch richtig verheilt war, und überstand nicht einmal die erste Etappe.
Das Jahr darauf begann mit einer Reihe absolut nicht bemerkenswerter Resultate: ein zehnter Platz, ein siebter, ein vierter. Für einen 27-Jährigen sah das wie der Anfang vom Ende der Profikarriere aus. Vor dem Start des Giro 1914 zählte Alfonso Calzolari dementsprechend nicht unbedingt zum Favoritenkreis auf den Gesamtsieg, oder wie es ein italienischer Radsporthistoriker geringschätzig ausdrückte: »Man brauchte keinen Abakus, um die Erfolge des kleinen Mannes aus Vergato zu zählen.« Der Giro 1914, fuhr er fort, »erwählte seinen König aus dem einfachen Fußvolk des Radsports«.
Paolo Facchinettis Buch basiert auf einer Begegnung mit Alfonso Calzolari im April 1972. Es war der 85. Geburtstag des früheren Champions, und Paolo hatte zu diesem Anlass um ein Interview gebeten. Der Mann, den er am Empfang eines Seniorenheims in Genua traf, war noch dünner, als er erwartet hatte, mit vollem silbernen Haar und von rastloser Erscheinung. Alfonso erwähnte zur Begrüßung ganz beiläufig seinen kürzlichen Besuch in Bologna, wo er den ganzen Tag über zwischen verschiedenen Presseterminen Rad gefahren war. »Auf meinem Rennrad natürlich.« Am Abend meldete er sich bei einem Amateurrennen an, das von einem seiner alten Radsportvereine aus seiner Heimatstadt veranstaltet wurde, bevor es ihm von den Offiziellen wieder ausgeredet wurde. »Ich wollte nur sehen, ob ich noch mithalten kann, ob ich es noch draufhabe.« Typisch »Fonso« Calzolari, befand Paolo, »ein Bursche voller Tatendrang, der sich durch nichts aufhalten ließ und sein Leben lang die eigenen Grenzen ausgelotet hat«.
Die beiden plauderten den ganzen Nachmittag. Paolo fiel auf, dass Fonso in seine Erinnerungen an 1914 immer wieder Begriffe aus dem französischen Rennfahrerjargon einstreute, der lingua franca der frühen Tage des Profiradsports, selbst für einen Fahrer, der Italien sein Leben lang nicht verließ. Die Fahrer hießen »routiers«, die Offiziellen und Journalisten im Tross des Rennens waren die »suiveurs«. Calzolari sprach von seinem Rad außerdem grundsätzlich als »la macchina« (wortwörtlich »die Maschine«, was heutzutage umgangssprachlich für ein Auto verwendet wird) und von den Reifen als »palmers« – der Name der amerikanischen Firma, die das erste gummierte Kordgewebe entwickelte und vermarktete. Zum Entzücken Paolos kramte der alte Mann dann sein Sammelalbum hervor, in dem er vergilbte Fotos, Zeitungsausschnitte und die eigenen, handgeschriebenen Erinnerungen an den schrecklichen, glorreichen Giro von 1914 aufbewahrte.
Der Journalist war erstaunt über das, was er zu lesen und zu hören bekam. »Eine Fabel, ein Abenteuer wahrer Pioniere, als eine Etappe kein einfaches Rennen, sondern eine Reise über mehrere hundert Kilometer war, eine Reise, die um Mitternacht begann und bei Sonnenuntergang endete.« Drei Stunden lang erzählte Calzolari von scheußlicher Witterung und schmutzigen Tricks, von einem unaufhörlichen mechanischen und menschlichen Gemetzel, von wundersamen Rettungen, bei denen Gott seine schützende Hand über ihn hielt, und von unbeschreiblichen Schmerzen. »Es war ein Massaker, das nur acht von uns überlebten«, sagte er schließlich, »und irgendwie, trotz allem, habe ich sie alle bezwungen.« Dann gab er Paolo die Hand, überreichte ihm das Album zur Verwahrung und verabschiedete sich von seinem mutmaßlich letzten Interviewpartner.
Lauscht man den Erinnerungen eines Stabhochspringers oder Jockeys, mag man vielleicht fasziniert sein, aber ihnen nachzueifern, käme einem wohl kaum in den Sinn. Aber ein Rad auf der Straße zu bewegen, ohne umzufallen, ist eine recht banale Kernkompetenz, die jeder besitzt, sofern nicht irgendetwas komplett schiefgelaufen ist. »Das Fahrrad ist demokratisch«, schrieb einer der vielen selbsternannten italienischen Radphilosophen der Vorkriegszeit. »Man steigt einfach auf, fängt an zu kurbeln und tritt in eine ekstatische Dimension ein.« Ruhig, Brauner! Mit dem Kerl werde ich jedenfalls nicht Tandem fahren. Aber als ich über Paolos Begegnung mit Alfonso Calzolari las, wusste ich genau, wovon er sprach. Der Giro 1914 war grausam jenseits jeder Vorstellungskraft, nach menschlichem Ermessen fast unzumutbar, aber der Mann, der ihn schließlich gewann, war nichts weiter als ein tapferer Wasserträger, der sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern eroberte, indem er etwas tat, was wir alle tun, sich dabei aber als weitaus zäher erwies.
Das letzte Foto in Paolos Buch zeigte den 90-jährigen Alfonso, der im Sonntagsstaat auf einer Bühne steht und ins Publikum winkt. Ich betrachtete es und verspürte einen Kloß von der Größe einer Avocado in der Kehle. Er gehörte einer Generation an, die wusste, was zu tun war, wenn es hart auf hart ging. Ich als Mitglied der meinigen ging lieber erst mal shoppen.