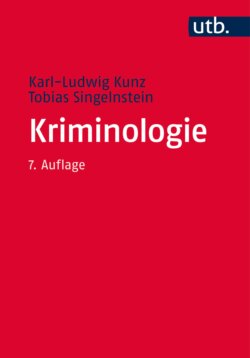Читать книгу Kriminologie - Tobias Singelnstein - Страница 12
Оглавление§ 5 Kriminologische Forschungsmethoden
1
Als Erfahrungswissenschaft liegt ein Schwerpunkt kriminologischer Forschung neben theoretischen Arbeiten auf der empirischen Forschung. Anders als normative Wissenschaften, wie etwa die Rechtswissenschaft, untersucht die Kriminologie die Lebenswirklichkeit – so unverstellt wie möglich. Dabei sollen in der Theorie entwickelte Annahmen überprüft und/oder weiterentwickelt werden, die sowohl die Entstehung von abweichendem Verhalten als auch die Praxis des Kriminalisierungsprozesses betreffen können. Für diese Forschung greift die Kriminologie auf die Methoden verschiedener Bezugswissenschaften zurück, im Besonderen auf die der empirischen Sozialforschung. Diesen kommt die Aufgabe zu, den Forschungsprozess möglichst frei von unerwünschten Einflüssen zu strukturieren und so allgemein gültige Erkenntnisse zu erlangen.94
I. Grundlagen
2 Innerhalb der Methoden der empirischen Sozialforschung besteht die Wahl zwischen quantitativen und qualitativen Methoden. Quantitative Methoden messen zählbare Eigenschaften und versuchen anhand der Häufigkeit ihres Vorkommens und des Zusammentreffens mit anderen Elementen Aussagen über Kausalzusammenhänge [47] zu treffen. So kann beispielsweise gefragt werden, ob eigene Gewalterfahrungen in der Kindheit zu einer höheren Gewaltbereitschaft im Erwachsenenalter führen. Für die Aussagekraft solcher Untersuchungen kommt es darauf an, dass eine repräsentative Stichprobe aus der jeweiligen Gesamtheit untersucht wird.
3 Qualitative Methoden der Sozialforschung verfolgen als sinnverstehende, interpretative Herangehensweise eine Perspektive des Verstehens anstelle des Erklärens (→ § 2 Rn 21 f.).95 Dabei bemühen sie sich um ein tieferes Verständnis der sozialen Zusammenhänge im Sinne eines Nachvollziehens.96 Qualitative Methoden wurden aus der Erkenntnis entwickelt, dass quantitative Verfahren im Bemühen um Objektivität sich den Zugang zu einem intersubjektiv gebildeten sozialen Forschungsgegenstand verstellen. Andererseits sind quantitative Verfahren angesichts ihres geplanten Forschungsablaufs der Gefahr ausgesetzt, weniger offensichtliche Umstände und Zusammenhänge, die vom Forschungsdesign nicht erfasst worden sind, im Laufe des Forschungsprozesses zu übersehen und so zu einer selektiven Wahrnehmung zu gelangen.97 Demgegenüber handelt es sich bei qualitativen Methoden oft um naive Verfahren, die bemüht sind, möglichst frühzeitig mit dem praktischen Forschungsprozess zu beginnen, um aus dem empirischen Material heraus das konkrete Vorgehen zu entwickeln. Dies kann die Gefahr bergen, das eigene Vorverständnis unhinterfragt als allgemein gültig zu unterstellen.
4
Quantitative Ansätze stehen auch in der kriminologischen Forschung immer noch im Vordergrund, obwohl die Bedeutung qualitativer Methoden hier wie auch allgemein in den Sozialwissenschaften zunimmt. Beide Herangehensweisen haben ihre Berechtigung und können methodisch gültige empirische Erkenntnisse erbringen. Allerdings sind sie für verschiedene Fragestellungen in unterschiedlichem Maße geeignet.98 Ihre Wahl bleibt von der Weltsicht der Forschenden und der jeweiligen Forschungsintention abhängig.
5
Unabhängig von der methodischen Herangehensweise stellt sich weiterhin die Frage, ob die für das Forschungsvorhaben notwendigen Daten selbst erhoben werden sollen (Primärdaten) oder ob bereits für einen anderen Zweck erhobene Daten ausgewertet werden können (Sekundärdaten).99 Wichtige Quellen für Sekundärdaten im Bereich der Kriminologie sind zum einen die amtlichen Statistiken (Polizeiliche Kriminalstatistik, Staatsanwaltschafts-, Strafverfolgungs- und Strafvollzugsstatistik) sowie die durch Strafverfolgungsbehörden angelegten Akten. Außerdem können auch Daten, die für andere Studien erhoben wurden, für weitere Fragestellungen [48] verwendet werden. Auswertungen von Sekundärdaten haben den Vorteil, dass die meist ressourcenintensive eigene Datenerhebung entfällt. Zugleich ergeben sich aus der Verwendung von Sekundärdaten auch Nachteile, da die Erhebung der Daten nicht im Hinblick auf den Forschungszweck erfolgt ist und von partikularen Interessen geleitet sein kann. Generell liefern Sekundärdaten ein durch das spezifische Interesse bei der Datenerhebung und die gewählte Erhebungstechnik verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Insbesondere amtliche Quellen, wie aktenmäßige Erfassungen und Statistiken, betreffen nur das amtlich bekannt gewordene Hellfeld der Kriminalität und dürfen nicht als Abbild der Wirklichkeit verstanden werden (→ § 15 Rn 6).
II. Einzelne Methoden der Datenerhebung
6
Für die Erhebung von Primärdaten in kriminologischen Forschungsvorhaben sind aus der empirischen Sozialforschung vor allem die verschiedenen Formen der Befragung, der Beobachtung und des Experiments von Bedeutung. Diese können jeweils quantitativ bzw. qualitativ ausgestaltet werden oder beide Aspekte kombinieren, was als Triangulation oder mixed-method-Forschung bezeichnet wird.100 Die Methodenwahl ist von der angestrebten Erkenntnis abhängig. Besondere Problemstellungen hinsichtlich der Methoden ergeben sich bei der Dunkelfeldforschung, die daher gesondert behandelt wird (→ § 17 Rn 19 ff.).
7
Befragungen können in Form von Fragebögen (von den Befragten selbst auszufüllen) oder von Interviews (Befragung durch einen Interviewer) durchgeführt werden. Fragebögen, die online oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden, sind das Standardinstrument in vielen quantitativen kriminologischen Forschungen und in sehr unterschiedlicher Form möglich101. Sie sind kostengünstig, weshalb große Stichproben realisierbar sind. Anonymität und die Abwesenheit eines Interviewers ermöglichen auch die Abfrage sensibler Daten, z. B. hinsichtlich eigener Viktimisierungs- oder Tätererfahrung. Allerdings sind bei Befragungen mit Fragebögen die Rücklaufquoten meist niedrig, was die Aussagekraft erheblich einschränken kann. Werden die Befragungen unmittelbar durch einen Interviewer geführt, ist der Anteil abgeschlossener Befragungen deutlich höher und eventuell auftretende Missverständnisse können direkt beseitigt werden.102 Allerdings ist dieses Vorgehen kostenintensiver und mit Möglichkeiten der subjektiv verzerrten Datenerfassung belastet.
[49]8
Bei Fragebögen sind die Fragen meist geschlossen formuliert, d.h. mit der Frage wird dem Befragten gleichzeitig eine begrenzte Anzahl möglicher Antworten vorgegeben.103 Auf diesem Weg lassen sich die erhobenen Daten vergleichsweise einfach statistisch und sogar automatisiert auswerten. Im Gegenzug begründet die Vorstrukturierung der Antwortmöglichkeiten durch die Forschenden die Gefahr, dass von diesen übersehene, aber relevante Antwortmöglichkeiten in der Untersuchung nicht erfasst werden.
9
Bei Interviews können verschiedene methodische Herangehensweisen unterschieden werden, die zu erheblichen Divergenzen bei den sichtbar gemachten Daten führen. Die Unterschiede bestehen insbesondere in einer unterschiedlich starken Strukturierung der Interviews. Bei strukturierten (standardisierten) Interviews stehen Inhalt, Anzahl und Reihenfolge der Fragen schon vor der Befragung fest. Ein solches Vorgehen dient in der Regel dazu, mit geschlossenen Fragen vor allem quantitativ auswertbare Daten zu erzeugen. Demgegenüber werden freie Interviews mit offenen Fragen für ethnografische und andere qualitative Studien eingesetzt. Dazwischen gibt es zahlreiche Möglichkeiten eines semi-strukturierten Interviews, etwa anhand von Leitfäden, in denen die interviewende Person die Möglichkeit hat, die Interaktion zu beeinflussen und so auch außerhalb der ursprünglichen Fragen liegende Aspekte aufzunehmen, die sich erst im Laufe der Befragung ergeben.104
10
Bei jeglicher Form der Befragung ist die Datenerhebung durch das Erinnerungsvermögen der Befragten begrenzt. Dies kann zu Verzerrungen führen, da kürzlich als einschneidend empfundene Erlebnisse und Erfahrungen besser erinnert werden als solche, die als üblich oder bagatellhaft empfunden werden und schon länger zurückliegen.105 Durch die Formulierung der Fragen haben die Forschenden großen Einfluss auf das Antwortverhalten, z. B. durch Suggestivfragen, die Art der Formulierung und die Reihenfolge der Fragen. Dies kann zu einer Beeinflussung der Ergebnisse führen.106
11
Eine weitere Methode zur Gewinnung qualitativer Daten sind moderierte Gruppendiskussionen oder focus groups, bei denen Experten oder Akteure eines bestimmten sozialen Feldes über vorgegebene Fragestellungen diskutieren. Die Diskussion zwischen den zumeist sechs bis acht Teilnehmenden wird von diesen selbständig geführt, um eine dynamische Gruppeninteraktion zu erreichen, die möglichst ohne Einmischung der forschenden Personen viele inhaltliche Aspekte zu dem jeweiligen Thema hervorbringt. Der Einsatz von focus groups eignet sich vor [50] allem für explorative Studien, mittels derer ein Überblick über das Forschungsfeld gewonnen werden soll.107
12
Die Beobachtung ist überwiegend ein Verfahren zur Gewinnung qualitativer Daten. Sie kann offen oder verdeckt erfolgen, die beobachtende Person kann sich als solche zu erkennen geben oder nicht. Eine weitere Unterscheidung wird vorgenommen zwischen teilnehmenden Beobachtungen, also solchen bei denen der Beobachtende durch bloße Anwesenheit oder aktive Teilnahme Teil des Interaktionsgeschehens ist, und nicht-teilnehmenden Beobachtungen. Während ethnografische Studien auf Grundlage von Beobachtungen im angloamerikanischen Raum häufiger vorkommen, sind sie in der deutschsprachigen kriminologischen Forschung eher selten. Aus der Nähe der Forschenden zum Feld ergibt sich einerseits die Möglichkeit, menschliche Interaktionen direkt und nicht vermittelt über die Aussagen Dritter wahrzunehmen und den nonverbalen Kontext des Verhaltens zu beobachten. Andererseits hat die Anwesenheit von Beobachtenden einen Einfluss auf die Situation, in der sich die Beobachtung vollzieht. Eine neutrale Beobachtung ohne Interaktion mit dem sozialen Beobachteten ist nicht möglich. Dies wird als reaktiver Effekt bezeichnet und kann dazu führen, dass die Probanden ein anderes Verhalten an den Tag legen, als sie dies ohne (offene) Beobachtung tun würden.108
13
Bei der Methode des Experiments wird ein Verhalten oder Geschehen untersucht, dessen Bedingungen durch die forschende Person vorab festgelegt sind.109 Das zu untersuchende Geschehen wird dabei unter verschiedenen Bedingungen wiederholt, um so die Abhängigkeit einer Variable von einer anderen festzustellen, z. B. den Einfluss einer Interventionsart auf das generelle Ausmaß an Straffälligkeit.110
III. Ablauf eines Forschungsprojekts
14
Eine empirische Untersuchung kann in Konzipierungs-, Durchführungs- und Auswertungsphase eingeteilt werden.111 In der Konzipierungsphase wird festgelegt, was erforscht wird und wie dies passieren soll. Hierfür wird eine Forschungsfrage formuliert und eine Forschungsstrategie entwickelt. Dabei reflektieren die Forschenden idealerweise auch ihre ontologischen und erkenntnistheoretischen Positionen. Ontologische Positionen betreffen die eigenen Vorstellungen über die „Natur“ [51] der Wirklichkeit, erkenntnistheoretische die Frage nach der „Natur“ von Wissen und die Zugänglichkeit der Wirklichkeit. Hierbei lassen sich zwei Grundpositionen unterscheiden: Eine konstruktivistische, die Wirklichkeit als soziales Konstrukt versteht, dass nur subjektiv erfassbar ist und eine positivistische, die die Wirklichkeit als unabhängig existierenden und objektiv erfassbaren Gegenstand auffasst, der erklärt werden kann (→ § 2 Rn 7 ff.).112 Ebenfalls entscheidend sind die eigenen Vorannahmen über den Forschungsgegenstand Kriminalität. Dieser kann eher aus einer ätiologisch-erklärenden Perspektive oder aus einer interaktionistischen Perspektive untersucht werden, wobei bei letzterer die Kriminalisierung das primäre Erkenntnisinteresse ausmacht.
15
Auf dieser Basis wird dann das Forschungsdesign entwickelt. Hier ist zu klären, welche Daten mit welchen Methoden wie erhoben und ausgewertet werden sollen, um die jeweilige Fragestellung möglichst optimal zu untersuchen. Dabei kann zwischen Längsschnitt- und Querschnitt-Design unterschieden werden. Bei Längsschnitt-Studien gibt es wiederholte Erhebungen zu mindestens zwei unterschiedlichen Zeitpunkten, um so prozesshafte Entwicklungen nachzuzeichnen. Die wiederholten Erhebungen können entweder bei unterschiedlichen Stichproben (Trenddesign) oder bei ein und derselben Stichprobe erfolgen (Paneldesign). Bei Querschnitt-Forschungen werden hingegen nur einmalig Daten erhoben, so dass keine Aussagen über Veränderungen im Zeitverlauf möglich sind.113
16
Generelle theoretische Kategorien und Konzepte wie Kriminalität oder das Klima einer Strafanstalt können mit den beschriebenen Methoden nicht direkt gemessen werden. Sie müssen hierfür operationalisiert, also die Operationen beschrieben werden, die zur Messung des jeweiligen Konzepts erforderlich sind.114 Dies bedeutet, Kriterien zu entwickeln, anhand derer die jeweilige Kategorie bzw. das Konzept mit den gewählten Methoden messbar ist. Um z. B. Kriminalität zu messen, muss festgelegt werden, anhand welcher messbaren Kriterien bestimmt werden soll, was als Kriminalität im Sinne des Forschungsprojektes gilt, beispielsweise ein angezeigter Fall oder ein verurteilter Tatverdächtiger.
17
Bei der Datenerhebung muss zunächst über deren Umfang entschieden werden. Dies ist bei quantitativen Methoden von besonderer Relevanz. Da eine Totalerhebung, bei der die interessierenden Aspekte der Wirklichkeit umfassend untersucht werden, nur selten möglich und ökonomisch sinnvoll ist, wird in der Regel eine Teilerhebung vorgenommen. Um z. B. Aussagen über eine Großstadt treffen zu können, müssen nicht all deren Einwohner befragt werden, sondern es genügt die Befragung eines Teils der Bewohner – so genannte Stichprobe –, um Aussagen über die Gesamtbevölkerung der Stadt treffen zu können. Damit aber die Aussagen über [52] die Stichprobe auf die Gesamtheit übertragen werden können, ist es wesentlich, dass die Stichprobe (sample) methodisch korrekt gebildet wird. Idealerweise erfolgt dies in Form einer Zufallsstichprobe und damit in der Weise, dass alle Einheiten der Grundgesamtheit die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, Teil der Stichprobe zu werden.
18
Auf die Konzipierung folgt die Durchführungsphase, in der die Datenerhebung vorgenommen wird. In der daran anschließenden Auswertungsphase werden die erhobenen Daten eingehend analysiert und bewertet, um das so gewonnene Wissen mit den Ausgangshypothesen abzugleichen. Dabei lassen sich quantitative Daten statistisch auswerten. Auf diesem Weg sind Aussagen über die Häufigkeitsverteilung bestimmter Merkmale in einer Gruppe oder über Beziehungen (Korrelationen) zwischen zwei oder mehreren Variablen möglich. So kann in einer Studie z. B. untersucht werden, ob die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, gleichmäßig nach Geschlecht, Alter oder ethnischer Zugehörigkeit verteilt ist oder ob zwischen den Variablen Alter und strafrechtliche Registrierung eine Korrelation besteht. Qualitative Verfahren erfordern hingegen andere Auswertungsmethoden, die je nach dem gewählten Forschungsdesign variieren. Neben freieren Formen der Interpretation ist die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring115 mit einer systematischen Vorgehensweise eine häufig genutzte Methode.116
94 Bock 2013, Rn. 52 ff.
95 S. Bohnsack 2014, 13 ff.
96 Dazu Flick 2012, 28 f., 95; Meier 2010, 87.
97 S. Eisenberg 2005, 102.
98 Fuchs/Hofinger/Pilgram 2016.
99 Wincup 2013, 103.
100 Bock 2013, Rn. 74; Neubacher/Oelsner/Schmidt 2013, 675.
101 Wittenberg 2015, 96 ff.
102 Newburn 2013, 950.
103 Wincup 2013, 104.
104 Wincup 2013, 105.
105 Eisenberg 2005, 134 f.
106 Eisenberg 2005, 110.
107 Wincup 2013, 106.
108 Schneider 2007, 226.
109 Eisenberg 2005, 113.
110 Schneider 2007, 219.
111 Schwind 2013, 169 f.
112 Coomber u. a. 2014, 35.
113 Meier 2010, 94 f.
114 Schneider 2007, 231 f.
115 Mayring 2016.
116 Bock 2013, Rn. 84.