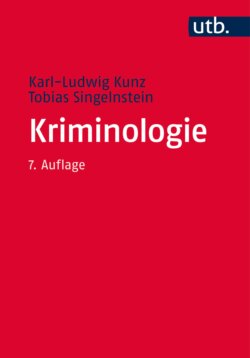Читать книгу Kriminologie - Tobias Singelnstein - Страница 13
Оглавление[53]2. KAPITEL KRIMINALITÄTS- UND KRIMINALISIERUNGSTHEORIEN
§ 6 Notwendigkeit und Begrenztheit von theoretischen Vorstellungen
1
Im 20. Jahrhundert haben sich unterschiedliche Vorstellungen über kriminelles Verhalten, seine fördernden, es stabilisierende oder unterbrechende Einflüsse und – ganz allgemein – über das Bewirken von Kriminalität durch die biologische Anlage, die Gesellschaft und die Kriminalitätskontrolle entwickelt. Dabei steht seit dem Bedeutungsverlust der klassischen Schule die Frage nach den individuellen Ursachen kriminellen Verhaltens im Zentrum.
2
Den Vorstellungen ist gemeinsam, dass sie kriminelles Verhalten nach Erklärungsmustern bestimmen, welche für menschliches Handeln überhaupt gelten. Kriminelles Verhalten folgt keinen besonderen Gesetzmäßigkeiten, sondern den allgemeinen Regeln menschlichen Handelns. Ob ich danach frage, warum Menschen kriminell werden, zu übermäßigem Alkoholkonsum neigen oder ihre Partner sozial toleriert demütigen: Die Gründe für all das sind nach einheitlichen Vorstellungen über menschliches Handeln zu bestimmen, welche in der menschlichen Natur, den sozialen Abhängigkeiten oder in sonstigen Einflussfaktoren liegen mögen. Aus der Erklärung krimineller Betätigung nach allgemeinen Verhaltenskonzepten folgt, dass eine Klärung der Zusammenhänge kriminellen Handelns pars pro toto zur Klärung der Zusammenhänge menschlichen Handelns überhaupt beiträgt. Ebendies macht die wissenschaftliche Befassung mit dem Verbrechen von Anbeginn zu einer „Schule der Bildung“ und einer „umfassenden Menschheitswissenschaft“ (→ § 3 Rn 4).
3 Die Divergenzen der unterschiedlichen kriminologischen Schulen jener Zeit rühren daher, dass sie auf der Basis dieser Gemeinsamkeit unterschiedliche Vorstellungen über das Wesen menschlichen Handelns favorisieren. Die vertretenen Handlungsmodelle lassen sich grob danach einteilen, ob ihnen ein deterministisches oder ein indeterministisches Menschenbild zu Grunde liegt. Die Klassische Schule (→ § 4 Rn 4 ff.) vertrat in der Tradition der Aufklärung eine indeterministische Position,[54] die das Individuum als rational und eigenverantwortlich handelnd versteht. Die biologisch-anthropologische Schule (→ § 4 Rn 18 ff.) und die aufkommenden soziologischen, auf das soziale Milieu bzw. die Anomie der gesellschaftlichen Strukturen bezogenen, Erklärungen (→ § 4 Rn 17; § 9 Rn 3 ff.) beruhen hingegen auf einem deterministischen Menschenbild. Dieses erachtet menschliches Verhalten als durch willensunabhängige empirisch benennbare Faktoren im Sinne statistischer Wahrscheinlichkeit kausal determiniert. Aus den jeweiligen Verhaltenskonzepten ergeben sich je unterschiedliche praktische Konsequenzen für die Prävention und die strafrechtliche Intervention.
4
Schaubild 2.1: Menschenbilder und Verhaltenskonzepte der frühen Kriminologie
[55]I. Entwicklung kriminologischer Theorien
5
Aus der fortschreitenden Differenzierung jener Verhaltenskonzepte entwickeln sich die heute vertretenen theoretischen Zugangswege zur Kriminalität, die wir in der Folge „Kriminalitätstheorien“ nennen wollen. Das deterministische Verhaltenskonzept ist die Basis für die Mehrzahl der bis in die 1980er Jahre entwickelten Kriminalitätstheorien. Ihm entspricht erkenntnistheoretisch das Erklärungsmodell und das Selbstverständnis der Kriminologie als einer vorzugsweise quantitativ vorgehenden, die Ursachen kriminellen Verhaltens empirisch erforschenden Erfahrungswissenschaft (→ § 2 Rn 8 f.). Dem indeterministischen Verhaltenskonzept folgen in Reinform die ökonomische Kriminalitätstheorie (→ § 12 Rn 12 ff.), ferner ansatzweise die Kontrolltheorien (→ § 11) und jene theoretischen Zugangswege zur Kriminalität, welche, wie der symbolische Interaktionismus (→ § 13 Rn 1 ff.), am sinnhaften Verstehen des Handelns interessiert sind und qualitative Methoden bevorzugen (→ § 2 Rn 11 ff.).
6
Die Wahl eines bestimmten theoretischen Zugangsweges zur Kriminalität ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, Kriminalität überhaupt wahrnehmen und sinnvolle Aussagen darüber machen zu können. Dies gilt nicht nur für die systematischen Wahrnehmungen der kriminologischen Wissenschaft, sondern bereits für Alltagswahrnehmungen von Kriminalität. Denn jeder soziale Akteur entwickelt routinemäßig für ihn überzeugende schematische Vorstellungen über den Sinn seines eigenen Handelns und dasjenige anderer. Jede Wahrnehmung menschlichen Handelns ist deutungsabhängig und damit theoriegeleitet, mag die Anleitung auch unbewusst geschehen und es sich dabei um eine unüberprüfte Alltagstheorie handeln. Insofern theoriegeleitete Vorstellungen unabdingbar sind, ist es vorzugswürdig, sich die theoretischen Hintergründe der eigenen Vorstellungen bewusst zu machen und sie kritisch zu prüfen, anstatt diese unreflektiert hinzunehmen.
7 Theorien sind gedankliche Operationen zur Erfassung der Wirklichkeit über den wahrgenommenen Einzelfall hinaus. Sie machen Aussagen über die Struktur der Welt, in der wir leben. Sie stellen den Versuch dar, unsere Wahrnehmungen zu ordnen, Erwartungssysteme zu stabilisieren und eine Kontrolle über die Umwelt zu erlangen. Theorien vereinfachen die Komplexität der Wirklichkeit so weit, dass ein Verständnis von Wirkungszusammenhängen möglich wird. Eine wissenschaftliche Theorie will eine Optimierung zwischen Abstraktion und Konkretisierung finden: Sie will einerseits durch Reduktion der Komplexität der Wirklichkeit deren Begreifbarkeit, Kommunizierbarkeit und systematische Überprüfbarkeit ermöglichen. Andererseits will sie die Wirklichkeit in ihrer Komplexität so weit erhellen, dass die jeweils interessierende Fragestellung möglichst reich an Eindrücken „wirklichkeitsverankert“ und „wirklichkeitsgesättigt“ beantwortet werden kann. Während Theorien, die sich quantitativer Verfahren bedienen, starkes Gewicht auf die Reduktion[56] der Komplexität von Wirklichkeit legen, sind Theorien, welche qualitative Verfahren benutzen (→ § 2 Rn 11 ff.; § 5 Rn 2 ff.), um eine möglichst gegenstandsadäquate Wahrnehmung der Wirklichkeit bemüht.
8
Der erste Versuch einer Synthese verschiedener theoretischer Zugangswege zur Kriminalität erfolgte durch den Vereinigungsgedanken von Liszts. Kennzeichnend dafür war das Bemühen, den Anlage-Umwelt-Streit in einem pragmatischen Sowohl-als-auch aufzulösen (→ § 4 Rn 24 ff.), das keiner bestimmten theoretischen Vorstellung verpflichtet war, sondern sich allein von dem praktischen Anliegen leiten ließ, aus der Erkenntnis der Ursachen des Verbrechens Ratschläge für seine Verhütung und die Besserung von Kriminellen zu entwickeln. Unabhängig von jenem historischen Beispiel sind Zweifel anzumelden, ob es überhaupt möglich ist, verschiedene theoretische Zugangswege zur Kriminalität ohne die Entwicklung eines diese Theorien überspannenden gemeinsamen theoretischen Dachs („Metatheorie“) zu bündeln. Dieses Problem wird uns bei der heutigen Version des Vereinigungsgedankens, dem multifaktoriellen Ansatz (→ § 10 Rn 12 ff.), noch beschäftigen.
9
Vorerst sei Skepsis angedeutet: Die Vorstellung eines kriminologischen Gemischtwarenladens, der seine Regale gemäß der Nachfrage der Verbraucher in Kriminaljustiz und -politik kundenfreundlich einrichtet und darauf „Erkenntnisse“ beliebiger theoretischer Herkunft stapelt, entspricht dem Verwertungszusammenhang der Bedarfsforschung (→ § 1 Rn 9), entbehrt jedoch des von uns als unabdingbar angesehenen theoretischen Zugangs. Infolgedessen kann jeder Verbraucher in Kriminaljustiz und -politik sich nach seinen unüberprüften und zumeist unbewussten alltagstheoretischen Vorstellungen bedienen. Der Gemischtwarenladen ist unwillentlich und unkontrolliert mit der Summe der alltagstheoretischen Vorstellungen derer befrachtet, die „Erkenntnisse“ aus ihm beziehen.
10
Die Annahme, es gebe viele verschiedenartige Kriminalitätsursachen, lässt offen, worin diese konkret bestehen und in welchem Ausmaß sie jeweils für die Entstehung von Kriminalität verantwortlich sind. Um den Vereinigungsgedanken in einem theoretisch anspruchsvollen Sinne formulieren zu können, müsste man die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Entstehung von Kriminalität kennen und wissen, welchen Anteil sie jeweils besitzen. Sogar der als solcher theoretisch anspruchslose Vereinigungsgedanke ist auf theoriegeleitete Annahmen angewiesen, weil eine zureichende Kriminalitätserklärung nicht ohne die zumindest implizite und heuristische Festlegung auf bestimmte theoretische Prämissen auskommt. Auch das induktive Sammeln von vermeintlich mit Kriminalität zusammenhängenden Fakten beruht auf theoretischen Vorentscheidungen, durch welche die Faktenauswahl eingegrenzt und strukturiert wird. Der Verzicht auf eine bewusste theoretische Orientierung bewirkt keine Theorieabstinenz, sondern bloß die ungeprüfte Übernahme spekulativer Alltagstheorien.
[57]11 Diese Einsicht hat im 20. Jahrhundert zur Ausbildung verschiedener Kriminalitätstheorien geführt, die – jede in sich schlüssig – aus einer jeweiligen bezugswissenschaftlichen Perspektive (→ § 1 Rn 4) eine bestimmte Wahrnehmung von Kriminalität vermitteln – und damit jeweils in ihrer Aussagekraft begrenzt bleiben. Die meisten aktuellen Theorien studieren Kriminalität als eine besondere Form menschlichen Verhaltens und nehmen an, dieses Verhalten sei mit einer empirisch belegbaren Wahrscheinlichkeit von vorgegebenen Umständen der Biologie oder der Psyche des Individuums oder von dessen sozialer Umgebung abhängig. Die Annahme einer solchen Abhängigkeit im Sinne einer Wahrscheinlichkeitsbeziehung charakterisiert die Theorien als deterministisch (→ § 3 Rn 18, § 4 Rn 13 f.). Durch die Prüfung und Bestätigung dieser Wahrscheinlichkeitsdetermination in Erfahrungstests wird das kriminelle Verhalten aus seiner Abhängigkeit von den es beeinflussenden Faktoren erklärt. Diese Erklärung ist ätiologisch (Ätiologie = Ursachenforschung), insofern sie Ursachen der Kriminalitätsentstehung und -verbreitung benennt.
12
Erklären (→ § 2 Rn 8 f.) meint, beobachtete Regelmäßigkeiten von Ereignissen und die kausalen Beziehungen zwischen ihnen einer Theorie zuzuordnen. So könnte die Beobachtung, dass heute in X-land trotz gleicher Einwohnerzahl mehr Straftaten registriert werden als vor 10 Jahren, mit der inzwischen gestiegenen Arbeitslosigkeit zusammenhängen. Bei der Erklärung wird zunächst eine Aussage („Registrierte Kriminalität hängt mit gemeldeter Arbeitslosigkeit zusammen“) aufgestellt, die einen solchen Zusammenhang behauptet und empirisch überprüfbar ist (durch Vergleich der Registrierungen von Kriminalität und der Arbeitslosigkeit heute mit den Daten von vor zehn Jahren). Diese Aussage wird als Hypothese bezeichnet. Die Hypothese formuliert eine Beziehung (Grund-Folge-Relation) zwischen dem Effekt Kriminalität und den diesen Effekt mutmaßlich bedingenden davon unabhängig existierenden Faktoren. Die bedingenden Faktoren werden unabhängige Variablen, der dadurch bewirkte Effekt abhängige Variable genannt. Dann wird mit empirischen Forschungsmethoden überprüft, ob die Hypothese mit der sozialen Wirklichkeit übereinstimmt.117
„Warum platzte über Nacht der Kühler meines Autos? Der Tank war bis an den Rand mit Wasser voll; der Deckel war fest verschlossen; es war kein Anti-Frost-Mittel eingefüllt worden; der Wagen stand im Hof; die Temperatur sank während der Nacht wider Erwarten auf einige Grade unter Null. Dies waren die Antecedensdaten. In Verbindung mit den Gesetzen der Physik – insbesondere dem Gesetz, dass sich das Volumen von Wasser ausdehnt, wenn es gefriert – erklären sie, dass der Kühler geplatzt ist. Mit der Kenntnis der Antecedensdaten [58] und der Gesetze hätten wir das Ereignis mit Sicherheit voraussagen können. Dies ist in der Tat ein gutes Beispiel für eine Erklärung.“118
13
Die erklärende retrospektive Annahme, das erhöhte Kriminalitätsvorkommen stehe mit der inzwischen gestiegenen Arbeitslosigkeit in Zusammenhang, lässt sich zwanglos in die prospektive prognostische Aussage umkehren, dass bei weiter steigender Arbeitslosigkeit vermutlich auch die Kriminalität weiter zunehmen werde. Daraus wird die praktische Bedeutung kriminalätiologischer Aussagen deutlich: Eine zureichende Ursachenerklärung gibt die Grundlage für eine Kriminalitätsprognose (→ § 10 Rn 15 ff.) und damit für ein Kriminalitätsvorbeugungsprogramm ab.
14
Doch Vorsicht! Wir sollten uns an die vom Kritischen Rationalismus bezeichneten Grenzen erfahrungswissenschaftlicher Realitätserfassung (→ § 3 Rn 13 ff.) und an die insoweit beschränkte Verwertbarkeit von am Erklärungsmodell orientierten empirischen „Sozialdaten“ (→ § 3 Rn 18) für die praktische Kriminalpolitik erinnern, um diesen Gedanken nicht zu überzeichnen. Empirische Belege für theoretische Annahmen über das Zustandekommen, die Entwicklung und die Verbreitung kriminellen Verhaltens können die Kriminalitätsentstehung nicht definitiv „klären“. Empirisch erweisbar ist nur die Widerlegung, nicht die Bestätigung einer Theorieannahme. Die Erfahrungsübereinstimmung einer Hypothese besagt bloß, dass die Vermutung ihrer Wahrheit in den veranstalteten Erfahrungstests nicht entkräftet wurde, die Hypothese also in einem vorläufigen, mit prinzipiellen Irrtumsmöglichkeiten behafteten Sinne als bestätigt anzusehen ist. Kriminalätiologische Aussagen bleiben allemal Wahrscheinlichkeitsannahmen, deren „Wahrheit“ empirisch nicht endgültig beweisbar ist.
15
Dem gemäß ist es unmöglich, die „letztlichen“ oder „eigentlichen“ Ursachen der Kriminalität erfahrungswissenschaftlich auszumachen. Kriminalätiologische Theorien können nur Faktoren benennen, deren kausaler Zusammenhang mit kriminellem Verhalten einstweilen mehr oder weniger gut auf kontrollierte Beobachtung gestützt werden kann. Die Feststellung eines solchen Zusammenhanges lässt lediglich die probabilistische Aussage zu, dass bei bestimmten Ausgangsbedingungen die Wahrscheinlichkeit späteren Auftretens bestimmter Kriminalitätsphänomene größer ist als bei Fehlen dieser Ausgangsbedingungen. Nicht hingegen lässt sich daraus ableiten, die Kriminalitätsphänomene seien durch die Ausgangsbedingungen in einem strengen Sinne verursacht. Eine solche unzulässige Verwechslung von Korrelation mit Kausalität liefe auf den induktiven Fehlschluss post hoc, ergo hoc (weil Ereignis X nach Ereignis Y gehäuft auftritt, wurde Ereignis X durch Ereignis Y bewirkt) hinaus.
[59]16
Induktionen – also Schlüsse von erfahrungsgestützten Einzelaussagen auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten – sind nicht logisch zwingend. Wenn wir beobachten, dass Schwäne weiß gefiedert sind und Gefängnisinsassen armen und zerrütteten Familien entstammen, neigen wir zu generalisierenden Aussagen wie: Alle Schwäne sind weiß, sämtliche Strafgefangene entstammen armen und zerrütteten Familien. Solche Aussagen bezeichnen nicht Gesetzmäßigkeiten, sondern enthalten bloß einstweilen durch Erfahrung gestützte Hypothesen, die an neu zu gewinnender Erfahrung scheitern können. Mit der Beobachtung eines schwarzen Schwans oder der Feststellung, dass es Strafgefangene aus reichen und intakten Familien gibt, werden die vorläufig bestätigten Hypothesen widerlegt. Stets ist mit der Widerlegung auf Erfahrung beruhender Annahmen über die Kriminalitätsentstehung zu rechnen. Die Suche nach den „eigentlichen“, „letzten“ Kriminalitätsursachen ist deshalb unnütz. Diese Frage zu stellen, hieße, mit Ursachen zu rechnen, die kriminelles – wie überhaupt menschliches – Handeln in einem zwingenden Sinne, nicht nur im Sinne statistischer Wahrscheinlichkeit, determinierten. Richtig verstanden, behaupten kriminalätiologische Theorien deshalb keine zwingende Determiniertheit kriminellen Verhaltens durch bestimmte Ursachen, sondern nur einen einstweilen unwiderlegten statistisch begründbaren Wahrscheinlichkeitszusammenhang von Kriminalität mit bestimmten Einflussfaktoren.
17 Diese Einsicht relativiert die Erklärungskraft ätiologischer Theorien. Die Feststellung bestimmter Zusammenhänge schließt nämlich prinzipiell nicht aus, dass es andere Zusammenhänge im Sinne intervenierender Variablen119 gibt, die nicht geprüft wurden und die unter Umständen vom gewählten theoretischen Ausgangspunkt her gar nicht überprüfbar sind. Die Beobachtung, dass Kinder und Jugendliche mit großen Füssen statistisch über eine höhere Intelligenz als solche mit kleinen Füssen verfügen, lässt keinen Schluss von der Schuhgröße auf die Intelligenz zu, weil dabei das Alter als intervenierende Variable unberücksichtigt bleibt, das sowohl die Schuhgröße wie die Entwicklung der Intelligenz beeinflusst. Erfahrungsgestützte Theorien sind nichts weiter als Orientierungen des Verstandes, welche die freie Assoziation disziplinieren, indem sie diese in eine bestimmte Richtung lenken – und damit von anderen gleichermaßen konsistent verfolgbaren Denkrichtungen entfernen. Nicht die Theorien, sondern nur die mit Hilfe der Theorien erbrachten Erklärungen können wahr oder falsch sein. Erfahrungsgestützte Theorien erweisen sich bei der Anwendung als mehr oder weniger plausibel und brauchbar, um getätigte Wahrnehmungen zu interpretieren und sinnvolle Zusammenhänge zwischen Einzelbeobachtungen herzustellen.
[60]II. Reichweite und Einteilung
18
Genau genommen suggeriert der Begriff „Kriminalitätstheorie“ eine falsche Vorstellung. Er weckt die uneinlösbare Erwartung, die Kriminalitätsgenese vermittels konsistenter empirisch überprüfbarer Theorieannahmen adäquat und umfassend darstellen und erklären zu können. Dies ist unmöglich, weil die theoretische Wahrnehmung notwendig perspektivgebunden und eine endliche Menge von Wahrnehmungsperspektiven nicht nachweisbar ist. Je nach gewählter theoretischer Prämisse fallen das Abstraktionsniveau und die Reichweite der zu prüfenden Annahmen sowie die empirischen Prüfmöglichkeiten unterschiedlich aus. Die Unsicherheit bei der Beantwortung der eingangs (→ § 1 Rn 1) gestellten Frage: „Was ist Kriminalität und was ist daran erklärungsbedürftig?“ deutete die Problematik bereits an.
19
Wegen der Unterschiede hinsichtlich Fragestellung, Abstraktionsgrad, Erklärungsreichweite und empirischer Prüfmöglichkeit sind die einzelnen Kriminalitätstheorien nicht ohne weiteres vergleichbar. Entgegen des begrifflichen Anscheins wollen und können Kriminalitätstheorien nicht die Kriminalität und die damit assoziierbaren Realphänomene in toto erklären, sondern weisen nur einzelne Zugangswege zu jeweils besonderen Aspekten des Kriminalitätsphänomens. Sie sind Anwendungen bezugswissenschaftlicher (→ § 1 Rn 4) Theorien auf das Problemfeld Kriminalität, von dem aus der gewählten bezugswissenschaftlichen Perspektive immer nur die jeweils fachimmanent zugänglichen Aspekte ins Blickfeld gelangen.
20
Da jede Theorie nur bestimmte, ihrem Wahrnehmungshorizont zugängliche, Relevanzstrukturen des Kriminalitätsphänomens berücksichtigt, liegt es nahe, sich um eine Kombination verschiedener Kriminalitätstheorien zu bemühen. Doch ist die Erwartung, dass die einzelnen Theorien in gegenseitiger fruchtbarer Ergänzung ein aussagekräftiges Gesamtbild der Kriminalität und ihrer Bezüge formen würden, wohl nicht einzulösen. Die Theorien liefern eben nicht Teile eines Puzzles, die einfach zusammengelegt werden könnten, sondern gleichsam Stücke mit runden und eckigen Kanten, die nicht ohne Lücken zusammenpassen, und deren unterschiedliche Höhen sich nicht auf die Zweidimensionalität des Puzzlebildes reduzieren lassen.
21
Obgleich Kriminalitätstheorien zumindest derzeit nicht zu einer in sich konsistenten Globaltheorie geordnet werden können, bestehen doch zwischen den einzelnen Theorien Zusammenhänge und Abhängigkeiten. Der zunächst naheliegende Eindruck eines beziehungslosen Nebeneinanders von unterschiedlichen Beobachtungsfeldern und -perspektiven täuscht. Dies wird schon dadurch deutlich, dass die verschiedenen Theorien in Konkurrenz zueinander stehen.
22
Während vordem eine „Schule“ – oder zumindest die Auseinandersetzung mit ihr – das kriminologische Denken einer Epoche bestimmte, ist im 20. Jahrhundert das [61]Monopol einer epochalen Kriminalitätserklärung gebrochen und hat einem freien Markt vielfältiger Erklärungsangebote Platz gemacht. Obwohl die theoretischen Deutungsmuster je einzeln eine konsistente Kriminalitätserklärung abzugeben beanspruchen, sind sie doch immer nur als Alternative zu konkurrierenden gleichzeitig vertretenen anderen Deutungsmustern zu verstehen. Wie immer überzeugt man von einer bestimmten Kriminalitätserklärung sein mag – das Bewusstsein, dass auch andere Deutungsmöglichkeiten wissenschaftlich vertretbar sind, bleibt allgegenwärtig.
23
Die Konkurrenzsituation ist erklärungsbedürftig, scheint doch die Befassung mit dem einen thematischen Aspekt oder Gegenstandsbezug so legitim wie die Behandlung eines anderen. Weshalb zwischen den sich mit kriminellen Individuen befassenden Mikrotheorien und den soziale Strukturen thematisierenden Makrotheorien Brücken bestehen sollen, ist zunächst ebenso wenig einsichtig wie, weshalb den Mikrotheorien vorzuwerfen sei, dass sie die Makroperspektive vernachlässigen und umgekehrt. Indes ergeben sich Zusammenhänge daraus, dass sich einzelne Theorien in ihren Erklärungsansprüchen überschneiden, wobei die empirische Bestätigung der einen Erklärungshypothese die der anderen in Zweifel zieht. So wird die biologische Annahme der kriminellen Veranlagung bestimmter Individuen durch den Nachweis von Einflüssen des sozialen Umfeldes oder der gesellschaftlichen Struktur auf das Kriminalitätsvorkommen irritiert: denn wenn kriminelles Verhalten mit der individuellen Veranlagung zusammenhinge, müsste dieser Zusammenhang in unterschiedlichen sozialen Umfeldern und Strukturen stabil bleiben.
24 Für jede bislang vertretene Kriminalitätstheorie ist charakteristisch, dass sie weder notwendige Bedingungen kriminellen Verhaltens angibt noch, dass die von ihr angegebenen Bedingungen zur Erklärung des Auftretens kriminellen Verhaltens hinreichen. Wieso keineswegs jede Integration in eine deviante Subkultur kriminelles Verhalten auslöst, kriminelle Karrieren trotz gleichbleibend negativer Einflüsse mitunter unvermutet abbrechen, frühkindliche Fehlentwicklungen oder psychopathologische Auffälligkeiten großteils anders als durch Delinquenz kompensiert werden, lässt sich bislang ebenso wenig zulänglich beantworten wie unter welchen Randbedingungen ein Ladendiebstahl anomietheoretisch oder frustrationstheoretisch zu beantworten ist. Die Ableitung prognosetauglicher Aussagen aus kriminalitätstheoretischen Annahmen scheitert an der derzeit unüberwindlichen Schwierigkeit, die Zusatzvoraussetzungen erschöpfend und zugleich hinlänglich präzise zu benennen, welche die behauptete Stringenz der jeweiligen kriminalitätsindizierenden Faktoren erst herstellen.
25
Kriminalitätstheorien sind darum bloß Fragmente einer universellen Erklärung der Kriminalitätsgenese, Versatzstücke, die in ihrer Eindimensionalität prinzipiell inadäquat ausfallen. Sie liefern Teilerklärungen bestimmter Phasen der delinquenten [62]Entwicklung, deren Gesamtverlauf einstweilen nicht adäquat darstellbar ist. Deshalb sind sie nicht im (anspruchsvollen) Wortsinne Theorien der Kriminalität, sondern nützliche heuristische Vorstellungshilfen oder modellhafte Ansätze mit je beschränkter Perspektive und Reichweite.
26
Diese zurückhaltend-skeptische Einschätzung macht die Beantwortung der kriminalätiologischen Frage nach den Bestimmungsgründen für das Zustandekommen, die Entwicklung und die Verbreitung kriminellen Verhaltens schwieriger denn je. Die meisten von uns werden – mehr oder weniger intuitiv – eine bestimmte Ursachenerklärung anderen vorziehen. Der Glaube an die Abhängigkeit strafbaren Verhaltens von Einflüssen der biologischen Anlage, des sozialen Umfeldes oder der Gesellschaftsstruktur verleitet zur gleichsam statischen Annahme eines strengen Ursache-Wirkungs-Zusammenhanges, die der Komplexität und Dynamik von Kriminalitätsphänomenen nicht gerecht wird. Eine solche statische Annahme ist verlockend, weil sie eine erschöpfende Erklärung von Kriminalitätsphänomenen behauptet. Der Hinweis, dass eine bestimmte Anlage, ein bestimmtes soziales Umfeld oder eine bestimmte Gesellschaftsstruktur keineswegs zwingend zu kriminellem Verhalten führt, irritiert die um eingängige und endgültige Antworten bemühten Gemüter. Machen wir uns frei von solchen allzu simplen Vorstellungen und seien wir bereit, anzuerkennen, dass die Kriminalitätsentstehung komplexer ist als die um vorschnelle Problemlösungen bemühten eindimensionalen Alltagsvorstellungen.
27
Diese Überlegungen sollten nicht im Sinne einer prinzipiellen Unerklärbarkeit der Kriminalität missverstanden werden. Die Behauptung von der Unergründlichkeit der Kriminalitätsentstehung macht aus dieser ein Mysterium, ein unlösbares Rätsel120, dem mit Mitteln des Verstandes nicht beizukommen ist und welches eine vernünftige Kriminalpolitik desavouiert. Wir sollten nicht vorschnell den begrenzten Erkenntnisfortschritt preisgeben, den Kriminalitätstheorien erbringen, sondern aus der Erkenntnis der Begrenztheit dieses Fortschritts die Lehren ziehen. Darauf ist bei der zusammenfassenden Würdigung der Kriminalitätstheorien (→ § 14) zurückzukommen.
28
Wir wollen das Theorienspektrum in seiner gesamten thematischen Bandbreite erörtern. Freilich ist angesichts der schier unendlichen Nuancierungsmöglichkeiten keine vollständige, sondern eine typisierende Darstellung angezeigt.121 Die Darstellung folgt einer systematischen Einteilung und nicht stets chronologisch der historischen Entstehung der erörterten Theorien.
29 Drei Typen kriminologischer Theorien können unterschieden werden: Theorien, welche individuelle Merkmale benennen, die die Wahrscheinlichkeit kriminellen [63]Verhaltens erhöhen. Ferner Theorien, welche Strukturmerkmale sozialer Einheiten bezeichnen, die die Häufigkeit und Verteilung des Kriminalitätsvorkommens beeinflussen. Schliesslich Theorien, welche sich mit der Kontrolle der Kriminalität befassen. Individuenbezogene Theorien verwenden biologische, psychologische und psychiatrische Erklärungen. Diese Theorien gehen davon aus, dass die Bereitschaft zur Verübung kriminellen Verhaltens bei manchen Menschen größer als bei anderen ist, unabhängig von der sozialen Situation, in der sich diese befinden. Auf soziale Einheiten bezogene Theorien verwenden soziologische und sozialpsychologische Erklärungen. Diese Theorien nehmen an, dass gewisse ungünstige Beschaffenheiten des sozialen Umfelds mit einem erhöhten Kriminalitätsvorkommen und einer bestimmten Kriminalitätsverteilung zusammenhängen, unabhängig von den Merkmalen der Individuen, die sich in diesem Umfeld befinden. Beide Theorietypen richten sich auf die Erklärung kriminellen Verhaltens, sind also Kriminalitätstheorien. Auf die Kriminalitätskontrolle bezogene Theorien sind zunächst Kriminalisierungstheorien, die sich mit den förmlichen Reaktionen auf Kriminalität und den Verläufen der Reaktionsprozesse befassen. Daneben sind solche Theorien ebenfalls Kriminalitätstheorien, die das Auftreten „sekundärer Devianz“ (→ § 13 Rn 6) aus der Übernahme eines durch Kontrollvorgänge erzeugten kriminellen Selbstbildes bestimmen.
30
Zunächst werden individuenbezogene Theorien erläutert, welche um die Aufklärung der individuellen Ursachen des Straffälligwerdens (also ätiologisch) bemüht sind und das deterministische Verhaltenskonzept sowie das Erklärungsmodell zu Grunde legen. Wir werden diesen Theorietyp an Hand von Entwicklungen der Biokriminologie (→ § 7) und psychologischer und psychiatrischer Persönlichkeitskonzepte (→ § 8) darstellen.
31
Bei den auf soziale Einheiten bezogenen Theorien werden Abnormitäten mit der Häufigkeit und Art des Kriminalitätsvorkommens in diesen Einheiten in Zusammenhang gebracht. Diese Theorien nehmen an, dass soziale Einheiten verhaltensbestimmend sind, insofern eine Mehrheit der in diesen Einheiten lebenden Individuen den darin bestehenden Verhaltenserwartungen folgen wird. Solche sozialen Einheiten lassen sich auf der Mikroebene des Umfelds des Täters, der Mesoebene sozialer Teilsysteme und der Makroebene gesamtgesellschaftlicher Strukturen lokalisieren. Auch diese Theorien sind (im Sinne statistischer Wahrscheinlichkeit) deterministisch, erklärend und ätiologisch. Wir werden diesen Theorietyp an Beispielen sozialstruktureller Konzepte (→ § 9) und der Sozialisation im sozialen Nahbereich (→ § 10) studieren. Die anschließend zu erörternden Kontrolltheorien (→ § 11) beruhen im Kern auf der Annahme von kriminalitätsbegünstigenden Kontrolldefiziten und lassen sich ebenfalls dem Typ der Kriminalitätserklärung aus Abnormitäten sozialer Einheiten zuordnen. Bei den aktuellen spätmodernen Theorien (→ § 12) ist eine eindeutige Typisierung nicht möglich. Während die ökonomische [64]Kriminalitätstheorie eine von sozialen Einflüssen freie, also indeterministische Verhaltenswahl behauptet (→ § 12 Rn 12 ff.), geht die allgemeine Theorie von Gottfredson und Hirschi (→ § 12 Rn 43 ff.) von einer frühkindlichen, lebenslang erhalten bleibenden Verhaltensprägung durch Bezugspersonen aus.
32
Als auf die Kriminalitätskontrolle bezogene Theorie ist der labeling approach (→ § 13 Rn 6 ff.) bekannt. Dieser befasst sich mit den Bedingungen der Vergabe der Eigenschaft „kriminell“ durch den Gesetzgeber und die Instanzen der Strafrechtsanwendung. Um die Verbindung des labeling approach mit dem Verstehensmodell (→ § 2 Rn 11 ff.) deutlich zu machen und die fortwährende Bedeutung dieses Modells auch nach dem inzwischen eingetretenen Bedeutungsverlust des labeling approach zu begründen, wird Kriminalität in den Zusammenhang mit sozialer Interaktion gerückt und das interpretative Paradigma (→ § 13 Rn 1 ff.) als Leitidee präsentiert. Schließlich wird die soziale Konstruktion der Geschlechterrollen von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ in der Genderforschung als allgemeiner Deutungsrahmen für das Verständnis der Kriminalitätskontrolle und als Anwendungsbeispiel des interpretativen Paradigmas herausgearbeitet (→ § 9 Rn 33 ff.).
117 Atteslander 2010, 24 ff.; Friedrichs 1990, 94.
118 S. von Wright 1974, 25.
119 Friedrichs 1990, 94.
120 Lange 1970.
121 Weitere Differenzierungen etwa bei Eifler 2002, 59, 69, 72.