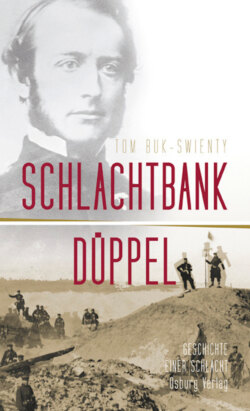Читать книгу Schlachtbank Düppel: 18. April 1864. - Tom Buk-Swienty - Страница 19
8. Der Gesandte des Roten Kreuzes
ОглавлениеDie Schlachtfelder des 19. Jahrhunderts waren grausig. Nach der Schlacht bei Austerlitz im Jahr 1805 hatte das französische Heer 9000 Tote und Verletzte, die russisch-österreichischen Gegner 26000 zu beklagen. In der Schlacht bei Borodino vor Moskau 1812 verloren 28000 Franzosen und 40000 Russen ihr Leben. Bei Waterloo verlor Napoleon 23000 Mann und die preußischen und britischen Gegner 15000 beziehungsweise 7000. Im amerikanischen Bürgerkrieg 1861–1865 war die Ungeheuerlichkeit grenzenlos. 620000 Soldaten starben in diesem Krieg.
Im 19. Jahrhundert war Krieg nicht gerade etwas für zarte Seelen, zumal die Kriegschirurgie noch in ihren Anfängen steckte. Erst Mitte des Jahrhunderts wurden Chirurgen als richtige Ärzte anerkannt und bekamen eine ordentliche medizinische Ausbildung. Bis dahin hatte die Armee Barbiere – sogenannte Feldschere – als Chirurgen angeheuert, wenn es ins Feld ging. Ungefähr ab 1850 (und vor allem im amerikanischen Bürgerkrieg) begannen Ärzte und Chirurgen, Betäubungsmittel einzusetzen, entweder Äther oder Chloroform. Es gab allerdings auch weiterhin Ärzte – im Gegensatz zur preußischen insbesondere in der dänischen Armee –, die schworen, eine Betäubung würde mehr Schaden als Nutzen anrichten. Sie meinten, beobachtet zu haben, dass die Widerstandskraft und die Fähigkeit ihrer Patienten, schwere Operationen zu überleben, geschwächt würden, wenn man sie betäubte.
Auf medizinischer Seite stellte man seit Mitte des Jahrhunderts fest, dass mehr Patienten Operationen überlebten, je besser die hygienischen Verhältnisse waren – allerdings war man sich nicht wirklich im Klaren, warum. Noch war die Bakteriologie unbekannt. Obwohl man wusste, dass gute Hygiene wichtig war, herrschte in den Feldlazaretten eine ungeheure Schweinerei, wenn es zur Schlacht kam. Alles musste so schnell gehen, dass niemand an Reinlichkeit denken konnte. Wenn die Feldärzte amputierten, benutzten sie stundenlang dasselbe Messer. Sie wischten es selten ab, und wenn, dann lediglich an ihrer Schürze. Dreck, Blut, Körperflüssigkeiten. Alles vermischte sich, wenn die Ärzte schnitten.
Und die Chirurgen schnitten den ganzen Tag. Manch einer brüstete sich, imstande zu sein, mehr als eine Amputation pro Minute durchzuführen. Weniger imponierend war die Statistik, wie viele Soldaten selbst kleinere Amputationen nicht überlebten. Oft kam es zu Entzündungen in der Wunde, und die Patienten starben häufig am sogenannten Wundfieber.
Mitte des 19. Jahrhunderts starb ungefähr jeder zweite Patient an den Folgen einer Entzündung nach einer Amputation. Aber am meisten verwundert, dass damals überhaupt so viele Soldaten nach Amputationen mit dem Leben davonkamen.
Bei Düppel waren die Verletzten aufgrund der vielen Granateneinschläge besonders übel zugerichtet. Die Granaten rissen Glieder ab und zerfetzten die Körper, sodass Nähen unmöglich war.
In Anbetracht all des Elends, das eine Kriegsfront im 19. Jahrhundert bot, war die gut gekleidete, sensible Gestalt, die vom 16. April an unter den dänischen Soldaten auf Alsen und im Feldlazarett von Sønderborg gesehen wurde, umso bemerkenswerter.
Der sechsundvierzig Jahre alte Mann war gesundheitlich angeschlagen, nervlich und physisch – und er konnte den Anblick von Blut nicht ertragen, von Eingeweiden gar nicht zu sprechen. Das betonte er in seinen Briefen immer wieder. Dennoch war er gekommen, um sich einen Einblick in die Verhältnisse der dänischen Lazarette zu verschaffen. Sein Name lautete Charles William Meredith van de Velde. Er war bekannt als Kapitän van de Velde. Ein Niederländer, der sich in Genf niedergelassen hatte. Van de Velde nahm an der ersten Delegation des Roten Kreuzes in der Geschichte teil, einer Delegation von lediglich zwei Personen. Zusammen mit einem Kollegen war van de Velde der Erste, der sich mit der später so berühmten Rot-Kreuz-Binde am Arm auf einem Kriegsschauplatz befand. Oder besser: Kapitän van de Velde war eigentlich eine Einmanndelegation. Seine Aufgabe bestand darin, die dänische Seite der Front zu observieren, während der Schweizer Louis Appia als Beobachter auf der preußischen Seite teilnahm.
Van de Velde und Louis Appia gehörten dem Kreis um Henri Dunant an, der sich für die Gründung einer internationalen, neutralen und humanitären Organisation einsetzte, die Verletzte und Kriegsgefangene versorgen und betreuen sollte. Van de Velde und Appia waren bei den Genfer Bürgern als hervorragende Humanisten und Philanthropen bekannt.
Van de Velde, ein höflicher und sehr gläubiger Mann mit milden Augen, der stets untadelig gekleidet war und sich mit einer Aura von Respektabilität und Bildung umgab, war ungewöhnlich viel herumgekommen. Er hatte als Kapitän der niederländischen Flotte gearbeitet, sah sich aber eigentlich als Maler und Zeichner. An der holländischen Flottenakademie begegnete er dem berühmten Marinemaler Petrus Johannes Schotel, der ihn zum Illustrator und Vermesser ausbildete. Van de Velde wurde als Kartograf der Marine ausgesandt, von fernen Gegenden wie Indonesien, Syrien und Palästina Karten anzulegen. Einige der besten Karten von Jerusalem in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat van de Velde gezeichnet.
Doch nun befand er sich hier im hohen Norden, wo er am 17. April einen weiteren Brief an Henri Dunant schrieb. Ganz genau hielt sich van de Velde beim Stellmacher von Ulkebøl auf, dort teilte er ein Zimmer mit einem dänischen Feldgeistlichen, Erik Høyer Møller. Das Haus des Stellmachers lag neben dem dänischen Hauptquartier im Pfarrhof, und ungefähr gleichzeitig mit General Gerlachs verzweifeltem Brief ans Kriegsministerium in Kopenhagen, setzte van de Velde den Stift aufs Papier, um zu berichten, was er in den vergangenen Tagen erlebt hatte.
In der Nacht zum 17. April hatte er die Erlaubnis bekommen, ein dänisches Feldlazarett in Sønderborg zu besuchen:
»Um neun Uhr abends kamen wir an einem Haus in Sønderborg an, das nicht zerstört war. Das Haus war nicht geschützt vor den Granaten und Granatsplittern, die überall um uns herumflogen. Was für eine Nacht! Und obwohl der Beschuss noch nicht so stark wir gewöhnlich war, trafen 30 Verwundete von der Düppeler Festung ein. Von ihnen war die Hälfte leichter verwundet, von der anderen Hälfte starben drei, drei anderen wurden die Arme oder Beine amputiert. Alle Wunden hatten Granatsplitter verursacht, und die Form der Projektile ist von solcher Beschaffenheit, dass die Wunden fürchterlich aussehen. Das Fleisch und der Knochen ist abgeschossen, aber nicht, wie man es von einer Kugelverletzung kennt, sondern auf eine ganz fürchterliche Art und Weise zerfetzt. Man muss gute Nerven haben, um einen derartigen Anblick zu ertragen.«
Van de Velde gab zu, dass es ihm exakt daran fehlte. »Meine Nerven hielten die Amputation eines zerschlagenen Arms einfach nicht aus. Sie ließen mich im Stich und ich war den Rest der Nacht krank.«
Nüchtern stellte van de Velde fest, »ich werde sicher niemals ein Krankenpfleger, wenn ich nicht besser mit Situationen wie dieser umzugehen lerne«.
Aber immerhin war er nicht in Ohnmacht gefallen wie beim ersten Mal, als er ein dänisches Lazarett betreten durfte. Den Zugang hatte Erik Høyer Møller ihm verschafft.
Høyer Møller hatte den niederländischen Entsandten des Roten Kreuzes zu einem nahe gelegenen Lazarett mitgenommen, in dem der erste Anblick laut Feldgeistlichem »ein Mann war, dessen eine Seite von einer Granate so aufgerissen worden war, dass die Eingeweide heraushingen«. Und dieser Anblick, das gab Høyer Møller zu, der als Feldgeistlicher während des Dreijährigen Krieges bereits einiges gesehen hatte, »konnte einen schon schlucken lassen«.
Høyer Møller hatte van de Velde mit dem Arzt des Lazaretts allein gelassen, und das war kein Erfolg gewesen. »Van de Velde«, schrieb Høyer Møller, »kam kurz darauf mit der bedauerlichen Mitteilung nach Hause, er wäre ohnmächtig geworden. Später erhielt ich vom Oberarzt eine Notiz, in der er darum bat, ihn künftig mit derartigen Zuschauern zu verschonen.«
In der Nacht zum 17. April hielt sich van de Velde dennoch wieder in einem dänischen Lazarett auf und lernte hier einen der tüchtigsten Chirurgen in dänischen Diensten kennen, den norwegischen Arzt Theodor Denoon Reymert, der sich freiwillig gemeldet hatte.
Reymert ist es wert, dass wir uns einen Moment mit ihm beschäftigen. Denn der in Kristiansand geborene Arzt hat ein ungewöhnliches Tagebuch von der Front bei Düppel hinterlassen, wortkarg und dennoch bildhaft. Der neunundvierzigjährige Reymert diente als Korpsarzt der norwegischen Armee, 1857 war er auf einer Studienreise in Dänemark gewesen. Hier entstand seine Liebe zu dem Land, und als 1864 der Krieg ausbrach, meldete er sich freiwillig zum dänischen Heer. Er traf in Düppel Ende Februar ein, zu einem Zeitpunkt, als es an der Front noch relativ ruhig zuging. Der sonst recht brüske dänische Korpsstabsarzt, Professor John Rørbye, empfing den Norweger freundlich. Bereits am 13. März, als die Anzahl der Verwundeten allmählich anstieg, wurde Reymert zum Oberarzt der 2. Heeresdivision ernannt; er wurde Leiter eines Lazaretts – der sogenannten 2. Ambulanz –, das man im Armenhaus von Sønderborg eingerichtet hatte. Reymert bekam die leitende Position aufgrund seiner Qualifikation – aber auch, weil schlichtweg Ärzte fehlten.
Abb. 15: Der freiwillige norwegische Arzt Theodor Denoon Reymert.
Im Grunde von dem Augenblick an, an dem Reymert die Verantwortung für das Lazarett übertragen wurde, stand er, wie aus seinem Tagebuch hervorgeht, unablässig am Operationstisch:
»24. März: Gestern fielen 250 Granaten aus Broager auf Schanze 2 … ins Lazarett kamen 5 Verletzte; ich führte 7 Amputationen durch.
28. März: Heftiger Beschuss von 3 Uhr nachts bis 10 Uhr am Vormittag. In mein Lazarett kamen 30 Verwundete, ein Hauptmann und ein Leutnant, der Letztgenannte starb.
2. April: Heftiges Bombardement Tag und Nacht, 57 Verletzte, ich nahm 5 größere und kleinere Amputationen an 4 Personen vor. Ähnliche Operationen fanden in den anderen Lazaretten statt (in Sønderborg gibt es 4 Lazarette). Ein heftiges Feuer, hervorgerufen durch preußische Brandgranaten, konnte gelöscht werden. Granaten schlugen um mein Lazarett ein, ein Mann wurde verletzt.
3. April, 10 Uhr abends: Der Himmel ist rot vom Feuer in der Stadt. 26 wurden von Granaten verletzt, die mitten in einem Regiment einschlugen, das aufs Rathaus zumarschierte; 3 verloren ihr Leben. Einem von ihnen, dem Studenten und Reserveoffizier Smidt, Sohn des Pastors von Næstved, wurden beide Beine zerschmettert. Sie wurden nachts amputiert … Es wurde gleichzeitig auf 4 Tischen operiert.
4. April: Heute Nacht um 3 Uhr versuchten die Preußen, die Schanzen zu stürmen. Lebhaftes Kanonen- und Gewehrfeuer. Der Himmel rot vom Feuer … Ein cand. jur. Larsen aus Kopenhagen … wurde in einem Zustand ins Lazarett gebracht, der es mir verbot, ihn weiter ins Lazarett von Augustenborg zu schicken, nachdem ich ihn verbunden hatte. Aus Furcht, er würde während des Transports sterben. (Nachdem er drei Tage mit Fieberfantasien gelegen hatte, starb er.)
5. April: Die Granaten bewirken fürchterliche Läsionen. Zerschmetterte und zerfetzte Glieder. Herausgerissene Eingeweide, weit umherspritzende Gehirnmasse der Unglücklichen, die am Kopf getroffen werden. Sønderborg ist an vielen Stellen abgebrannt, ein nicht geringer Teil des Ortes liegt bereits in Schutt und Asche. Die Brandgranaten fliegen wie Drachen aus Broager über diese unglückliche Stadt. Bei Sundeved stehen Höfe in Flammen, schwarzer Rauch wälzt sich über das Land.
8. April: Ungefähr 60 Verwundete jeden Tag. Heftige Schießereien. Stellung kritisch.
10. April: Gestern kamen 5 Verwundete ins Lazarett. 2 Amputationen, Arm und Schenkel. Heute ein fürchterliches Bombardement, 24 Verletzte im Lazarett.
11. April: Heftiges, ununterbrochenes Bombardement. 60–70 Verletzte wurden nach Sønderborg gebracht. Man rechnet mit 10 Amputationen.
12.–13. April: In der Nacht zwischen den beiden Tagen unablässige Kanonade. Die Schüsse lassen sich nicht zählen, sie klingen wie die Salven eines Bataillons. 98 Verletzte wurden nach Sundeved gebracht.
Abb. 16 und 17: Abbildungen aus dem Handbuch der Kriegschirurgischen Technik (1877) des deutschen Chirurgen Friedrich von Esmarch. Die Studien dafür nahm Esmarch u.a. in Düppel vor.
14.–15. April: Ich amputierte bis 1.30 nachts. Viele Verletzte.
17. April: In der Nacht besonders grässliche Kanonade.«
Einen Bericht, den Reymert nach seiner Rückkehr aus dem Krieg für norwegische Militärstellen schrieb, verfasste er in einem mehr beschreibenden Ton. Er berichtete, wie die am schwersten Verwundeten eigentlich aussahen. So hatte es einen Soldaten gegeben, dessen gesamtes Gesicht weggeschossen war. »Beide Kiefer waren zerschmettert, alle weichen Teile und die Zunge waren verschwunden, bei jedem Atemzug kam Blut, das gleichsam in seinem Schlund zu kochen schien. Die Weichteile des Gesichts hingen zerfetzt an der elastischen Haut über seiner Brust …«
Henri Dunant wollte eine internationale humanitäre Organisation gründen, um gerade die Schmerzen solcher armen Menschen zu lindern. Um zu verstehen, was van de Velde in Düppel tat, muss man die Geschichte Dunants und seiner Initiative verstehen, die zur Gründung des Roten Kreuzes führte.
Man schrieb das Jahr 1859. Der junge Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant hatte ökonomische Schwierigkeiten, weil seine Investitionen in Ländereien in Algerien aufgrund der Trockenheit keinen Ertrag brachten. Er musste den französischen Kaiser Napoleon III. sprechen, vielleicht konnte der Kaiser ihm helfen, ein groß angelegtes Bewässerungsprojekt zu finanzieren. Dunant wollte Napoleon überzeugen, dass Nordafrika zu einer Speisekammer für Frankreich werden könnte.
Doch den Kaiser zu sprechen war nicht so einfach. Frankreich befand sich im Krieg mit Österreich. Man hatte sich mit italienischen Separatisten aus Sardinien verbündet, die ein geeintes Italien und damit eine Loslösung von der österreichischen Herrschaft wollten.
Dunant, ein Zivilist in weißem Anzug, reiste den Heeren nach, und so kam es, dass er am 24. Juni 1859 Zeuge wurde, wie 200000 Soldaten bei Solferino aufeinandertrafen. Dunant besaß großes Talent zum Schreiben, und das Buch, das er über seine Erlebnisse auf dem Schlachtfeld verfasste – Eine Erinnerung an Solferino – sollte Weltgeschichte schreiben.
Die Hitze bei Solferino war unerträglich. Die Soldaten erstickten beinahe in ihren Uniformen. Es herrschte ein furchtbarer Wassermangel, und das Einzige, was die Soldaten an diesem Junitag zu trinken bekommen hatten, war Branntwein. Gleichzeitig waren sie ausgehungert von den tagelangen Märschen. Die Schlacht war nicht geplant und entwickelte möglicherweise deshalb eine derartige Grausamkeit: Man wurde von einem furchterregenden Feind überrascht und schlug blindwütig um sich. Beide Parteien wollten das hügelige Gelände um Solferino besetzen, doch aufgrund mangelhafter Aufklärung hatten die Armeen sich erst entdeckt, als es zu spät war. Fünfzehn wahnsinnige Stunden dauerte die Schlacht, die schließlich mit einem französisch-italienischen Sieg endete.
Mitten im Kampfgeschehen befand sich dieser weiß gekleidete Mann; ein Mann, der ähnlich wie van de Velde leicht zu erschüttern war. In seinen Erinnerungen schrieb Dunant:
»Fest geschlossene Kolonnen werfen sich mit unwiderstehlicher Heftigkeit übereinander wie ein zerstörender Mahlstrom, der auf seinem Weg alles umreißt; französische Regimenter rennen in verteilter Schusslinie gegen die österreichischen Massen an, die unablässig erneuert werden, sie werden immer zahlreicher und immer bedrohlicher und halten den Angriff energisch aus, als wären es Mauern aus Eisen; ganze Divisionen werfen ihr Gepäck ab, um mit größerer Leichtigkeit und gefälltem Bajonett dem Feind entgegenstürmen zu können; ein Bataillon wird zurückgetrieben, aber ein anderes folgt ihnen unmittelbar auf den Fersen. Jede einzige Erderhebung, jeder einzelne Hügel, jeder einzelne Felskamm ist Schauplatz eines hartnäckigen Kampfes.«
Nach der Schlacht hinterließ das Schlachtfeld einen besonderen Eindruck auf Henri Dunant. Drei Tage wanderte der erschütterte Schweizer zwischen Toten, Sterbenden und Verletzten umher.
»Als die Sonne am 25. aufgeht, beleuchtet sie eines der abscheulichsten Schauspiele, das die menschliche Fantasie hervorzubringen vermag. Überall ist das Schlachtfeld mit den Leichen von Menschen und Pferden übersät … Die armen Verletzten, die man den ganzen Tag über aufsammelt, sind bleich, fahl und vollkommen entkräftet, einige, nämlich die, die stark verstümmelt wurden, haben trübe Augen und scheinen nicht zu verstehen, was man zu ihnen sagt.«
Es herrschte Wassermangel und es wurden verzweifelt Ärzte und Krankenpfleger benötigt. Der Sanitätsdienst wurde teilweise in der Schlacht aufgerieben, die Leiden schienen kein Ende nehmen zu wollen. Dunant versuchte, nach bestem Wissen zu helfen. Er kniete neben den Schwerverwundeten, die ihn anflehten, bis zu ihrem letzten Atemzug an ihrer Seite zu bleiben, damit sie nicht allein sterben mussten.
Dunant versuchte auch, Helfer unter der örtlichen Bevölkerung zu organisieren, und er überzeugte die Franzosen sogar, österreichische Ärzte aus der Kriegsgefangenschaft zu entlassen, damit auch sie helfen konnten. Doch trotz aller Anstrengungen war die Hilfe unzureichend. Allerdings erlebte Dunant auch einen Lichtblick in dieser entsetzlichen Situation: Viele Menschen aus der Bevölkerung, insbesondere Frauen, zögerten nicht, die Verwundeten zu pflegen, und die Italiener taten es ohne Rücksicht auf die Nationalität der Verwundeten. Die spontane Hilfe wurde unter der Devise ›tutti fratelli‹ geleistet – wir alle sind Brüder.
Das Erlebnis von Solferino ließ Dunant nicht los, und 1862 schrieb er Eine Erinnerung an Solferino. Er finanzierte das Erscheinen des Textes selbst und schickte das Buch seinen Freunden. Dann begann er in Europa herumzureisen, um Regierungsführern und Fürsten sein Werk zu überreichen und darüber zu sprechen, was er gesehen hatte.
Er wollte eine neutrale internationale Institution aus Ärzten und Krankenschwestern schaffen, die überall auf den Kriegsschauplätzen zum Einsatz kommen sollten. Diese Ärzte und Helfer sollten in den Kampfzonen frei agieren und arbeiten können.
Eine Erinnerung aus Solferino erschütterte die Leser, und Dunant bekam Unterstützung. Er war nicht der Erste, der sich dafür einsetzte, dass in Kriegszonen eine weitaus bessere Krankenpflege notwendig war. Zur berühmtesten Verfechterin dieser Forderung wurde Florence Nightingale, eine Britin, die aus einer reichen Familie stammte und ihr Leben der Krankenpflege widmete. Sie war ebenso schockiert wie Dunant bei Solferino, als sie die Zustände für die Verwundeten während des Krimkrieges sah.
Dunant ließ sich von Nightingale und der humanistisch-progressiven Autorin Harriet Beecher-Stowe inspirieren, doch das eigentlich Revolutionäre an seinem Plan war die Idee einer internationalen Institution.
Zusammen mit vier einflussreichen Genfer Bürgern gründete Dunant am 17. Februar 1863 das Internationale Komitees der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege, noch im gleichen Jahr kamen Delegierte aus vierzehn Ländern, darunter Preußen – nicht aber Dänemark – nach Genf, um die Möglichkeiten zur Gründung einer internationalen Organisation zu diskutieren. Es wurde beschlossen, dass die Entsandten der Organisation in Kriegszonen ein weißes Armband mit einem roten Kreuz (eine Umkehrung der Schweizer Flagge) als Symbol der Neutralität tragen sollten.
Damit war das Rote Kreuz ins Leben gerufen. Nun ging es darum, die gesamte internationale Gemeinschaft zu überzeugen, man musste die Information über die Organisation verbreiten. Gleichzeitig galt es, die gegenwärtigen Schlachtfelder und die Verhältnisse für die Verwundeten zu studieren.
Van de Velde reiste nach Dänemark, um das Land für die Idee einer internationalen Hilfsorganisation zu gewinnen und sich das Kampfgebiet anzusehen. Außerdem wollte er sich persönlich um Verwundete kümmern, wenn die Möglichkeit sich ergab.
Wenn van de Velde angesichts seiner Erlebnisse in Dänemark häufig deprimiert war, so lag das nicht allein an den Grausamkeiten auf dem Schlachtfeld, sondern auch daran, dass die Dänen ihm sehr lange die kalte Schulter zeigten. Sie betrachten diesen Mann, der vier Sprachen sprach –, Französisch, Deutsch, Englisch und Holländisch, aber nicht Dänisch – mit Misstrauen. »Wozu braucht es eine internationale Organisation?« Die Dänen als Menschenschlag, konstatierte van de Velde in seinen Briefen, seien »verschlossen«, »insulär« und »selbstzufrieden«. Kurz gesagt, sie waren, wie er mehrfach betonte, »veritable Inselbewohner«. In einem Brief an Dunant vom 11. April schrieb van de Velde, »die Dänen halten an ihren eigenen Ideen fest und fürchten sich vor allen Vorschlägen, die von außen kommen. Sie haben eine deutliche Angst vor dem Fremden … Bei diesem Widerstand gegen neue Gedanken ist meine Aufgabe nicht leicht.«
Zumal die Dänen laut van de Velde in einem gottverlassenen Teil der Welt wohnten. Er war am 2. April von Paris mit dem Zug über Köln und Hamburg nach Lübeck gereist und von dort mit dem Dampfschiff nach Malmö gefahren. Kopenhagen erreichte er am 9. April. Die Reise »erschöpfte mich durch große Kälte und zehrte an meinen Kräften«.
Um zu illustrieren, wie schlimm die Kälte im Norden war, schrieb er, im Abteil der Waggons, in dem er von Köln nach Lübeck gesessen hatte, wären »die Fenster von einer dicken Eisschicht bedeckt gewesen, trotz der Wärme, die von sechs Deutschen im Abteil ausging«.
An Bord des Dampfschiffs nach Malmö war es noch kälter. »Die Überfahrt über das Baltische Meer dauerte achtzehn Stunden, gleichzeitig blies ein heftiger Nordwind, der das gesamte Tauwerk vereiste … Das Klima in diesen Breitengraden ist fürchterlich. Erst heute hat der Wind nachgelassen, aber er wurde ersetzt durch einen feuchten Nebel, so wie er in Genf im Februar vorkommen kann.«
Die Stimmung in Kopenhagen war düster. Die letzten Bulletins zeigten, dass es im dänischen Heer 5136 verletzte und kranke Soldaten gab, die in 26 Krankenhäusern im ganzen Land lagen. Gut die Hälfte der Verwundeten allerdings in Kopenhagen, »wo es kein Gebäude mehr gibt, das noch sehr viel mehr aufnehmen könnte«.
Van de Velde erlebte eine vom Krieg gezeichnete Hauptstadt:
»Brüder, Väter, Freunde … versammeln sich an den Straßenecken, um über die Beschießung von Düppel zu lesen, ständig werden Neuigkeiten angeschlagen. Ich fühle mit ihnen und sympathisiere mit all diesen trauernden Menschen, die ich überall treffe, und ich höre ihren Erzählungen über ihre Liebsten aufmerksam zu, die Tag und Nacht dem Kugelhagel ausgesetzt sind. Die Menschen, denen ich begegne, versuchen, ihre Liebe zum Vaterland mit ihrer Liebe zu ihren nächsten Angehörigen draußen an der Front in Einklang zu bringen, um deren Leben sie fürchten.«
In Kopenhagen traf van de Velde mit internationalen Zeitungskorrespondenten zusammen, die aus Düppel geflohen waren, weil sie »es für unmöglich hielten, mehr Zeit beim Heer zu verbringen. Sønderborg existiert nicht mehr. Die gesamte Stadt ist zerstört. In Augustenborg hat der Typhus die Armee und die Bewohner dezimiert. Lebensmittel und Unterkunft kosten wahnsinnige Preise …«
Van de Velde verbrachte eine Reihe von Tagen in Kopenhagen mit dem Versuch, die Dänen für die Idee des Roten Kreuzes zu gewinnen. Gewisse Sympathien erlangte er bei Ministerpräsident Monrad wie bei Kriegsminister Lundbye und der Königinwitwe Gräfin Danner. Doch vor allem waren die Dänen in einem Maße skeptisch, dass van de Velde, dem es normalerweise schwerfiel, sich herabsetzend über jemanden zu äußern, sich genötigt sah, festzustellen, der dänische Nationalcharakter sei »langsam«, »kalt« und nicht in der Lage, »Enthusiasmus zu zeigen«.
Vor allen sein Treffen mit dem dänischen Chefarzt Michael Djørup war niederschmetternd. Van de Velde nannte ihn hinterher »starrköpfig« und »ehrsüchtig«, weil Djørup die Idee rundweg ablehnte, Frauen könnten im Feld als Pflegerinnen fungieren – eine Idee, für die Dunant aufgrund seiner Erfahrungen bei Solferino eintrat. Krankenpflege in Kriegsgebieten sei eine Männerdomäne, für die Frauen weder die Fähigkeiten noch die Nerven hätten, meinte Djørup. Schockiert stellte van de Velde fest, dass die dänische Ärzteschaft sogar schwedische Frauen wieder nach Hause geschickt hatte, die nach Kopenhagen gekommen waren, um sich freiwillig als Pflegerinnen zu melden.
Obwohl van de Velde seinen Aufenthalt in Kopenhagen mit sehr gemischten Gefühlen betrachtete, konnte er sich doch nicht recht entschließen, nach Düppel zu reisen. Er wirkte ängstlich und schien den Termin der Abreise immer wieder hinauszuschieben. Er schrieb, er hoffe, Gott würde ihm das Leben schenken, denn seiner Ansicht nach würde der Aufenthalt bei der Armee »mit sicheren Gefahren verbunden sein … [in Sønderborg und Düppel] sind überall Bomben«.
Am 16. April traf er schließlich an der Front ein.
In seinem Brief vom 17. April beschrieb van de Velde, dass der Widerstand gegen eine internationale Hilfsorganisation, der ihm in Kopenhagen entgegenschlug, nichts war im Vergleich mit der Reaktion des dänischen Chefarztes bei Düppel, John Rørbye. Rørbye hatte ihm erklärt, es gebe keinerlei Bedarf für eine internationale Organisation. Es sei mehr als genug, wenn jedes Land seine eigenen privaten Wohltätigkeitsinstitutionen hätte.
Rørbye erzählte van de Velde, im dänischen Heer gebe es keinen Mangel an Männern, die »bei der Krankenversorgung helfen. Und wenn man etwas ganz bestimmt nicht wünschte, dann wären es ausländische Ärzte. Wegen ihrer mangelnden Dänischkenntnisse würde es nur zu Verzögerungen kommen.«
»Ich bot an«, schrieb van de Velde an Dunant, »dafür zu sorgen, Ärzte aus Holland nach Düppel zu senden, aber auch das wollte er nicht. Dann bot ich Hilfe aus Genf an. Er lehnte rundweg ab. Ich unterbreitete ihm die Ideen, wie man bessere Tragen für die Verwundeten bauen könnte. ›Nein, nein‹, antwortete Rørbye, ›es ist jetzt nicht die Zeit, um sich mit solchen Neuerungen zu befassen.‹ … Unglaublich, dass solch ein alter ruhmsüchtiger Mann an die Spitze einer so großen Unternehmung gestellt wird.«
Weitaus mehr Glück, sich für die Ideen des Roten Kreuzes Gehör zu verschaffen, hatte der zweite Abgesandte, Louis Appia. Die preußische Führung stand der Idee einer neutralen, internationalen Organisation positiv gegenüber (König Wilhelm I. war begeistert, als Dunant ihn 1863 in Berlin besuchte). Appia konnte vor den Generälen bei Düppel sprechen, er wurde von Marschall Wrangel zum Abendessen eingeladen und er bekam die Erlaubnis, sich an der Front frei zu bewegen. Dass seine Anwesenheit so positiv aufgenommen wurde, lag unter anderem an den Fortschritten auf medizinischem Gebiet. Hier waren die Preußen sehr viel weiter als ihre dänischen Gegner. Die preußische Armee hatte einige der fachlich besten Ärzte der Zeit in ihrem Stab, darunter Friedrich von Esmarch, den Vater der modernen Kriegschirurgie, auf den zahlreiche Erfindungen zurückgehen: bessere Blutstillmechanismen, Chloroformmasken, Prothesen und gefederte leichte Wagen für die Verwundeten. Gleichzeitig wurden im Gegensatz zum dänischen Heer auf deutscher Seite weit mehr freiwillige Hilfsorganisationen an der Front zugelassen, unter anderem der Johanniterorden und Diakonissen von einigen religiösen Organisationen in Deutschland.
Insgesamt hatten die Deutschen somit die Möglichkeit, für höhere hygienische Standards zu sorgen. Der dänisch-deutsche Krieg wurde der erste Krieg, in dem eine der Parteien – die Preußen – mehr Menschenleben auf dem Schlachtfeld verlor als durch ansteckende Krankheiten.
Er war somit auch ein Meilenstein in der humanitären Geschichte der Menschheit.