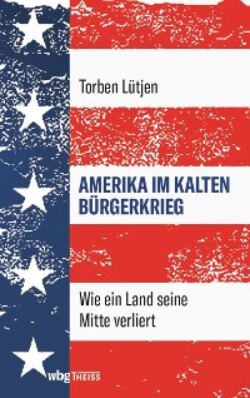Читать книгу Amerika im Kalten Bürgerkrieg - Torben Lütjen - Страница 10
Es war einmal … der amerikanische Konsens
ОглавлениеWie konnte das passieren? Und warum passierte es ausgerechnet in jenem Land, das nicht nur als eine der Wiegen der Demokratie gilt, sondern auch als Hort der Stabilität, der auch dann nie ins Wanken geriet, als Europas Demokratien während der Krisen der 1930er-Jahre in einer Welle des Autoritären umfielen wie die Dominosteine? Amerika war stets das Land, das gefeit schien vor ideologischem Überschuss, das eine moderate politische Kultur pflegte und dessen politische Eliten sich, anders als in Europa, nicht als Vollstrecker großer weltanschaulicher Projekte sahen, sondern als pragmatische Manager des Möglichen. Über viele Jahre schien es wenig Sinn zu ergeben, das politische Koordinatensystem Europas überhaupt auf die USA anzuwenden. Sozialistische Theoretiker von Engels bis Lenin verzweifelten an den Vereinigten Staaten. Hatte Marx nicht vorausgesagt, dass die Revolution in jenem Land stattfinden werde, das am weitesten industrialisiert sei? Warum aber gab es dann in den USA keine starke sozialistische Bewegung? Doch auch ein wirklich reaktionärer Konservativismus hatte in den USA – zumindest jenseits des konservativen Südens – lange keine Heimat. Und selbst in den dunkelsten Jahren der Großen Depression der 1930er-Jahre hielten sich die USA vom Faschismus fern: Amerika blieb das Land von Kapitalismus und liberaler Demokratie. Natürlich kursierte auch in den Vereinigten Staaten theoretisch die ganze Bandbreite ideologischer Entwürfe, vom Ku-Klux-Klan bis zur Kommunistischen Partei. Doch in die Mitte der Gesellschaft stießen solche Konzepte einer radikal anderen Gesellschaft niemals vor. Das heißt nicht, dass es nicht zahlreiche antiliberale Stränge in dieser vermeintlich so liberalen Gesellschaft gegeben hätte, wie vor allem der allgegenwärtige Rassismus nicht nur, aber besonders im Süden der USA deutlich macht.7 Aber auch das schwamm inmitten eines politischen Mainstreams, hatte sich nicht abgesetzt in national organisierten Bewegungen und Parteien, wurde im Übrigen auch nicht offensiv artikuliert, da selbst die Verteidiger der Sklaverei noch glaubten, ihre Werte stünden ganz im Einklang mit dem amerikanischen Gründungsversprechen und der Verfassung. Das war nun gewiss ebenso verlogen wie zynisch, wenn man sich an die Worte der Unabhängig-keitserklärung erinnert: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal“ – aber für die Natur des ideologischen Wettbewerbes spielte es dennoch eine Rolle.
Auch alle nachfolgenden amerikanischen Protestbewegungen, von den Populists des 19. Jahrhunderts – einer größtenteils agrarischen Bewegung des ländlichen Amerikas, die gegen die großen Monopole agitierte – bis hin zum von Martin Luther King Jr. angeführten Civil Rights Movement der 1950er-/60er-Jahre, sprachen nicht vom Bruch mit dem American Creed – einem durchaus diffusen und nicht widerspruchsfreien Amalgam von Werten wie Gleichheit, Freiheit, Individualismus und protestantischer Wirtschaftsethik –, sondern stellten sich in dessen Tradition. Sie alle zielten auf Anerkennung und Teilhabe, und damit immer auch auf ein Stück vom Kuchen des Amerikanischen Traums.8 Selbst in der größten Krise des Kapitalismus – während der Großen Depression in den 1930er-Jahren – warb etwa die Kommunistische Partei der USA damit, dass Kommunismus nichts anderes sei als ein spezifischer „20th Century Americanism“.9 Manche bezeichneten die USA als ideologiefreie Gesellschaft; besser aber trifft die Sache wohl ein berühmter Satz des amerikanischen Historikers Richard Hofstadter: „[I]t had been our fate as a nation not to have ideologies but to be one.“10 Amerika war selbst eine Ideologie. In der Tat war erstaunlich, wie weit diese amerikanische Integrationsideologie reichte, dass trotz zahlreicher Friktionen in der amerikanischen Gesellschaft in den Villengegenden Neuenglands und Kaliforniens ebenso an sie geglaubt wurde wie in den Gettos der New Yorker Bronx oder Süd-Chicagos.
Nach 1945 wurden die USA dann zum ultimativen Vorbild ideologisch abgerüsteter Gesellschaften. In den 1950er-Jahren stand mit dem Kriegshelden Dwight D. Eisenhower gar ein Mann an der Spitze des Staates, der sich lange mit der Entscheidung schwergetan hatte, für welche der beiden Parteien er denn nun als Präsidentschaftskandidat antreten sollte – angetragen worden war ihm die Nominierung schließlich von Demokraten und Republikanern gleichermaßen, und sehr wesentlich schienen ihm die programmatischen Unterschiede zwischen den Parteien nicht. Es war die Zeit, in der der Dachverband amerikanischer Politologen, die American Political Science Association, eine offizielle Stellungnahme abgab, in der markante Programmparteien und damit mehr Polarisierung gefordert wurden, denn das Einerlei von Demokraten und Republikanern lasse den demokratischen Wettbewerb verkümmern und den Bürgern keine echte Wahl. Ob die Herren (denn es waren damals nur Herren) wohl über den Zustand der amerikanischen Politik im Jahr 2020 erfreut wären?
Als daher in den 1960er-Jahren die Diskussionen um ein „Ende der Ideologien“ die Debatte in den westlichen Gesellschaften bestimmte, war völlig selbstverständlich, dass am Ende eines solchen Prozesses nur eine „moderne“ Gesellschaft wie die USA stehen könnte. Damals prägte sich jenes Bild von der amerikanischen Politik ein, das bis in die jüngere Vergangenheit in politikwissenschaftlichen Lehrbüchern zu finden war. Noch in den 1970er-Jahren konnte der amerikanische Politikwissenschaftler Robert Dahl, als Komparatist mit den Gegebenheiten in Europa fraglos gut vertraut, unwidersprochen behaupten: „[U]nlike parties in many European countries, both Republicans and Democrats in the United States advocate much the same ideology. […] To a European accustomed to the sound and fury of clashing ideologies, American party battles seem tame and uninteresting.“11 Es sind Sätze aus dem Museum amerikanischer Geschichte.
Also, noch einmal: Was ist bloß passiert, das die Sätze von Dahl heute so surreal erscheinen lässt? Die Antwort auf diese Frage weist weit über Amerika hinaus. Die USA durchlaufen schlichtweg schon seit Längerem einen Laborversuch in sozialer Desintegration, der inzwischen auch anderswo gestartet ist und dessen Ausgang ungewiss bleibt. Dieses Experiment, in dem wir alle die Laborratten sind, fördert ziemlich desillusionierende Ergebnisse zutage: Unsere modernen, freiheitlichen und durch und durch individualisierten Gesellschaften bringen offenkundig in einem beträchtlichen Maß das Gegenteil dessen hervor, was sie eigentlich hervorbringen sollten, nämlich: Engstirnigkeit, Abschottung und Dogmatismus statt Toleranz, Offenheit und Pluralismus. Amerikas Bürger haben die durch Individualisierungsrozesse ausgelösten Zugewinne an Autonomie, die nie dagewesene Freiheit, ein Leben nach eigener Wahl zu führen, vor allem dazu genutzt, ideologisch homogene Lebenswelten aufzubauen, wodurch sich Alltagserfahrungen und Informationswelten der Parteianhänger beider Seiten drastisch auseinanderentwickelt haben – ein Prozess, den ich als „paradoxe Individualisierung“ bezeichne. So stehen sich heute zwei politisch-kulturelle Lager gegenüber, die sich fremder kaum sein könnten und die die Welt mit völlig unterschiedlichen Augen sehen. Trumps angekündigte Mauer steht längst; aber sie befindet sich nicht an der Grenze zu Mexiko, sondern verläuft mitten durchs Land und durch die Köpfe seiner Bürger.
Doch wäre es falsch, den USA einfach nur eine allgemeine soziologische Diagnose überzustülpen. Damit man nicht in einen Determinismus hineinläuft, der nationale Unterschiede kurzerhand beiseiteschiebt, muss man anders beginnen, mit einer sehr viel konkreteren Geschichte. Amerikas tiefe Spaltung ist auch das Ergebnis spezifischer historischer Ereignisse und der Frage, wie die politischen Akteure darauf reagiert haben. Und daher sollte man zunächst wissen, wer hier streitet und worüber – und während manches den gleichzeitig in Europa auftretenden Konflikten ähnelt, bleibt anderes ganz spezifisch amerikanisch. Es gibt dabei durchaus so etwas wie eine historische „Sattelzeit“ der Polarisierung. Im Groben reicht diese Zeit von den frühen 1960er-bis zu den frühen 1980er-Jahren. In diesen zwei Dekaden zerfällt der innergesellschaftliche Konsens des Landes, und es schält sich jene Konfliktlage heraus, die auch heute noch – bei aller Ver schärfung der Auseinandersetzung und trotz Trumps Auftritt auf der Bühne – das Denken und Handeln der Akteure bestimmt. In diese Zeit wollen wir kurz eintauchen.