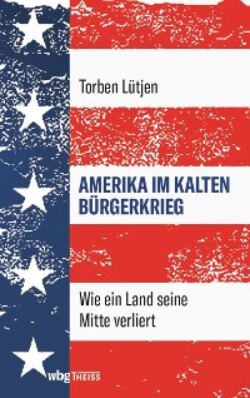Читать книгу Amerika im Kalten Bürgerkrieg - Torben Lütjen - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der amerikanische Konsens zerbricht,
Teil II: Die Politisierung der Religion
ОглавлениеWährend die ethnischen Konflikte der USA durch die Sklaverei und Rassentrennung ihre eigene Geschichte haben, kam es beinahe simultan zu einer gesellschaftlichen Eruption, die eher globaler Natur war und zunächst auf beiden Seiten des Atlantiks eine ähnliche Konfliktlinie zu etablieren schien. Die Rede ist natürlich von dem, was in Deutschland (und vielen anderen europäischen Ländern) unter der Chiffre „1968“ bekannt ist. Auch wenn das Jahr an sich in den USA eine etwas andere Rolle spielt und eher als gewalttätiger Schlussakt einer aufgewühlten Dekade gilt, ging es hier wie dort um die kulturellen Erschütterungen der 1960er- und 1970er-Jahre. Zunächst schienen sie sich an konkreten politischen Ereignissen festzumachen, vor allem am Krieg in Vietnam. Entscheidender aber war ein tiefgreifender Liberalisierungsschub, der traditionelle Moralvorstellungen, Hierarchien und Rollenbilder herausforderte. Ein Teil der amerikanischen Gesellschaft, zunächst vor allem das gebildete, städtische und junge Amerika, entdeckte neue Möglichkeiten der Lebensführung. Bei ihnen standen Werte wie Autorität, Disziplin und Respekt vor den Älteren nicht mehr besonders hoch im Kurs. Stattdessen ging es um Selbstentfaltung, Autonomie und ein selbstbestimmtes Leben. Insofern war Woodstock als Sinnbild des Aufbruchs gewiss nicht weniger wichtig als die großen Anti-Vietnamkriegsdemonstrationen der späten 1960er-Jahre; denn der zum Ende der 1960er-Jahre einsetzende Wertewandel schuf eine Konfliktlinie zwischen „Libertären“ und „Autoritären“, die die konkreten Streitfragen dieser Jahre überdauern sollte – und mit der Zeit immer stärker wurde.16
Die Babyboomer der Protestgeneration tendierten selbstverständlich zu den Demokraten, veränderten damit auch die Partei. Ohne Friktionen lief das nicht ab, was hier jedoch nicht in aller Breite dargelegt werden muss; aber der Konflikt zwischen „alter“ und „neuer Linker“, zwischen class politics und identity politics, spielte schon damals eine Rolle und führte dazu, dass viele Gewerkschafter nach den chaotischen Parteitagen 1968 und 1972 die Demokraten verließen. Anders als in den Mehrparteiensystemen in Europa, wo sich z. B. mit den Grünen eine genuine Repräsentantin der Neuen Sozialen Bewegungen als Partei herausbildete, mussten die Demokraten den Konflikt zwischen alter und neuer Linker innerhalb der eigenen Partei austragen.
Zu einer eindeutig linken Partei oder gar zur wirklichen Heimat der counter culture, der alternativen Gegenkultur, wurde die Partei dennoch lange nicht. Noch bis in die 1990er-Jahre hinein standen die Demokraten vermutlich bei vielen Fragen ideologisch näher bei den europäischen Mitte-rechts-Parteien als bei ihren eigentlichen Pendants, den Sozialdemokraten. Jedenfalls blieben sie relativ lange der alten Tradition der breiten amerikanischen Sammlungsparteien verpflichtet. Das war Stärke und Schwäche zugleich. Auf der einen Seite waren sie damit inklusiver als die Gegenseite, verfügten über die breitere und größere potenzielle Wählerkoalition. Andererseits fehlte ihnen oft eine klare Identität – was sie allerdings mit den Mitte-links-Parteien in anderen Ländern teilten, deren lange Agonie in den 1970er-Jahren begann.
Bei den Republikanern sah das anders aus: Sie wurden sehr viel schneller zur echten Weltanschauungspartei. Die entscheidende Abweichung von den europäischen Verhältnissen ereignete sich in den USA daher auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Zunächst schienen die Entwicklungen sich im Nachgang von „1968“ zu ähneln, denn hier wie dort kam es zu einem Backlash gegen die Liberalisie-rungstendenzen dieser Jahre und damit zum Wiedererstarken von konservativen Positionen, die zuvor schon ziemlich entkräftet gewirkt hatten, sich unter dem Gefühl der Erosion überkommener Werte nun aber schroff gegen den Zeitgeist wandten. Überall im „Westen“ revitalisierte sich das wertkonservative Lager, erhielt Zulauf aus einer verunsicherten Mittelschicht und auch aus der Arbeiterklasse. In Richard Nixon, der 1969 in das Weiße Haus einzog – was bereits den Zeitgenossen als Fanal einer konservativen Zeitenwende galt –, und seinem Begriff der silent majority verdichtete sich wohl am besten das Gefühl der kulturellen Belagerung durch einen feindlichen Zeitgeist, gepaart natürlich mit der Überzeugung, noch immer die wahre Mitte des Landes zu verkörpern.
Doch da enden die Gemeinsamkeiten. Langfristig nämlich sollte der Backlash in den USA eine ungleich größere Wucht entfalten. In Westdeutschland etwa konnte aus Helmut Kohls „geistig-moralischer Wende“ eineinhalb Jahrzehnte nach „1968“ nicht viel werden, weil es in Wahrheit keinen tragfähigen konservativen Gegenentwurf zu den Emanzipations- und Individualisierungsschüben jener Jahre gab, auch in der CDU nur sehr wenige mit dem liberalen Zeitgeist wirklich schwer haderten, während die meisten Christdemokraten sich mit einer weniger traditionsgeleiteten und hedonistisch-liberaleren Gesellschaft ziemlich formidabel arrangiert hatten. So verhielt es sich in der Mehrzahl der europäischen Demokratien, und weder als politische Idee noch als Organisation hat der klassische Konservativismus seitdem wieder zu alter Größe gefunden – auch heute nicht, da er neben nationalem und völkischem Denken eher auf dem Beifahrersitz der Neuen Rechten Platz genommen hat.
In den USA aber war das in der Tat anders, und die divergierenden Entwicklungspfade lagen primär in Amerikas tiefer Religiosität begründet, die sich seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts markant vom europäischen Kurs unterschied. Dabei hatten Religions-soziologen lange geglaubt, dass der Niedergang organisierter Religiosität das unvermeidliche Schicksal aller modernen Gesellschaften sei. Heute wissen wir, dass die Säkularisierungsthese in dieser Form nur auf einen geografisch sehr begrenzten Raum zutraf: West- und Mitteleuropa. Die USA hingegen erlebten im selben Zeitraum eine anders gelagerte, sehr spezifische religiöse Transformation. Die eher liberalen protestantischen Kirchen verloren tatsächlich rapide an Mitgliedern. Gleich zeitig aber wuchsen die evangelikalen konservativen Freikirchen rasant an. Damit nahmen die USA im Bereich des Religiösen etwas vorweg, was sich später auf dem Feld der politischen Einstellungen wiederholen sollte: Die Mitte erodierte, die Flügel expandierten. Für einen aggressiven Kurs gegen die liberale Moderne und für die Verteidigung einer traditionellen Sozialmoral standen dem amerikanischen Konservativismus daher fortan völlig andere Ressourcen zur Verfügung: Millionen streng konservativer Christen, die gegen Abtreibung, Pornografie und Homosexualität kämpften. Vor allem die liberalen Entscheidungen des Supreme Courts in jenen Jahren – allen voran der Fall Roe vs. Wade, in dem die Richter urteilten, dass einzelne Bundesstaaten nicht das Recht auf Abtreibung außer Kraft setzen dürfen – mobilisierte sie. Spätestens mit Ronald Reagans Wahlsieg 1980 waren die Republikaner eindeutig zur Partei der Verteidigung der christlichen Sozialmoral gegen moralischen Verfall, Nihilismus und Atheismus geworden.17
Vor allem die 1990er-Jahre – vielleicht nicht zufällig eine Dekade wirtschaftlicher Prosperität, in der soziale Probleme ein wenig in den Hintergrund traten – wurden dann das Jahrzehnt der sogenannten culture wars. Besonders populär gemacht hatte den Begriff der Soziologe James Davison Hunter. Er sah die vielen aufbrechenden Kontroversen im Land – über Homosexualität und Abtreibung oder die Frage, ob die Evolutionstheorie in den Schulen gelehrt werden sollte – als Symptome einer nun dominanten Spaltungslinie zwischen „Progressiven“ und „Orthodoxen“. Das progressive Amerika glaubte an die Emanzipation von überkommenen Werten, an gesellschaftlichen Fortschritt und an die grundsätzliche Relativierbarkeit von moralischen Grundsätzen. Das orthodoxe Amerika aber hielt fest am Glauben an eine transzendente Autorität, an überlieferten Werten und Normen, teilte die Welt auch weiter ganz binär in Gut und Böse ein. Es war – anders als in der Vergangenheit, als die Antipathien zwischen Protestanten und Katholiken das politische und soziale Leben bestimmt hatten – nicht mehr der Konflikt zwischen den Konfessionen, der jetzt bestimmend war. Vielmehr hatten sich konservative Katholiken, Protestanten und Juden zusammengeschlossen in ihrem Widerstand gegen die liberale Moderne.18
Wie stark diese Verbindung zwischen den Republikanern und Amerikas konservativen Christen war, zeigte sich vor allem 2016, als ein Mann die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten errang, von dem jedermann wusste, dass er mit alldem nichts am Hut hatte. Donald Trump war ein mehrfach geschiedener Playboy und chronischer Schürzenjäger aus Manhattan, Kasinobetreiber, Ausrichter von Schönheitswettbewerben und bis dahin, vorsichtig ausgedrückt, nicht unbedingt durch religiösen Eifer aufgefallen. Auf einer Veranstaltung der religiösen Rechten im Herbst 2015 bezeichnete Trump die Bibel als sein „Lieblingsbuch“ (an zweiter Stelle nannte er dann sein eigenes Werk, „The Art of the Deal“). Auf Nachfrage konnte er seine „Lieblingsstelle“ in der Heiligen Schrift dann allerdings nicht benennen. Sein Glaube sei sehr privat, darüber rede er öffentlich nicht so gern, sagte jener Kandidat, der sonst über alles redet.
Nun kann man nicht behaupten, dass Trump von Beginn an der favorisierte Kandidat der religiösen Rechten gewesen wäre. Und einige konservative Christen kritisierten ihn und das, wofür er stand, auch mit deutlichen Worten. Nachdem Trump die Nominierung errungen hatte, machten sie jedoch rasch ihren Frieden mit ihm. Denn er versprach, konservative Richter an den Supreme Court zu berufen und auch sonst die Anliegen der religiösen Rechten zu unterstützen. Das genügte einem Milieu, das seit Langem eine ziemlich verzweifelte Abwehrschlacht gegen die Moderne schlägt und sich marginalisiert fühlt, es sich daher kaum leisten kann, bei seinen Bündnispartnern besonders wählerisch zu sein. Seit Trumps Wahl hat man dort alle möglichen theologischen Turnübungen versucht, um den eigenen Einsatz für ihn zu rechtfertigen. Hat Gott sein Werk nicht oft durch Menschen vollbringen lassen, die nicht gerade ein gottgefälliges Leben geführt haben? Einige halten es mit dem persischen König Kyros II., der nach biblischer Überlieferung im 6. Jahrhundert v. Chr. den Auszug der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft und ihre Rückkehr ins gelobte Land ermöglichte. Denn Kyros war ebenso wie Trump kein Mann des rechten Glaubens, wurde aber dennoch von Gott als Werkzeug auserkoren, dem auserwählten Volk zu helfen. Es ist in dieser Lesart gerade die Eigenschaft als Sünder, die zu Höherem qualifiziert – eine höchste Form der Dialektik, die nur den wahrhaft Gläubigen unter den Christen oder Marxisten vergönnt ist. Die Wahrheit ist ja ohnehin einfacher und zugleich deprimierender: Die politische Polarisierung ist mittlerweile so übermächtig geworden, dass sie selbst die Religion verschluckt und zum Appendix der persönlichen Identität gemacht hat. Man ist zuerst ein konservativer Republikaner – und dann erst Christ.