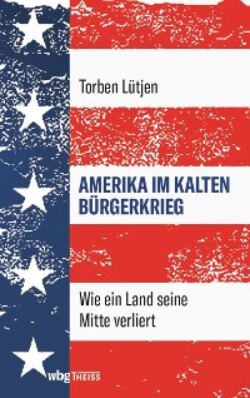Читать книгу Amerika im Kalten Bürgerkrieg - Torben Lütjen - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der amerikanische Konsens zerbricht, Teil III:
Eine Bewegung gegen den Staat
ОглавлениеMit race und Religion waren somit zwei der fortan prägenden Konfliktlinien etabliert. Sie prägten das Wahlverhalten, motivierten die Parteiaktivisten beider Seiten, strukturierten den politischen Diskurs. Die Demokraten waren die liberalere, säkularere und ethnisch diversere Partei, die Republikaner weißer, religiöser, konservativer.
Und für alles, was dann folgte, muss man natürlich verstehen, welcher Wählerkoalition potenziell die Zukunft gehörte. Das Land wurde nämlich stetig diverser, was vor allem an der konstanten Zuwanderung aus Mittel- und Lateinamerika liegt. Hatten 1980 noch 15 Millionen Hispanics in den USA gelebt, waren es 2016 – dem Jahr, das Trump an die Macht brachte – 58 Millionen.19 Schätzungen zufolge werden weiße, nicht-hispanische Amerikaner irgendwann zwischen 2041 und 2046 zur majority-minority, zur größten Minderheit, werden und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wird unter fünfzig Prozent sinken. Zudem hat sogar Amerikas oft beschworene tiefe Religiosität zu bröckeln begonnen. Während die USA bis in die 1980er-Jahre hinein noch völlig immun gegen die Säkularisierungstendenzen erschienen, die sich in anderen westlichen Gesellschaften zeigten, änderte sich das ab den 1990er-Jahren: Nun wuchs auch hier die Zahl derjenigen, die sich als nicht-religiös bezeichneten. Wenn ein Viertel der US-Bürger heute angibt, keiner Kirchen gemeinde anzugehören, mag das noch nicht dramatisch klingen – es sei denn, man weiß, dass dieses eine Verdrei fachung im Vergleich zu den frühen 1990er-Jahren ist.
Zunehmend entbrannte auch ein Konflikt zwischen den liberalen urbanen Zentren Amerikas und dem ländlichen Hinterland, die sich inzwischen politisch weit auseinanderentwickelt haben. Die Städte wurden ethnisch diverser, säkularer, liberaler und entfernten sich damit immer stärker vom ländlichen, christlichen und weißen Amerika. Bei der Präsi den tschaftswahl 2016 gewann Trump über 2600 von ca. 3100 Counties (ungefähr vergleichbar mit deutschen Landkreisen). Hillary Clinton, die landesweit bekanntlich drei Millionen Stimmen mehr erhielt als Donald Trump, gewann lediglich knapp 500 Counties – aber unter ihnen fast alle großen Metro polregionen des Landes. Und während sie noch in den 1980er-Jahren als Ausbund von Kriminalität und Verfall gegolten hatten, erlebten viele Städte seit den 2000er-Jahren einen rasanten ökonomischen Aufschwung – das ländliche Amerika hingegen fiel immer mehr zurück. Die einstigen Sorgenkinder der Nation avancierten damit, ungeachtet aller fortdauernden sozialen Probleme, insgesamt zu den Gewinnern der rasanten Strukturveränderung der US-amerikanischen Ökonomie, profitierten alles in allem vom Zuwachs des Dienstleistungssektors und fingen damit die Folgen der De-Industrialisierung ab. Die Städte profitierten von der Globalisierung; das ländliche Amerika aber litt.
Viele der extremen Reaktionen auf der politischen Rechten, die Bereitschaft, die Grenzen sowohl der Verfassung als auch eines zivilen politischen Diskurses zu testen, hängen mit genau dieser Wahrnehmung zusammen: Man ist dort überzeugt, dass die Zeit unerbittlich gegen einen läuft, weshalb der Zweck der kulturellen Selbstbehauptung auch grenzwertige Mittel rechtfertigt. Es ist ein aggressiver Verteidigungskampf, bei dem es aus Sicht des weißen, christlichen und konservativen Amerikas schlicht ums Ganze geht, und viele glauben, dass Trump die letzte Rückzugslinie ist, die nicht aufgegeben werden darf.
Schließlich fehlt noch eine dritte Konfliktlinie: jene zwischen mehr oder weniger staatlicher Einmischung in Wirtschaft und Gesellschaft, also jener Aspekt der politischen Auseinandersetzung, den wir am einfachsten in ein Links-rechts-Koordinatensystem übertragen können. Mehr Staat oder mehr Markt? Das dürfte in der Tat die Schlüsselfrage des 19. und 20. Jahrhunderts gewesen sein.
Tatsächlich aber ist die Sache hier am kompliziertesten. Auf der einen Seite ist richtig, dass Mitte der 1960er-Jahre auch auf diesem Feld der Konsens zu bröckeln begann. Bis dahin nämlich – und etwa seit der Zeit des New Deal Franklin D. Roosevelts – teilten Republikaner und Demokraten grundsätzlich die Auffassung eines aktiven Staates. Die Kombination aus keynesianisch inspirierter Konjunkturpolitik und Wohlfahrtsstaat, selbstverständlich unter den Bedingungen einer freien Marktwirtschaft (denn Sozialismus hatte in den USA bis vor Kurzem keine Chance), schien weitgehend unbestritten, galt als Quintessenz jenes technokratisch inspirierten Denkens vom „Ende der Ideologien“, von dem bereits die Rede war. Die Republikaner waren zwar weitaus skeptischer, was z.B. den Ausbau des amerikanischen Sozialstaates anging, von dem Mitte der 1960er-Jahre viele Progressive hofften und glaubten, er könnte europäisches Niveau erreichen. Aber ideologisch waren sie zu eindeutig in der Defensive. 1964 nominierte die Partei zwar den radikal-libertären Senator Barry Goldwater zum Präsidentschaftskandidaten, der in seinem Hass auf Washington im Besonderen und den Staat im Allgemeinen vieles von dem vorwegnahm, was später die Tea Party auszeichnen sollte. Doch Goldwater verlor, und damit schien diese Art von Marktradikalismus endgültig an ihr Ende gekommen.20
In Wahrheit aber war das erst der Anfang: Langfristig sollten sich Goldwaters Vorstellungen von einem Minimalstaat in der Partei durchsetzen. Als Ronald Reagan 1980 zum Präsidenten gewählt wurde, da war dies, zusammen mit der Wahl Margaret Thatchers in Großbritannien ein Jahr zuvor, Zeichen einer globalen Tendenzwende in der Wirtschaftspolitik, die wir in der Regel als Durchbruch des „Neoliberalismus“ bezeichnen: die Vorstellung, dass man den Kräften des Marktes so weit wie möglich vertrauen sollte, um Wohlstand für alle zu schaffen. Allerdings war der Marktradikalismus des amerikanischen Konservativismus noch einmal von einem ganz anderen Kaliber. In Europa funktionierte der Neoliberalismus vor allem als vermeintlicher Sachzwang: Man war gezwungen, die Märkte zu deregulieren, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu verbessern und Sozialstandards zu senken, weil es aufgrund von globalen Entwicklungen, für die niemand persönlich verantwortlich zu machen war, Alternativen eben nicht gab. Keine der Mitte-links-Regierungen im Europa der 1990er-Jahre, als dieses Denken parteiübergreifend endgültig die Politik bestimmte – von Tony Blairs Labour Party bis zu Gerhard Schröders SPD –, fand daher für ihre Reformen eine eigene Sprache, sondern blieb im Duktus technokratischer Alternativlosigkeit stecken. Selbst Europas härteste neoliberale Reformerin, die Konservative Margaret Thatcher, sprach von „There Is No Alternative“ (berühmt geworden unter dem Kürzel TINA) und schwor ihre Landsleute in churchillesker Pose mit Blut-Schweiß-und-Tränen-Reden auf die harte Rosskur ein.
In den USA aber war das anders. Hier brauchte der Neoliberalismus die Logik des Sachzwangs nicht, weil er mit ganz anderen und machtvolleren Mythen verheiratet werden konnte: dem rugged individualism, dem „rauen Individualismus“, der sich der Geschichte Amerikas als Siedlernation verdankte, in der die Pioniere entlang der sogenannten frontier – der stetig nach Westen verschobenen Besiedlungsgrenze – allein gegen die Wildnis standen und der Staat sowie Washington weit weg waren. Amerikaner, so ging diese Erzählung, nahmen die Dinge selbst in die Hand; und sie lebten in einem Land, in dem es jeder, der hart arbeitete, bis ganz nach oben schaffen konnte, sofern er nicht staatlicherseits daran gehindert wurde. „Government is not the solution to our problem. Government is the problem“, wie es Ronald Reagan, der große Held der konservativen Bewegung, formulierte.
Allerdings geht es ja hier um Polarisierung und nicht um das, was man als die Radikalisierung eines einzelnen Lagers beschreiben könnte. Und polarisierend war diese Anschauung von Wirtschaft und Sozialpolitik eigentlich nicht – da ihre grundsätzlichen Prämissen bald schon weithin geteilt wurden. In den 1980er-Jahren hatten sich neoliberale Prinzipien so weit ausgebreitet, dass man von einer ideologischen Hegemonie sprechen musste. Der Glaube an die Segnungen freier Märkte, an individuelle Eigeninitiative und die jederzeitige Möglichkeit des sozialen Aufstiegs (was wir also gemeinhin als den Amerikanischen Traum bezeichnen) hatte sich schließlich in beiden Parteien durchgesetzt – hierüber herrschte eher Konsens denn Konflikt. Am Ende war es ausgerechnet der Demokrat Bill Clinton, der als Präsident in den 1990er-Jahren die letzten Herzensanliegen des neoliberalen Projekts final durchsetzte, darunter vor allem jene Deregulierung der Finanzmärkte, die mitverantwortlich war für die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008. Als Clinton bei seiner „State of the Union“-Rede 1996 verkündete: „The era of big Government is over“, da schienen die Unterschiede zum politischen Kontrahenten auf diesem Feld weitgehend eingeebnet. Erst nach der Wirtschaftskrise von 2008, und noch einmal beschleunigt mit Trumps Amtsantritt, fand eine kapitalismuskritische Linke wieder Gehör innerhalb der Demokratischen Partei; aber das ist erst die allerjüngste Gegenwart, von der später, genauer: in Kapitel 4, noch die Rede sein soll.
Damals wie heute gilt aber, dass das Wahlverhalten in den USA kaum von der sozialen Klasse bestimmt wird. Es sei denn, man ginge von einer kompletten Umkehrung unserer Vorstellung von Klassenverhalten aus und erklärte die 67 Prozent weißen Wähler aus der Arbeiterklasse, die 2016 für Trump und nicht für Hillary Clinton gestimmt haben, zum Beweis eines homogenen Klassenbewusstseins – was aber nicht besonders viel Sinn ergäbe, da die Betonung hier auf „weiß“, nicht so sehr auf „Arbeiterklasse“ liegt, denn bei nicht-weißen Amerikanern aus demselben sozialen Segment schnitt Trump eher bescheiden ab.21
Der radikale Anti-Etatismus der Republikaner war dennoch von Bedeutung für die Polarisierung des Landes. Allerdings nicht so sehr, weil er für hitzige Kontroversen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik gesorgt hätte – denn diese gab es lange nicht. Entscheidender war, dass diese Ideologie den Republikanern half, eine Wählerkoalition zusammenzuhalten, die sonst nicht zusammengefunden hätte. Überraschend war nicht, dass wohlhabende Amerikaner aus den Suburbs – den riesigen und zersiedelten Vorstädten, oft viele Meilen entfernt vom Stadtzentrum – sich für eine Politik begeistern konnten, die vor allem von Steuersenkungen sprach, denn für sie passte die Interessenlage zur Ideologie.
Paradoxer und ungleich interessanter ist, welche noch ganz anderen Wählermilieus mit der Losung von „weniger Staat“ angesprochen werden konnten. Es war die Formel, die eine ansonsten hoffnungslos heterogene Koalition zusammenschweißte, da sie alle auf denselben Gegner einschwor. Vor allem in den ländlichen Regionen des Landes hatte die konservative Waffenlobby, insbesondere die heute mehrere Millionen Mitglieder zählende National Rifle Association (NRA), geschickt die Angst vor einer vermeintlich übermächtigen und übergriffigen Washingtoner Zentralregierung geschürt, die in ihrem Drang nach Kontrolle den unbescholtenen Amerikanern das Recht auf Selbstverteidigung und damit die Waffen wegnehmen wolle. War nicht auch für sie der Staat der Feind, den es zu bekämpfen galt? Das Wort government bedeutet ja sowohl „Regierung“ als auch „Staat“, und allein dieser so banale Umstand half vielleicht dabei, eine anti-government coalition aus libertären, wohlhabenden Bürgern und waffenvernarrten Milizionären zu flechten.
Aber auch der amerikanische Süden, lange Zeit das Armenhaus der Nation, war traditionell nicht unbedingt für eine libertäre Politik des small government, des „schlanken Staats“, gewesen – immerhin hatte man dort ganz besonders von den Sozial- und Infrastruktur projekten des New Deal während der Großen Depression der 1930er-Jahre profitiert. Aber seitdem die Bundesregierung in Washington aufgrund des „Civil Rights Act“ als fremde Interventionsmacht wahrgenommen wurde, verfing auch im Süden die Botschaft, dass es gegen den Staat ins Feld zu ziehen gelte; und so wurden konservative Wähler auch dort empfänglicher für Anti-Government-Botschaften.
Am Ende dieses Prozesses, der sich von Mitte der 1960er-bis in die 1980er-Jahre hinzog, hatten sich die ehedem in sich ideologisch extrem heterogenen amerikanischen Parteien entlang dieser drei gesellschaftlichen Konfliktlinien homogenisiert. Nun gab es eine Partei, die eindeutig liberaler, urbaner, säkularer, ethnisch diverser war und die sich für mehr Staat einsetzte; und es gab eine andere Partei, die konservativer und religiöser war, die den Staat weiter zurückdrängen wollte und immer stärker das weiße und ländliche Amerika repräsentierte.