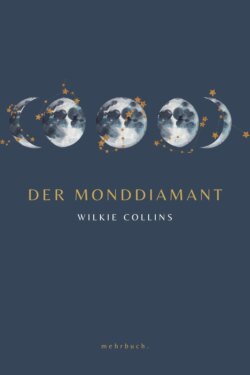Читать книгу Der Monddiamant - Уилки Коллинз, Elizabeth Cleghorn - Страница 17
Elftes Kapitel.
ОглавлениеAls die letzten Gäste weggefahren waren, ging ich wieder in die Halle, wo Samuel an dem Seitentisch mit Cognac und Sodawasser stand. Mylady und Fräulein Rachel traten eben, von beiden Herren gefolgt, aus dem Salon. Herr Godfrey nahm etwas von jenen Getränken, Herr Franklin aber nahm nichts zu sich. Er sah sehr abgespannt aus und setzte sich nieder: die Unterhaltung an diesem Geburtstag war ihm, wie mir schien, zu viel geworden.
Mylady warf, indem sie den Herren gute Nacht sagte, noch einen scharfen Blick aus das Vermächtniß des bösen Obersten, das an der Brust ihrer Tochter glänzte. »Rachel,« fragte sie, »wo willst Du Deinen Diamanten heute Nacht hinlegen?«
Das Fräulein war in sehr ausgelassener Stimmung, so recht aufgelegt, dummes Zeug zu reden, wie es junge Mädchen am Ende eines aufregenden Tages wohl zu sein pflegen. Zuerst erklärte sie, sie wisse nicht, wohin sie den Diamanten legen solle. Dann sagte sie, natürlich auf ihren Toilette-Tisch mit ihren anderen Sachen. Dann erinnerte sie sich wieder, daß der Diamant sie mit seinem mondlichtartigen Scheine inkommodieren und während des Dunkels der Nacht erschrecken konnte. Dann wieder fiel ihr ein indisches Schränkchen ein, das in ihrem Wohnzimmer stand, und sie beschloß sofort, den indischen Diamanten in das indische Schränkchen zu legen, damit die zwei schönen Produkte desselben Landes sich einander Gesellschaft leisten könnten. Nachdem sie ihrem Gelüste, dummes Zeug zu schwatzen, soweit freien Lauf gelassen hatte, trat ihre Mutter dazwischen und machte der Sache ein Ende.
»Liebes Kind, Dein indisches Schränkchen hat ja gar kein Schloß,« sagte die Mutter.
»Guter Gott!« rief Fräulein Rachel »Sind wir hier in einem Hotel? Oder sind hier Diebe im Hause?«
Ohne von diesen Worten Notiz zu nehmen, wünschte Mylady den Herren gute Nacht, wandte sich dann zu Fräulein Rachel, küßte sie und fragte: »Soll ich nicht lieber den Diamanten diese Nacht zu mir nehmen?«
Fräulein Rachel war über diesen Vorschlag so entrüstet, wie sie vor zehn Jahren über die Zumuthung gewesen sein würde, sich von ihrer Lieblingspuppe zu trennen. Mylady sah, daß diesen Abend nicht vernünftig mit ihr zu reden sei.
»Rachel, komme morgen früh, so bald Du aufgestanden bist, zu mir in mein Zimmer! Ich habe Dir etwas zu sagen.«
Mit diesen Worten verließ sie uns langsam, ihren eigenen Gedanken nachhängend, die allem Anschein nach nicht sehr beruhigender Natur waren.
Nach ihr sagte auch Fräulein Rachel den Herren gute Nacht.
Sie gab zuerst Herrn Godfrey, der am anderen Ende der Halle stand und sich ein Bild ansah, die Hand, und wandte sich dann zu Herrn Franklin, der noch immer ermüdet und schweigsam in seiner Ecke saß.
Was sie mit einander redeten kann ich nicht sagen. Da ich aber ganz in der Nähe des alten großen Spiegels mit seinem Rahmen von schwerem Eichenholz stand, sah ich in demselben, wie sie das Medaillon, das ihr Herr Franklin geschenkt hatte, verstohlen aus ihrem Busen zog und es ihm, bevor sie die Halle verließ, mit einem sehr ausdrucksvollen Lächeln zeigte.
Dieser Vorfall machte mich in dem Vertrauen auf mein eigenes Urtheil etwas wankend. Ich fing an zu glauben, daß Penelope am Ende doch in Betreff der Neigung ihrer Herrin Recht haben könnte. Sobald Herr Franklin wieder für etwas Anderes in der Welt Augen hatte, wurde er meiner ansichtig. Sein wankelmüthiges Temperament, das ihn seine Ansichten über alle Dinge fortwährend wechseln ließ, hatte ihn auch in Betreff der Indier schon wieder zu einer neuen Ansicht gelangen lassen.
»Betteredge,« sagte er, »ich glaube fast, daß ich es mit dem, was Herr Murthwaite bei unserer Unterhaltung unter den Büschen gesagt hat, zu ernst genommen habe; ich bin versucht zu glauben, daß er sich mit einer Jagdgeschichte über uns lustig gemacht hat. Wollen Sie wirklich die Hunde loslassen?«
»Ich will ihnen ihr Halsband abnehmen, Herr Franklin,« antwortete ich, »und es ihnen möglich machen, sich während der Nacht frei zu bewegen, wenn sie in ihrer Nase eine Aufforderung dazu finden sollten.«
»Gut,« sagte Herr,Franklin, »wir wollen morgen weiter sehen. Betteredge; ich habe durchaus keine Lust, meine Tante ohne sehr dringende Gründe zu beunruhigen. Schlafen Sie wohl!«
Er sah so erschöpft und blaß aus, als er mir gute Nacht sagte und sein Licht ergriff, um in sein Zimmer zu gehen, daß ich ihm riet, ein wenig Cognac und Wasser als Schlaftrunk zu nehmen.
Herr Godfrey, der vom andern Ende der Halle her auf uns zutrat, unterstützte diesen Vorschlag und drang in der freundschaftlichsten Weise in Herrn Franklin, vor dem Schlafengehen noch Etwas zu sich zu nehmen.
Ich thue dieser geringfügigen Umstände nur deshalb Erwähnung, weil es mir nach Allem, was ich an diesem Tage gesehen und gehört hatte, Vergnügen machte zu beobachten, daß unsere beiden Herren noch auf ebenso gutem Fuße standen wie vorher. Weder ihr Wortkampf, den Penelope im Salon mit angehört hatte, noch ihre Rivalität in der Bewerbung um Miß Rachels Neigung schien ihr gutes Verhältnis beeinträchtigt zu haben. Beide hatten ein glückliches Temperament und Beide waren Männer von Welt. Und das ist ein entschiedener Vorzug der Gebildeten, daß sie bei Weitem nicht so zanksüchtig sind wie Ungebildete.
Herr Franklin dankte für Cognac und Wasser und ging mit Herrn Godfrey hinaus, Beide in ihre neben einander liegenden Zimmer. Kaum oben angelangt, wurde aber Herr Franklin schon wieder, wie gewöhnlich, anderen Sinnes.
»Vielleicht brauche ich es doch während der Nacht.« rief er mir hinunter: »Schicken Sie mir etwas Cognac herauf!«
Ich schickte Samuel mit Cognac und Wasser hinauf, ging dann in den Hof und nahm den Hunden ihre Halsbänder ab. Beide schienen höchst erstaunt, sich zu so später Nachtstunde losgemacht zu sehen und sprangen wie ein paar junge Hunde auf mich los; der Regen aber kühlte sie bald wieder ab. Beide tranken ein wenig Wasser und krochen dann wieder in ihr Hundehaus zurück. Als ich wieder in’s Haus trat, bemerkte ich am Himmel Zeichen, welche eine Wendung des Wetters zum Bessern andeuteten. Augenblicklich regnete es noch heftig und der Boden war völlig aufgeweicht. Samuel und ich gingen durch’s ganze Haus und schlossen alle Thüren wie gewöhnlich. Ich untersuchte Alles selbst und überließ meinem Adjutanten bei dieser Gelegenheit nichts. Alles war sicher und wohl verwahrt, als ich zwischen Mitternacht und ein Uhr Morgens meine alten Glieder zur Ruhe brachte.
Die Anstrengungen des Tages waren, glaube ich, ein wenig zu viel für mich gewesen; wenigstens hatte ich diese Nacht einen Anfall von Herrn Franklin’s Krankheit. Erst bei Sonnenaufgang schlief ich endlich ein. Bis dahin aber hatte Grabesstille im Hause geherrscht. Kein Laut war vernehmbar, als das Fallen des Regens und das Rauschen des Windes in den Zweigen.
Ungefähr um halb acht Uhr erwachte ich und öffnete mein Fenster, um in einen schönen, sonnigen Morgen zu blicken. Die Uhr hatte acht geschlagen, und ich war eben hinausgetreten, um die Hunde wieder anzuketten, als ich plötzlich das Rauschen eines Frauenkleides aus der Treppe hinter mir vernahm. Ich drehte mich um und sah Penelope wie von Sinnen auf mich losstürzen »Vater!« schrie sie, »um Gottes willen! komm heraus, der Diamant ist fort!«
»Bist Du von Sinnen?« fragte ich.
»Fort!« sagte sie, »fort! Kein Mensch weiß, wie. Komm selbst hinauf und sieh!«
Sie schleppte mich hinter sich her in das Wohnzimmer unseres Fräuleins, das an ihr Schlafcabinet stieß. Da stand Fräulein Rachel an der Schwelle ihres Schlafzimmers, fast so weiß im Gesicht wie das weiße Morgengewand, das sie trug. Da stand auch das indische Schränkchen offen da, eines der Schuhfächer desselben war weit aufgezogen.
»Da sieh!« sagte Penelope, »ich habe selbst gestern Abend gesehen, wie Fräulein Rachel ihren Diamanten hineinlegte.« Ich trat an das Schränkchen. Das Schubfach war leer.
»Ist das wahr, Fräulein?« sagte ich.
Mit einem Blick und einer Stimme, die nicht ihr anzugehören schienen, antwortete Fräulein Rachel, wie meine Tochter geantwortet hatte:
»Der Diamant ist fort.«
Mit diesen Worten zog sie sich in ihr Schlafzimmer zurück und verschloß dasselbe hinter sich.
Bevor wir noch hatten überlegen können, was zu thun sei, trat Mylady ein, die meine Stimme in dem Wohnzimmer ihrer Tochter vernommen hatte und begierig war, zu erfahren, was vorgefallen sei. Bei der Nachricht von dem Verschwinden des Diamanten schien sie wie versteinert; dann ging sie an die Thür von Fräulein Rachel’s Schlafzimmer und verlangte eingelassen zu werden. Fräulein Rachel öffnete.
Die Schreckensbotschaft, die wie Feuerlärm durch das Haus lief, erreichte zunächst die beiden Herren.
Herr Godfrey war der Erste, der aus seinem Zimmer trat. Alles, was er that, als er von dem Vorgefallenen hörte, war, daß er seine Hände in einer Art von Verzweiflung in die Höhe hielt, was eben nicht sehr für seine Geistesgegenwart sprach.
Herr Franklin, von dessen klarem Kopfe ich zuversichtlich guten Rath in dieser Sache erwartet hatte, schien nicht weniger rathlos als sein Vetter, als er die Nachricht vernahm. Merkwürdiger Weise hatte er die vorige Nacht gut geschlafen, und der ungewohnte Genuß des Schlafes hatte ihn, wie er selbst sagte, anscheinend dumm gemacht; Als er jedoch seinen Kaffee getrunken hatte, den er nach ausländischer Sitte immer einige Stunden vor dem Frühstück nahm, klärte sich sein Kopf auf, seine scharfsinnige Seite trat wieder hervor und er nahm die Sache entschlossen und geschickt in folgender Weise in die Hand:
Er ließ zuerst die Dienerschaft zusammenkommen und befahl, alle Thüren und Fenster des Erdgeschosses, mit Ausnahme der Hauptthür die ich eben geöffnet hatte, völlig unberührt zu lassen, wie wir sie am Abend zuvor verschlossen hatten. Demnächst forderte er seinen Vetter und mich auf, uns, bevor wir irgend einen weitern Schritt thäten, zu überzeugen, daß der Diamant nicht irgendwohin gefallen sei, vielleicht hinter das Schränkchen oder hinter den Tisch, auf, welchem das Schränkchen stand.
Nachdem Herr Franklin beide Stellen durchsucht und nichts gefunden, dann Penelope befragt und nichts von ihr erfahren als das Wenige, was sie mir bereits mitgetheilt hatte, schlug er vor, nun Fräulein Rachel selbst zu befragen, und schickte Penelope ab, an ihre Schlafstubenthür zu klopfen. Mylady öffnete und schloß die Thür wieder hinter sich. Den nächsten Augenblick hörten wir, wie die Thür von innen von Fräulein Rachel wieder verriegelt wurde. Mylady kam wieder zu uns herein und sah ganz verstört und unglücklich aus. »Der Verlust des Diamanten scheint Rachel ganz außer sich gebracht zu haben,« sagte sie zu Herrn Franklin, »sie weigerte sich in der auffallendsten Weise, selbst mit mir davon zu reden; Sie können sie in diesem Augenblicke unmöglich sehen.«
Nach diesen Worten Mylady’s, welche unsere Verwirrung nur zu vermehren geeignet waren, gewann sie ihre Fassung wieder und handelte mit ihrer gewöhnlichen Entschlossenheit »Ich fürchte, da wird nicht zu helfen sein,« sagte sie ruhig. »Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl, als nach der Polizei zu schicken.«
»Und das Erste, was die Polizei zu thun haben wird,« fügte Herr Franklin ergänzend hinzu, »ist, die indischen Jongleurs zu verhaften, die gestern Abend hier ihre Künste produzierten.«
Mylady und Herr Godfrey, denen von dem, was Herr Franklin und ich wußten, nichts bekannt war, schienen Beide erschreckt und erstaunt.
»Ich habe jetzt keine Zeit, mich näher zu erklären,« fuhr Herr Franklin fort, »ich kann Ihnen nur kurz soviel sagen, daß die Indier unzweifelhaft den Diamanten gestohlen haben. Geben Sie mir einen Empfehlungsbrief an ein Mitglied des Magistrats in Frizinghall,« sagte er zu Mylady gewandt, »in welchem Sie einfach erklären, daß ich Ihre Interessen und Wünsche vertrete und lassen Sie mich auf der Stelle damit wegreiten. Unsere Chance, der Diebe habhaft zu werden, kann durch den Verlust einer einzigen Minute gefährdet sein.« (NB.: gleichviel, ob es die französische oder englische Seite war, jedenfalls schien er jetzt die rechte Seite hervorgekehrt zu haben; es fragte sich nur, wie lange es dauern würde.)
Er setzte Tinte, Feder und Papier vor seine Tante hin, welche, wie mir schien, den von ihm verlangten Brief ungern schrieb. Wenn es möglich gewesen wäre, von einem solchen Vorfalle, wie dem Verlust eines 20,000 Lstr. werthen Edelsteins keine Notiz zu nehmen, so würde Mylady, bei ihrer Meinung über ihren verstorbenen Bruder und ihrem Mißtrauen gegen sein Geburtstagsgeschenk, am liebsten, glaube ich, die Diebe mit ihrem Mondstein in Ruhe gelassen haben. Ich ging darauf mit Herrn Franklin in die Ställe und benutzte diese Gelegenheit ihn zu fragen, wie nach seiner Meinung wohl die Indier, auf die ich natürlich ebenso starken Verdacht hatte wie er, in das Haus gelangt sein könnten.
Einer von ihnen, meinte er, hätte sich bei der Verwirrung, die bei Aufbruch der Gesellschaft am gestrigen Abend entstanden sei, in’s Haus schleichen können.
»Der Kerl mag unter dem Sopha gelegen haben, während meine Tante und Fräulein Rachel sich darüber unterhielten, wohin man den Diamanten während der Nacht legen solle; er hätte dann nur zu warten nöthig gehabt, bis es im Hause stille geworden, und ihn dann aus dem Schränkchen wegnehmen können.«
Mit diesen Worten rief er dem Stallknecht zu, das Thor zu öffnen und ritt davon.
Das schien die einzige rationelle Erklärung zu sein. Aber wie war es dem Diebe gelungen, wieder aus dem Hause zu kommen? Ich hatte die Hauptthür, als ich sie am Morgen öffnen wollte, verschlossen und verriegelt gefunden, wie ich sie am Abend zuvor verlassen hatte. Die übrigen Thüren und Fenster waren noch diesem Augenblick so fest verschlossen wie vorher, und die Hunde, — angenommen der Dieb hätte sich aus einem der Fenster des oberen Stockwerks herablassen können, wie konnte er unbemerkt an den Hunden vorbeikommen? Hatte er einschläfernde Bissen für sie bereit gehabt?
Als ich eben mit diesem Gedanken beschäftigt war, kamen die Hunde selbst um die Ecke auf mich zu gerannt, wälzten sich vor mir in dem nassen Grase so munter und ausgelassen, daß es nicht leicht war, sie zum Parieren zu bringen und sie wieder anzuketten. Je mehr ich mir die Sache überlegte, desto weniger befriedigend erschienen mir Herrn Franklins Erklärungen.
Wir frühstückten. Einerlei, was in einem Hause vorgeht: Raub und Mord: gefrühstückt muß werden. Als wir fertig waren, schickte Mylady nach mir und ich fand mich nun genöthigt, ihr Alles in Betreff der Indier und ihres Komplottes. was ich bisher vor ihr verheimlicht hatte, zu erzählen.
Als eine Frau von großer Entschlossenheit überwand sie sehr bald den ersten erschreckenden Eindruck dessen, was ich ihr mitzutheilen hatte. Ihr Gemüth schien viel besorgter über den Zustand ihrer Tochter als über die heidnischen Räuber und ihre Verschwörung.
»Sie wissen,« sagte Mylady zu mir, »wie sonderbar Rachel und wie verschieden ihr Benehmen bisweilen von dem anderer junger Mädchen ist. Aber in ihrem ganzen Leben habe ich sie noch nicht so sonderbar und so verschlossen gefunden, wie bei dieser Gelegenheit.
Der Verlust ihres Edelsteins schien sie fast um ihren Verstand gebracht zu haben. Wer hätte es für möglich halten sollen, daß dieser schreckliche Diamant in so kurzer Zeit eine solche Umwandlung bei ihr würde bewirken können!«
Es war in der That sonderbar genug. Im Allgemeinen machte sich Fräulein Rachel bei Weitem nicht so viel aus Schmucksachen und Spielereien, wie die meisten jungen Mädchen; aber jetzt saß sie noch immer untröstlich in ihrem Schlafzimmer. Ich muß freilich bekennen, daß sie nicht die einzige Person im Hause ist, die ihre Fassung verloren hatte.
Herr Godfrey z. B. obgleich seinem Beruf nach eine Art Generaltröster, schien sich selbst völlig verloren zu haben. Da es ihm an erheiternder Gesellschaft und an Gelegenheit fehlte, zu erproben, was seine Erfahrungen mit unglücklichen Frauen zur Aufrichtung Fräulein Rachels vermögen würden, ging er in Haus und Garten unbehaglich und zwecklos auf und ab und hin und her. Er war sich offenbar nicht einig, was er nach dem unglücklichen Vorfall thun, ob er die Familie in ihrer gegenwärtigen Lage von der Last, ihn als Gast zu beherbergen, befreien, oder ob er im Hinblick auf die Möglichkeit, sich durch seine geringen Dienste nützlich zu machen, noch länger bleiben solle. Er entschied sich endlich für das Letztere, da es ihm angemessener schien, eine Familie in einer so eigenthümlichen Situation nicht zu verlassen. Besondere Lagen des Lebens lassen den wahren Charakter eines Mannes am besten erkennen. Die hier vorliegenden Umstände zeigten Herrn Godfrey von schwächerem Charakter, als ich ihm zugetraut hatte.
Die weiblichen Dienstboten standen mit Ausnahme Rosanna Spearman’s, die für sich allein blieb, in den Ecken umher und flüsterten sich einander ihre Vermuthungen zu, wie es die Art des schwächeren Geschlechtes ist, wenn irgend etwas Außerordentliches in einem Hause passiert. Ich selbst muß bekennen, daß ich höchst aufgeregt und schlecht gelaunt war. Der verwünschte Mondstein hatte uns allen die Köpfe verdreht.
Kurz vor 11 Uhr kam Herr Franklin zurück. Allem Anscheine nach war während der Zeit seiner Abwesenheit unter dem Gewicht der Ereignisse die entschlossene Seite in ihm wieder unterlegen. Er war im Galopp fortgeritten und kam im Schritt zurück. Beim Fortreiten war er wie von Eisen gewesen, bei der Rückkehr war er wie von Watte.
»Nun,« sagte Mylady, »kommt die Polizei?«
»Ja,« erwiderte Herr Franklin, »die Leute erklärten, sie würden, der Oberbeamte der Lokal-Polizei Seegreaf mit zwei seiner Unterbeamten, mir rasch zu Wagen folgen. Übrigens wird die Sache nur eine Form sein, der Fall ist hoffnungslos.«
»Wie? haben sich die Indier davon gemacht?« fragte ich.
»Die armen Indier sind höchst unschuldigerweise verhaftet worden, « sagte Herr Franklin; » sie sind so unschuldig wie ein neugeborenes Kind.«
»Meine Idee, daß Einer von Ihnen sich im Hause versteckt haben könnte, ist, wie alle meine übrigen Ideen, in Rauch aufgegangen.«
»Es ist erwiesen, daß das völlig unmöglich ist.«
Nachdem Herr Franklin uns durch diese total neue Wendung in der Mondstein-Angelegenheit in Erstaunen gesetzt hatte, nahm unser junger Herr Platz und erklärte sich auf die Bitte seiner Tante näher.
Es schien, daß die entschlossene Seite bei ihm bis Frizinghall vorgehalten hatte: Er hatte der Magistratsperson den ganzen Fall klar vorgelegt und diese hatte sofort nach der Polizei geschickt. Die über die Indier alsbald angestellte Untersuchung ergab, daß sie nicht den leisesten Versuch gemacht hatten, die Stadt zu verlassen. Aus ferneren Nachforschungen ging hervor, daß alle drei am Abend zuvor zwischen 10 und 11 Uhr mit dem Knaben nach Frizinghall zurückgekehrt waren, was, wenn man die Zeit und die Entfernung berücksichtigte, zugleich bewies, daß sie direkt von hier dahin gegangen waren, nachdem sie auf unserer Terrasse ihre Künste produziert hatten. Noch später, um Mitternacht, als die Polizei das Logierhaus, in dem sie wohnte, besichtigte, fanden sie sich dort alle drei mit ihrem kleinen Knaben wie gewöhnlich bei einander.
Bald nach Mitternacht hatte ich selbst das Haus fest verschlossen. Einen besseren Beweis zu Gunsten der Indier konnte es nicht wohl geben. »Die Magistratsperson erklärte, daß bis jetzt auch nicht einem Schatten von Verdacht gegen die Indier Veranlassung sei. Da es jedoch möglich war, daß die Polizei bei näherer Untersuchung unserer Angelegenheit zu Entdeckungen in Betreff der Jongleurs gelangen konnte, so ließ der Magistrat sich bereit finden, sie als Vagabonden verhaften zu lassen und dieselben eine Woche lang zu unserer Verfügung zu halten. Sie hatten ohne es zu wissen irgend etwas, ich weiß nicht mehr was, in der Stadt begangen, was diese Verhaftung gesetzlich möglich machte.
Alle menschlichen Einrichtungen, die Gerechtigkeit nicht ausgenommen, lassen sich, wenn man sie nur richtig anfaßt, ein wenig dehnen. Die würdige Magistratsperson war ein alter Freund von Mylady und so wurde das indische Pack auf eine Woche ins Gefängnis gebracht.
So lautete Herrn Franklins Bericht über die Ereignisse in Frizinghall. Der indische Schlüssel zu dem Geheimnis des verlorenen Diamanten war allem Anschein nach in unseren eigenen Händen zerbrochen. Waren aber die Jongleurs unschuldig, wer in aller Welt konnte den Diamanten aus Fräulein Rachels Schubfach genommen haben?
Zehn Minuten später traf zu unserer größten Beruhigung der Oberbeamte Seegreaf in unserem Hause ein.
Er führte sich mit der Mittheilung ein, daß er Herrn Franklin in der Sonne sitzend (vermuthlich im Genusse seiner italienischen Seite) auf der Terrasse getroffen und daß derselbe ihn darauf aufmerksam gemacht habe, daß die Untersuchung, noch ehe sie ihren Anfang genommen, hoffnungslos sei.
Für eine Familie in unserer Lage war der Oberbeamte der Polizei von Frizinghall die beruhigendste Persönlichkeit, die man sich wünschen konnte. Herr Seegreaf war ein langer und stattlicher Mann von militairischen Manieren Er hatte eine schöne gebietende Stimme und ein sehr entschlossenes Auge und trug einen großen Frack, der bis an den Hals fest zugeknöpft war.
»Ich bin der Mann, den Sie brauchen,« stand ihm auf der Stirn geschrieben und er ertheilte die Befehle an seine Unterbeamten in einem Tone, der deutlich zeigte, daß mit diesem Manne nicht zu spaßen sei.
Er fing damit an, alle Räume in und außer dem Hause zu besichtigen. Das Ergebnis dieser Untersuchung war, daß keine Diebe von außen eingebrochen sein konnten und daß folglich der Raub von einer Person im Hause begangen sein müsse.
Ich überlasse es dem Leser, sich den Zustand vorzustellen, in welchen die offizielle Ankündigung dieses Ergebnisses der Untersuchung die Dienstboten versetzte.
Der Oberbeamte beschloß, die weitere Nachforschung mit einer Durchsuchung des Boudoirs zu beginnen und dann die Sachen der Dienstboten zu durchsuchen. Zu gleicher Zeit postirte er einen seiner Leute auf die Treppe, welche zu den Schlafzimmern der Domestiken führte mit der Ordre, bis auf Weiteres Niemanden vorbeizulassen.
Bei dieser letzteren Prozedur gerieth das schwächere Geschlecht sofort außer sich. Sie platzten aus ihren Ecken hervor, rannten Alle nach Fräulein Rachels Zimmer, diesmal Rosanna Spearman mit sich fortreißend, stürmten auf den Oberbeamten Seegreaf los und verlangten von ihm mit Gesichtern, nach denen man sie alle für gleich schuldig hätte halten können, daß er auf der Stelle erklären möge, wen von ihnen er im Verdacht habe. Aber der Oberbeamte zeigte sich auch dieser Situation gewachsen; er sah sie mit seinem entschlossenen Auge an und brachte sie mit seiner militairischen Stimme zum Schweigen.
»Macht, daß Ihr wieder hinunterkommt, ihr Weiber alle zusammen! ich will Euch hier nicht haben. Da seht,« sagte er, indem er auf einen kleinen Fleck an der Dekorationsmalerei auf Fräulein Rachels Thür an der äußern Ecke gerade unter dem Schloß hinwies, »seht, was für Unheil eure Röcke bereits angerichtet haben! Macht, daß ihr wegkommt, rasch!«
Rosanna Spearman, die ihm und dem kleinen Fleck an der Thür zunächst stand, ging mit gutem Beispiele voran und eilte zu ihrer Arbeit; die Andern folgten ihr.
Der Oberbeamte fuhr mit seinen Durchsuchung des Zimmers fort und fragte mich, da er Nichts fand, wer den Raub zuerst entdeckt habe.
»Das war meine Tochter.«
Nach ihr wurde daher geschickt. Der Oberbeamte ging Anfangs ein wenig zu hart gegen meine Tochter vor.
»Komm her, mein Kind,« sagte er; »gib Acht, daß Du die Wahrheit sagst.«
Penelope fuhr gegen ihn los. »Ich habe mein Leben lang nicht gelernt, die Unwahrheit zu sagen, Herr Polizei! Und wenn Vater dabei stehen und es ruhig mit anhören kann, wie ich der Lüge und des Diebstahls beschuldigt und aus meinem eigenen Schlafzimmer ausgesperrt werde und um meinen guten Ruf gebracht werden soll, der Alles ist, was ein armes Mädchen, wie ich, hat, so ist er nicht der gute Vater, für den ich ihn gehalten habe.«
Ein zu rechter Zeit von mir gesprochenes Wort brachte den Vertreter der Gerechtigkeit und Penelope auf einen bessern Fuß mit einander. Die Fragen und Antworten gingen nun ganz glatt vor sich und führten zu keinem Resultat. Das Letzte, was meine Tochter am Abend vorher gesehen, war gewesen, daß Fräulein Rachel den Diamanten ins Schubfach gelegt hatte. Als sie am nächsten Morgen um 8 Uhr Fräulein Rachel eine Tasse Thee in ihr Zimmer gebracht, hatte sie das Schubfach offen und leer gefunden und sofort das Haus alarmiert. Und damit endete Penelopens Aussage.
Darauf verlangte der Oberbeamte Fräulein Rachel selbst zu sprechen. Penelope meldete dieses Verlangen durch die Thür. Die Antwort gelangte auf demselben Wege zu uns.
»Ich habe dem Polizeibeamten nichts zu sagen, ich kann Niemanden sehen.«
Unser erfahrener Polizeibeamter sah ebenso überrascht als beleidigt aus, als er diese Antwort vernahm. Ich sagte ihm, mein junges Fräulein sei unwohl und bat ihn, ein bisschen zu warten, um sie später sprechen zu können. Dann gingen wir wieder hinunter, wo wir Herrn Godfrey und Herrn Franklin, die eben durch die Halle gingen, trafen. Die beiden Herren wurden als Hausgenossen aufgefordert zu erklären, ob sie irgend etwas die Angelegenheit betreffend mitzutheilen hätten, aber Keiner von Beiden wußte etwas. Er fragte, ob sie irgend einen verdächtigen Lärm während der vorigen Nacht gehört hätten? Sie hatten nichts gehört, als das Herabfallen des Regens. Er fragte weiter, ob ich, der länger gewacht hatte, auch nichts gehört habe? Nichts. Als dieses Inquiriren zu Ende war, flüsterte mir Herr Franklin, der noch bei der Ansicht von der gänzlichen Vergeblichkeit der ganzen Untersuchung zu beharren schien, zu: »Der Mann wird uns nicht das Mindeste helfen; der Oberbeamte Seegreaf ist ein Esel.« Herr Godfrey seinerseits flüsterte mir zu: »Der Mann ist ein ausgezeichneter Beamter, Betteredge; ich habe das größte Vertrauen zu ihm.« So viel Köpfe, so viel Sinne, wie schon ein alter Weiser vor meiner Zeit gesagt hat.
Im Fortgang der Untersuchung ging der Beamte wieder mit mir und meiner Tochter in’s Boudoir zurück. Sein Zweck war in diesem Augenblick, zu entdecken, ob irgend ein Möbel während der Nacht von seinem gewöhnlichen Platze gerückt worden sei, da seine vorher vorgenommene Durchsuchung offenbar nicht gründlich genug gewesen war, um ihn über diesen Punkt zu vergewissern. Während wir an Tischen und Stühlen herumarbeiteten, öffnete sich nun die Thür des Schlafzimmers Fräulein Rachel, die sich bis dahin geweigert hatte, irgend Jemanden zu sehen, kam jetzt zu unserm Erstaunen aus eigenem Antriebe zu uns herein. Sie nahm ihren Gartenhut von einem Stuhl und ging dann gerade auf Penelope los und fragte diese: »Hat Herr, Franklin Blake Dich diesen Morgen mit einer Botschaft zu mir geschickt?«
»Ja, Fräulein!«
»Er wollte mich sprechen, nicht wahr?«
»Ja, Fräulein!«
»Wo ist er jetzt?«
Da ich eben Stimmen auf der Terrasse hörte, so blickte ich zum Fenster hinaus und sah, wie die beiden Herren auf der Terrasse auf- und abspazierten. Ich antwortete für meine Tochter und sagte: »Herr Franklin ist auf der Terrasse.«
Ohne ein Wort weiter zu sagen, ohne die mindeste Notiz von dem Beamten zu nehmen, der einen vergeblichen Versuch machte, mit ihr zu reden, bleich wie der Tod und in ihre eigenen Gedanken versenkt, verließ das Zimmer und ging zu ihrem Vetter hinab. So sehr es gegen den schuldigen Respekt und die gute Sitte war, konnte ich es mir um Alles in der Welt nicht versagen, zum Fenster hinaus zu sehen. Als Fräulein Rachel die Herren auf der Terrasse erreichte, ging sie geradeswegs auf Herrn Franklin zu, scheinbar ohne Herrn Godfrey zu bemerken, der sich darauf zurückzog und die Beiden allein ließ. Sie schien sehr heftig mit Herrn Franklin zu reden. Die Unterhaltung dauerte nur eine kurze Weile, versetzte ihn aber, soweit ich sein Gesicht vom Fenster aus beobachten konnte, in ein unbeschreibliches Erstaunen. Während sie noch mit einander sprachen, erschien Mylady auf der Terrasse. Als Fräulein Rachel ihrer ansichtig wurde, flüsterte sie Herrn Franklin noch ein paar Worte zu und kehrte dann rasch ins Haus zurück, noch ehe ihre Mutter mit ihr hatte reden können. Mylady, die selbst erstaunt war und das Erstaunen« des Herrn Franklin sah, redete ihn an. Herr Godfrey trat zu ihnen und nahm an der Unterhaltung Theil. Herr Franklin ging mit Beiden etwas auf die Seite und theilte ihnen vermuthlich mit, was vorgefallen war, denn Beide standen plötzlich wie erschrocken still. Ich hatte diesen Vorgang eben beobachtet, als die Thür des Boudoirs sich heftig öffnete. Fräulein Rachel ging mit wildem Blick und flammenden Wangen, aufgeregt und zornig, rasch in ihr Schlafzimmer. Der Polizeibeamte machte abermals einen Versuch, sie zu befragen. An der Schwelle ihres Schlafzimmers drehte sie sich nach ihm um und rief heftig: »Ich habe nicht nach Ihnen geschickt ich will nichts von Ihnen, mein Diamant ist verloren; weder Sie noch irgend Jemand wird ihn wiederfinden.« Mit diesen Worten ging sie in ihr Zimmer und verriegelte die Thür hinter sich. Penelope die der Thür zunächst stand, hörte, wie sie in ihrem Zimmer sofort Thränen vergoß, die nur zuweilen von Zornausbrüchen unterbrochen wurden. Was hatte das zu bedeuten? Ich sagte dem Beamten, Fräulein Rachel sei durch den Verlust ihres Edelsteines ganz außer Fassung gebracht. Besorgt für die Ehre der Familie, wie ich war, berührte es mich peinlich, mein junges Fräulein sich selbst gegen einen Polizeibeamten vergessen zu sehen, und ich entschuldigte daher ihr Benehmen so gut ich konnte.
Fräulein Rachels ungewöhnliches Benehmen beunruhigte mich mehr als ich sagen kann. Nach den Worten, die sie an der Schwelle ihres Schlafzimmers gesprochen, mußte ich ich schließen, daß sie das Herbeiholen der Polizei als eine tödtliche Beleidigung gegen sich betrachte, und das Erstaunen des Herrn Franklin auf der Terrasse war vermuthlich dadurch veranlaßt worden, daß sie ihm ihren Unwillen über seine Mitwirkung bei jenem Herbeiholen der Polizei ausgedrückt hatte. Wenn dieser Schluß richtig war, so durfte man billig fragen, warum sie bei dem Verlust ihres Diamanten etwas gegen die Anwesenheit von Leuten im Hause habe, deren eigentliches Geschäft es war, das Verlorene für sie wiederzufinden, und woher in aller Welt sie wissen konnte, daß der Mondstein nicht wieder gefunden würde.
Wie die Dinge standen, war von Niemandem im Hause eine Antwort auf diese Fragen zu erwarten. Herr Franklin schien es für eine Ehrensache zu halten, einem Dienstboten, selbst einem so alten Diener wie ich es war, nichts von dem zu wiederholen, was Fräulein Rachel ihm auf der Terrasse gesagt hatte.
Herr Godfrey, der als Gentleman und ein Verwandter von Herrn Franklin wahrscheinlich ins Vertrauen gezogen worden war, respektierte dieses Vertrauen, wie es seine Pflicht war.
Mylady, die unzweifelhaft gleichfalls um das Geheimnis wußte und die allein zu Fräulein Rachel Zutritt hatte, gestand offen, daß sie nichts mit ihr anzufangen wisse.
»Du machst mich wahnsinnig, wenn Du vom Diamanten sprichst!« Dem ganzen Aufgebot des mütterlichen Einflusses gelang es nicht, mehr als diese Worte aus ihr herauszubringen.
So waren wir denn völlig im Dunkeln über Fräulein Rachel und über den Mondstein. In Betreff des Fräuleins war Mylady außer Stande, uns zu helfen. In Betreff des Mondsteins war Seegreaf, wie der Leser gleich sehen wird, sehr bald mit seinem Latein zu Ende.
Nachdem unser erfahrener Beamter das ganze Boudoir durchstöbert hatte, ohne in oder an den Möbeln Etwas zu entdecken, wandte er sich an mich mit der Frage, ob die Dienstboten im Allgemeinen die Stelle kannten, an die der Diamant während der Nacht gelegt worden sei, oder nicht.
»Um mit mir anzufangen,« antwortete ich, »so habe ich um den Platz gewußt, der Diener Samuel desgleichen; denn er war dabei, als die Herrschaften in der Halle darüber sprachen, wohin der Diamant während der Nacht gelegt werden solle. Meine Tochter ferner wußte ebenfalls darum, wie sie Ihnen bereits gesagt hat. Vielleicht daß Samuel der Sache gegen die anderen Dienstboten Erwähnung gethan hat, oder daß die übrigen Dienstboten das Gespräch durch die Seitenthür der Halle, welche nach der Hintertreppe führt und vielleicht offen stand, selbst mitangehört haben. Es ist also möglich, daß alle Leute im Hause um den Platz, auf dem der Diamant sich in dieser Nacht befand, gewußt haben.«
Da meine Antwort für den Verdacht des Beamten ein weites Feld darzubieten schien, so suchte er dasselbe zunächst durch Erkundigungen über die Charaktere der Dienstboten zu begrenzen.
Ich dachte auf der Stelle an Rosanna Spearman; aber es war weder meines Amtes, noch wünschte ich den Verdacht auf das arme Mädchen zu lenken, deren Rechtlichkeit, so lange ich sie gekannt hatte, über jeden Zweifel erhaben gewesen war. Die Hausmutter in der Besserungs-Anstalt hatte sie Mylady als ein Mädchen bezeichnet, daß ihr früheres Vergehen aufrichtig bereut habe und durchaus vertrauenswürdig sei. Es war die Sache des Beamten, selbst Verdachtsgründe gegen sie aufzufinden, und nur wenn er das gethan haben würde, aber auch nur dann würde es meine Pflicht sein, sagte ich mir, ihm mitzutheilen, wie sie in Mylady’s Dienste gekommen sei.
»Gegen keinen unserer Leute liegt irgend etwas vor,« sagte ich, »und Alle verdienen das Vertrauen, das ihre Herrin zu ihnen zeigt.«
Darauf gab es nur noch eine Sache für Herrn Seegreaf zu thun, nämlich sich selbst über die Persönlichkeiten der Dienstboten zu unterrichten. Einer nach dem Andern wurden sie inquirirt und Einer nach dem Andern hatten Nichts zu sagen und sagten dieses Nichts, sofern sie dem weiblichen Geschlecht angehörten, mit großer Ausführlichkeit und mit einem sehr entschiedenen Ausdruck der Entrüstung über das auf ihre Schlafzimmer gelegte Sequester.
Nachdem die Übrigen wieder in die Küchenräume hinuntergeschickt waren, wurde Penelope vorgefordert und allein zum zweiten Male inquirirt.
Der kleine Zornausbruch meiner Tochter bei dem ersten Verhör in dem Boudoir, bei dem sie sich aus der Stelle beschuldigt geglaubt hatte, schien einen ungünstigen Eindruck auf unsern Polizeibeamten hervorgebracht zu haben. Ersichtlich beschäftigte ihn noch der Gedanke, daß sie die letzte Person gewesen war, welche den Diamanten am vorigen Abend gesehen hatte.
Als das zweite Verhör vorüber war, kam meine Tochter ganz außer sich zu mir. Es war kein Zweifel mehr, der Beamte hatte ihr so gut wie gesagt, daß sie die Diebin sei. Ich konnte kaum glauben, daß er ein solcher Esel sei, selbst wenn ich mir Herrn Franklin’s Auffassung aneignete. Aber gewiß ist, daß er meine Tochter mit keinem freundlichen Auge ansah.
Ich lachte über die Sache als über etwas, das zu abgeschmackt war, um ernsthaft behandelt zu werden. Innerlich aber war ich, glaube ich, närrisch genug, gleichfalls sehr aufgebracht darüber zu sein. Die Sache war in der That recht fatal. Meine Tochter setzte sich, ihr Gesicht mit der Schürze bedeckend, in eine Ecke und weinte bitterlich.
Vielleicht finden meine Leser das närrisch und finden, sie hätte warten können, bis er sie offen anklagte. Nun ja. Als gerechter und unparteiischer Mensch gebe ich das zu. Der Beamte hätte billig bedenken müssen, — Ach, was! Hol’ ihn der Teufel!
Der nächste und letzte Schritt in der Untersuchung brachte die Dinge, wie man es nennt, zu einer Krisis. Der Beamte hatte eine Besprechung mit Mylady, bei der ich zugegen war. Nachdem er ihr mitgetheilt, daß der Diamant nothwendig von Jemandem im Hause genommen sein müsse, erbat er für sich und seine Leute die Erlaubnis, die Zimmer und Sachen der Dienstboten auf der Stelle durchsuchen zu dürfen.
Meine großmüthige und edeldenkende Herrin weigerte sich, uns wie Diebe behandeln zu lassen.
»Ja; ich werde niemals meine Zustimmung dazu geben,« sagte sie, »daß die treuen Leute, die in meinen Diensten stehen, so behandelt werden.«
Der Herr Oberbeamte verneigte sich mit einem Blick auf mich, in dem deutlich zu lesen stand: »Warum haben Sie mich kommen lassen, wenn Sie mir die Hände binden wollen?«
Als Chef der Dienerschaft fühlte ich auf der Stelle, daß es unsere Pflicht und Schuldigkeit gegen alle Betheiligten sei, bei dieser Gelegenheit von der Großmuth unserer Herrin keinen Gebrauch zu machen.
»Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet, gnädige Frau,« sagte ich; »aber wir bitten Sie um die Erlaubnis, das zu thun, was bei dieser Gelegenheit das Richtigste ist, indem wir unsere Schlüssel abgeben. Wenn Gabriel Betteredge mit gutem Beispiel vorangeht,« sagte ich, den Oberbeamten Seegreaf an der Thür zurückhaltend, so werden die übrigen Dienstboten folgen; dafür stehe ich Ihnen. Hier übergebe ich Ihnen, um den Anfang zu machen, meine Schlüssel.«
Mylady ergriff meine Hand und dankte mir mit Thränen in den Augen. Herr Gott! was hätte ich nicht in dem Augenblick darum gegeben, wenn ich den Herrn Seegreaf hätte zu Boden werfen können!
Wie ich es vorhergesagt hatte, folgten die übrigen Dienstboten meinem Beispiel, natürlich mit Widerstreben, aber Alle in derselben Überzeugung in der ich gehandelt hatte. Es war der Mühe werth, die Frauenzimmer anzusehen. als die Polizeibeamten in ihren Sachen herumwühlten. Die Köchin sah aus, als ob sie den Herrn Oberbeamten lebendig auf dem Rost braten möchte, und die anderen Frauenzimmer, als ob sie ihn, wenn er gar wäre, gern verzehren würden.
Nachdem die Durchsuchung vorüber war und kein Diamant, auch nicht die Spur eines Diamanten sich gefunden hatte, zog sich Herr Seegreaf in ein kleines Zimmer zurück, um mit sich zu Rathe zu gehen, was nun zunächst zu thun sei. Er und seine Leute waren jetzt schon viele Stunden in unserem Hause und hatten uns noch keinen Zoll breit in der Auffindung des Mondsteins oder der Person, auf die man einen begründeten Verdacht werfen könnte, gefördert.
Während der Polizeibeamte noch so schweigend und nachdenklich da saß, wurde ich zu Herrn Franklin in die Bibliothek beordert. Zu meinem unaussprechlichen Erstaunen wurde die Thür des Bibliothekzimmers gerade in dem Augenblick, wo ich die Hand auf den Griff legte, plötzlich von innen geöffnet und heraus trat Rosanna Spearman. Nachdem die Bibliothek am Morgen gefegt und gereinigt war, hatte keines der Hausmädchen irgend etwas mehr im Zimmer zu thun. Ich hielt Rosanna Spearman an und machte ihr auf der Stelle Vorwürfe über ihren Verstoß gegen die häusliche Disziplin.
»Was hast Du zu dieser Tagesstunde in der Bibliothek zu thun?« fragte ich.
»Herr Franklin Blake hat einen seiner Ringe oben fallen lassen,« antwortete Rosanna, »und ich bin in die Bibliothek gegangen, um ihn ihm wieder zu bringen.»
Ein tiefes Roth überflog das Gesicht des Mädchens, als sie mir diese Antwort gab, und sie ging, indem sie den Kopf in den Nacken warf und mir einen hochmüthigen Blick zuwarf, den ich mir auf keine Weise zu erklären wußte. Ohne Zweifel hatten die Vorgänge im Hause allen Frauenzimmern im Hause den Kopf verdreht, aber mit Keiner war eine solche Veränderung vorgegangen, wie allem Anscheine nach mit Rosanna.
Ich fand Herrn Franklin am Bibliothektisch sitzend und schreibend. Er bat mich, sowie ich in’s Zimmer trat, ihm einen Wagen zu besorgen, um nach der Eisenbahnstation zu fahren. Der ernste Ton seiner Stimme überzeugte mich, daß die entschlossene Seite seines Wesens jetzt wieder entschieden die Oberhand gewonnen hatte. Der Wattenmann war verschwunden und der eiserne Mann saß wieder vor mir.
»Wollen Sie nach London, Herr Franklin?« fragte ich.
»Ich will nach London telegraphieren,« sagte er. »Meine Tante hat sich überzeugt, daß wir einen klareren Kopf, als den des Oberbeamten Seegreaf brauchen, um uns zu helfen, und sie hat mir erlaubt, an meinen Vater zu telegraphieren. Er kennt den Polizei-Chef in London und dieser wird uns schon einen Mann schicken, der es versteht, Licht in das Dunkel des Diamanten zu bringen. Beiläufig, da ich gerade von Geheimnissen, spreche,« sagte Herr Franklin mit leiserer Stimme, »ich habe Ihnen noch etwas zu sagen, bevor Sie nach dem Stall gehen. Lassen Sie aber keinem Menschen etwas davon ahnen: Entweder Rosanna Spearman ist nicht ganz richtig im Kopf, oder sie weiß mehr über den Mondstein, als sie wissen sollte.«
Ich wüßte kaum zu sagen, ob mich diese Worte mehr entsetzten oder mehr betrübten. Wäre ich jünger gewesen, so hätte ich mich über diesen Eindruck gegen Herrn Franklin ausgesprochen; aber wenn man älter wird, eignet man sich eine vortreffliche Gewohnheit an: nämlich in Fällen, wo man seiner Sache nicht ganz gewiß ist, lieber zu schweigen.
»Sie war eben hier, um mir einen Ring zu bringen, den ich in meinem Schlafzimmer hatte fallen lassen,« fuhr Herr Franklin fort. »Als ich ihr gedankt hatte, erwartete ich natürlich, daß sie wieder fortgehen würde. Statt dessen stellte sie sich mir gegenüber an den Tisch und sah mich in der sonderbarsten Weise, halb schüchtern und halb vertraulich an.«
»Das, ist eine komische Geschichte mit dem Diamanten, Herr Franklin!« fing sie plötzlich in einem ängstlich-hastigen Ton an.
Ich sagte: »Ja wohl!« und war begierig zu hören, was sie weiter vorzubringen hatte. Auf mein Ehrenwort, Betteredge, ich glaube, das Mädchen ist nicht richtig im Kopfe. Sie sagte: »Sie werden den Diamanten nie finden, nicht wahr, Herr? nein, so wenig wie den, der ihn genommen hat; dafür stehe ich!« Dabei nickte sie und lächelte mir zu; aber ehe ich sie noch fragen konnte, was sie damit meine, hörten wir Ihre Schritte vor der Thür.
Ich glaube, sie war bange, von Ihnen hier getroffen zu werden; jedenfalls wurde sie roth und ging rasch hinaus.«
Was in aller Welt hatte Das zu bedeuten? Selbst in diesem Augenblick konnte ich’s nicht über mich gewinnen, ihm die Geschichte des Mädchens zu erzählen. Das wäre beinahe so gut gewesen, als wenn ich ihm gesagt hätte, sie ist die Diebin. Und selbst wenn ich mich darüber ausgesprochen hätte, und selbst angenommen, sie wäre die Diebin gewesen, so war es doch damit um nichts klarer, warum sie gerade Herrn Franklin ihr Geheimnis hatte anvertrauen wollen.
»Ich kann den Gedanken nicht ertragen, das arme Mädchen unglücklich zu machen, nur weil ihre auffallenden Manieren und ihre sonderbare Sprache etwas Verdächtiges haben. Und doch, hätte sie dem Oberbeamten gesagt, was sie mir anvertraut hat, ich fürchte, trotz seiner Beschränktheit würde er —« hier hielt er inne —
»Das Beste wird sein,« sagte er, »wenn ich bei der ersten Gelegenheit Mylady zwei Worte über die Sache sage. Mylady nimmt sehr herzlichen Antheil an Rosanna, und am Ende ist das Mädchen doch nur voreilig und albern gewesen. Wenn irgend etwas im Hause begangen worden ist, so denken die weiblichen Dienstboten gern gleich das Schlimmste, sie meinen sich dadurch eine Art Wichtigkeit zu geben. Wenn Jemand im Hause krank ist, so werden sie sicher seinen Tod prophezeien, wenn ein Edelstein verloren ist, so werden sie ganz gewiß prophezeien, daß er nicht wiedergefunden werden wird.«
Diese Art, die Sache anzusehen, welche ich, offen gestanden, bei näherer Erwägung selbst für die richtige hielt, schien Herrn Franklin bedeutend zu erleichtern. Er legte sein Telegramm zusammen und ließ den Gegenstand fallen.
Auf meinem Wege nach dem Stall, wo ich den Ponywagen anspannen lassen wollte, warf ich im Vorbeigehen einen Blick in das Domestikenzimmer, wo die Leute gerade bei Tische saßen; Rosanna Spearman war nicht unter ihnen; als ich mich nach ihr erkundigte, erfuhr ich, daß sie plötzlich unwohl geworden und aus ihr Zimmer gegangen sei, um sich zu Bette zu legen.
»Sonderbar,« bemerkte ich, »sie schien vorhin noch ganz wohl.«
Penelope kam heraus, um mit mir zu gehen. »Bitte Vater,« sagte sie, »sprich nicht so vor den übrigen Leuten. Sie werden dadurch nur in ihrem Mißtrauen gegen Rosanna bestärkt. Das arme Ding härmt sich über Herrn Franklin Blake.«
Von dieser Seite hatte ich das Benehmen des Mädchens noch nicht angesehen. Wenn Penelope Recht hatte, so ließe sich Rosanna’s auffallendes Betragen und ihre sonderbare Sprache genügend dadurch erklären, daß sie in den Tag hineinredete, so lange sie nur Herrn Franklin dahin bringen konnte, sich mit ihr zu unterhalten. Wenn das die richtige Lösung des Räthsels war, so ließ sich damit auch vielleicht ihr übermüthiges Benehmen gegen mich, als sie mir in der Halle begegnete, erklären. Wenn er nur drei Worte mit ihr gesprochen, so hatte sie doch ihren Zweck erreicht —- er hatte sich mit ihr unterhalten.
Ich ließ das Pony anschirren. In der Stimmung, in die mich das höllische Netz von Geheimnissen und Ungewißheiten versetzte, in das wir verstrickt waren, empfand ich es als eine Wohlthat, zu beobachten, wie vortrefflich sich die Riemen und Schnallen des Pferdegeschirrs ineinanderfügten. Wenn man das Pony zwischen die Deichsel gespannt sah, so hatte man einen vollkommen klaren und sicheren Anblick vor sich und das war, wie ich den Leser versichern kann, in unserem Hause nachgerade einer der seltensten Genüsse geworden.
Als ich den Wagen vor die Hauptthür führte, fand ich nicht nur Herrn Franklin, sondern auch Herrn Godfrey und den Oberbeamten Seegreaf auf den Stufen der Treppe meiner wartend. Weiteres Nachdenken hatte den Herrn Oberbeamten, nachdem er in den Zimmern und Sachen der Domestiken vergeblich nach dem Diamanten gesucht, allem Anschein nach zu einem neuen Beschluß geführt. Indem er immer noch bei seiner Ansicht, daß Jemand im Hause den Edelstein gestohlen habe, beharrte, war unser erfahrener Beamter jetzt weiter zu dem Schluß gelangt, daß der Dieb (er hütete sich wohl, Penelope zu nennen, wenn er auch vielleicht an sie dachte) im Einverständnis mit den Indiern gehandelt habe, und proponirte demgemäß seine Untersuchungen jetzt auf die Jongleurs im Gefängnis von Frizinghall zu erstrecken. Als Herr Franklin von dieser neuen Wendung der Angelegenheit gehört, hatte er sich erboten, den Beamten nach der Stadt zu fahren, von wo aus er ebenso leicht wie von der Station nach London telegraphieren konnte. Herr Godfrey, der noch ebenso fest wie früher an Herrn Seegreaf glaubte und lebhaft wünschte, dem Verhör der Indier beizuwohnen, hatte um Erlaubnis gebeten, den Beamten nach Frizinghall begleiten zu dürfen.
Einer der beiden unteren Polizeibeamten sollte für den Fall, daß sich inzwischen irgend etwas ereignete, bei uns bleiben, der andere sollte mit dem Oberbeamten nach der Stadt zurückkehren. So waren also die vier Plätze im Ponywagen gerade besetzt. Bevor er die Zügel ergriff, um wegzufahren, nahm Herr Franklin mich noch einen Augenblick bei Seite.
»Ich werde mit dem Telegraphieren nach London warten,« sagte er, »bis ich sehe, was das Verhör der Indier ergiebt. Nach meiner festen Überzeugung tappt dieser dickköpfige Lokal-Polizeibeamte noch eben so sehr im Dunkeln wie früher und will nur Zeit gewinnen. Die Idee, daß irgend Jemand von unseren Domestiken mit den Indiern im Bunde sei, ist meiner Ansicht nach eine unerhörte Albernheit. Halten Sie sich zu Hause, Betteredge, bis ich zurückkomme, und sehen Sie zu, ob Sie über Rosanna Spearman in’s Klare kommen können. Ich verlange von Ihnen nichts, was Sie in Ihrer eigenen Achtung herabsetzen oder das arme Mädchen schwer kränken müßte. Ich bitte Sie nur, sie schärfer als gewöhnlich zu beobachten. Wir wollen die Sache vor meiner Tante so leicht wie möglich nehmen, aber sie ist von größerer Bedeutung, als Sie denken.«
»Ich weiß,« sagte ich, in der Meinung, daß er von dem Werth des Diamanten rede, »daß es sich um 20,000 Pfund handelt.«
»Es handelt sich vielmehr darum, Rachels Gemüth zu beruhigen,« erwiderte Herr Franklin, »ich bin sehr besorgt um sie.«
Mit diesen Worten ließ er mich plötzlich stehen, wie wenn er jede weitere Unterhaltung zwischen uns abschneiden wollte. Ich glaubte seine Gründe zu verstehen. Eine Fortsetzung unseres Gesprächs hätte mir vielleicht Das offenbaren können, was Fräulein Rachel ihm auf der Terrasse anvertraut hatte. Und so fuhren sie ab nach Frizinghall.
Ich wünschte in Rosanna’s eigenem Interesse ein Paar Worte im Vertrauen mit ihr zu reden, aber die passende Gelegenheit wollte sich nicht darbieten. Sie kam erst zur Theestunde wieder hinunter; sie war unruhig und aufgeregt bekam, wie sie es nennen, einen hysterischen Anfall, mußte auf Mylady’s Ordre etwas flüchtiges Salz nehmen und ward wieder zu Bett geschickt. Der Tag schleppte sich trübselig hin; Fräulein Rachel blieb auf ihrem Zimmer und erklärte, sie sei zu krank, um zum Essen herunter zu kommen. Mylady war so bekümmert über ihre Tochter, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, ihre Besorgnis noch durch den Bericht über das zu steigern, was Rosanna zu Herrn Franklin gesagt hatte. Penelope beharrte bei dem festen Glauben, daß ihr demnächst der Proceß gemacht und sie wegen Diebstahls verurtheilt und transportiert werden würde. Die andern weiblichen Domestiken nahmen ihre Zuflucht zu ihren Bibeln und Gesangbüchern und sahen essigsauer dabei aus, wie es nach meiner Beobachtung meistens den Leuten zu begegnen pflegt, wenn sie sich zu ungewohnten Tageszeiten frommen Übungen hingeben. Ich selbst konnte mich nicht einmal dazu entschließen, meinen Robinson Crusoe aufzuschlagen. Ich ging in den Hof und setzte, da mich sehnlichst nach ein wenig heiterer Gesellschaft verlangte; meinen Stuhl an das Hundehaus und unterhielt mich mit den Hunden. Eine halbe Stunde vor Tischzeit kamen die beiden Herren von Frizinghall zurück, wo sie mit dem Oberbeamten Seegreaf verabredet hatten, daß er am nächsten Tage wieder zu uns kommen sollte. Sie hatten Herrn Murthwaite, dem indischen Reisenden, in seiner Wohnung in der Nähe der Stadt einen Besuch gemacht. Auf Herrn Franklin’s Ersuchen hatte er sich bereit finden lassen, ihnen mit seiner Kenntnis des Indischen behilflich zu sein, indem er als Dolmetscher bei den beiden Indiern, die kein Englisch verstanden, fungierte. Die sehr gründliche und langdauernde Untersuchung hatte zu nichts geführt, indem sie auch nicht den Schatten eines Anhaltspunktes für die Annahme ergab, daß die Jongleurs im Einverständnis mit unseren Domestiken ständen. Nach diesem negativen Resultat hatte Herr Franklin sein Telegramm nach London abgesandt, von wo wir erst morgen weitere Nachrichten erwarten konnten.
So viel über die Geschichte des Tages, welcher dem Geburtstage folgte.