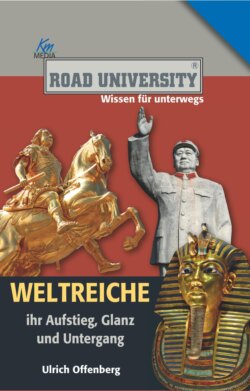Читать книгу Weltreiche - Ulrich Offenberg - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Hethiter – das Volk der 1000 Götter
ОглавлениеWie so viele Völker des Altertums sind auch die Hethiter nach dem Untergang ihres Reiches in Vergessenheit geraten. Bis in die Neuzeit waren sie nur durch einige Erwähnungen aus der Bibel ein Begriff und wurden als unbedeutende Volksgruppe im syrischpalästinischen Raum genannt. Dabei erstreckte sich ihr Herrschaftsgebiet vor allem in der heutigen Türkei bis weit in den Süden Syriens hinein.
„Und David zeugte Salomo aus der Frau des Urias“ schreibt der Evangelist „Matthäus“ im Stammbaum Jesu. Der Name der Frau ist gut bekannt: „Bat-Seba“. Der besitzergreifende König der Juden ließ den gehörnten Hethiter-Offizier Urias umbringen, um Bat-Seba seinen Harem einverleiben zu können. Das störte allerdings die Beziehungen der beiden Reiche nicht. Rüsteten sie doch gegen einen gemeinsamen Feind, der sie gleichermaßen bedrohte: Die „Assyrer“.
Während die Geschichte der Juden durch das „Alte Testament“ überliefert wurde, blieb das Schicksal der Hethiter lange Zeit im Dunkeln. Nur spärlich stießen Archäologen auf Hinweise dieses geheimnisvollen Volkes.
Im ersten Viertel des 2. Jahrtausends vor der Zeitenwende wurde Zentralanatolien von Königen in Stadtstaaten regiert. In dieser etwa 200 Jahre andauernden Epoche unterhielten die Provinzherrscher Handels- und kulturelle Beziehungen mit den Vertretern der alten Hochkulturen im Nahen Osten. Korrespondiert wurde in assyrischer Keilschrift. Die meisten dieser Städte waren mit monumentalen Stadtmauern, Palästen und Tempeln ausgestattet. „Nesa“, das heutige „Kültepe“, war die erste Hauptstadt des Hethiterstaates. Der Legende nach, die auf Keilschrifttafeln aus dem 16. Jahrhundert v. Chr. nieder geschrieben wurde, gebar die Königin von Nesa in einem einzigen Jahr 30 Söhne. Sie war entsetzt über diese Widernatürlichkeit, dichtete Körbe mit Fett ab, legte ihre Söhne hinein und ließ sie in den Fluss gleiten. Die Strömung brachte die Knaben zum Meer und weiter in das Land „Zalpa“. Dort nahmen die Götter die Neugeborenen auf und zogen sie groß. Wie nun die Jahre vergingen, gebar die Königin wieder, dieses Mal 30 Töchter. Diese zog sie selbst groß. Weiter berichtet der uralte Text, dass die 30 Söhne, als sie erwachsen waren, nach „Nesa“ zurück kamen. Die Götter schenkten ihnen ein anderes Wesen, so dass ihre Mutter sie nicht erkannte und ihnen ihre 30 Töchter zur Frau gab. Der jüngste der Söhne erkannte aber, dass es die eigenen Schwestern waren und warnte seine Brüder davor, die Frauen anzurühren. Hier bricht der historische Text ab. Dem Gründermythos nach können aber die 30 Söhne und 30 Töchter als die Stammeltern der Hethiter gelten.
Zalpa liegt an der Mündung des „Halys“ am Schwarzen Meer, Nesa dagegen am Oberlauf dieses Flusses. Will man hinter diesem Mythos eine Anspielung auf historische Gegebenheiten vermuten, so kann es sich bei der Rückwanderung der 30 Söhne von Zalpa in ihren Geburtsort um den Hinweis auf eine Besiedelung handeln. Eroberungszüge von Völkern wurden auf diese Weise moralisch gerechtfertigt. Es kann daher durchaus sein, dass die ersten Hethiter von der Küste des Schwarzen Meeres aufbrachen und ins Innere Anatoliens, nach „Nesa“, gewandert sind und sich dort ansiedelten. Eine andere Quelle zur Vorgeschichte der Hethiter ist der sprachliche Aufbau ihrer Personen- und Götternamen. Die Menschen verständigten sich in einer indogermanischen Sprache. „Wasser“ hieß bei ihnen „wadar“ und „sieben“ „siptam“. Die indogermanische Sprachfamilie hatte sich aus den Weiten nördlich des Schwarzen Meeres, unter anderem in Richtung Westeuropa und Indien ausgebreitet.
Der oberste Herr des Götterhimmels war „Djeus“, der Gott des lichten Taghimmels. Die Ähnlichkeit zum griechischen „Zeus“, zum lateinischen „Jupiter“ und zum altindischen „Dyaus“ ist gewiss nicht zufällig. Seine Söhne waren ein Zwillingspaar, die „Dioskuren“. Dann gab es da die junge Göttin „Ausos“, die Morgenröte, ein recht freizügiges Mädchen. Sie soll die Tochter des Sonnengottes „Saweljos“ gewesen sein. Die Dioskuren entführten sie auf ihrem Wagen.
Außerhalb dieser Familien existierten noch andere Götter, wie der Wettergott „Perkwunos“ oder der Vegetationsgott „Suwaliyatt“. Er fungierte auch als Bote des Wettergottes, so wie im griechischen „Hermes“ als Bote des Zeus. Verehrungswürdig waren auch die „Damnassra“-Gottheiten, Beschützerinnen des Hauses, deren Name von „dom“ – also Haus abgeleitet ist.
Während des 17. und 16. Jahrhunderts v. Chr. hatten sich die Hethiter in Anatolien als führende Macht etabliert. Ein kriegerischer Herrscher mit dem Namen „Labarna“, der seine Residenz in „Hattusa“ nahm und sich fortan „der von Hattusa“ – „Hattusili“ – nannte, war die treibende Kraft eines hethitischen Großreiches geworden. Nachdem „Hattusili“ eine ganze Anzahl von Orten in Zentralen-Anatolien unterworfen hatte, war die Überquerung des Taurus eine neue Herausforderung.
Südlich des Gebirgszuges lagen die reichen nordsyrischen Anbaugebiete mit dem Zentrum „Aleppo“, in dem es zudem ein bedeutendes Heiligtum des hoch verehrten Wettergottes gab. So soll es nach einer Überlieferung sogar der Allgewaltige selbst gewesen sein, der den hethitischen Kriegern bei der Überschreitung des Gebirges half. Durch diesen siegreichen Feldzug gewann „Hattusili“ an Ansehen und Macht. Der hethitische Einfluss dehnte sich nachfolgend bis in das nördliche Mesopotamien aus, wobei es zu erbitterten Kämpfen mit den „Hurritern“ kam, ein bereits seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. bezeugtes, von Südostkleinasien und Nordsyrien bis nach Obermesopotamien verbreitetes Volk, mit dessen Staatsgründungen sich die Hethiter immer wieder auseinander setzen mussten.
Zu seinem Nachfolger bestimmte Hattusili den noch jungen „Mursili I.“. Ihm gelang es, die Hauptstadt des Königreichs „Jamhad“, – Halab“ – zu erobern. Hethitische Truppen marschierten sogar bis nach Babylon, der einstigen Residenzstadt des Königs „Hammurapi“. Wer diese legendäre Stadt eroberte, konnte zweifellos einen bedeutenden Zuwachs an Prestige verbuchen. Doch lange konnte sich der König nicht in seinem kriegerischen Ruhm sonnen: Bei einer Verschwörung, an der sich auch sein Schwager „Hantili“ beteiligte, wurde er ermordet.
Auf den Mord an „Mursili I.“ folgten innerdynastische Auseinandersetzungen. Erst König „Telipinu“ gelang es Jahrzehnte später, wieder Stärke zu demonstrieren. Er berief in Hattusa eine Ratsversammlung ein und verkündete eine Reihe von Reformen. Diese hatten vor allem das Ziel, das Königshaus vor weiteren Morden zu schützen, eine Thronfolgeregelung festzulegen und die Einigkeit an der Spitze des Staates zu fördern.
Einem Gremium, dem so genannten „panku“, wurde eine wichtige Rolle übertragen. Es sollte bei Bluttaten innerhalb des Königshauses die Bestrafung der Schuldigen veranlassen, nicht aber Rache an deren Familien und „ihren“ Häusern, also Verwandten, nehmen. Außerdem sollte es auch an der Rechtsprechung über die verschiedenen Würdenträger beteiligt sein.
Neben diesen Maßnahmen zum Schutze des Königtums wurde auch die Versorgung der Städte mit Wasser und Getreide neu geregelt. Betrug bei der Ablieferung der Ernte sollte mit dem Tode geahndet werden. Zur Vermeidung einer Zersplitterung von Familienbesitz wurde untersagt, Erben vorzeitig ihre Anteile auszuhändigen. Bei einer Bluttat konnte das Familienoberhaupt des Opfers darüber entscheiden, ob der Schuldige mit dem Tode bestraft werden sollte oder nur Ersatz zu leisten hatte.
Mit König „Telipinu“ beginnt das so genannte „Mittlere Reich“. Häufig bezeugt sind jetzt Landschenkungen an Würdenträger, die durch Formulierungen wie diese geschützt werden sollten: „Die Worte des Tabarna, des Großkönigs, sind von Eisen. Sie sind nicht zu verwerfen, nicht zu zerbrechen. Wer sie vertauscht, dem wird man sein Haupt abschlagen.“
So steht es in Keilschrift auf archäologischen Fundstücken.
In einer Zeit innerdynastischer Auseinandersetzungen sollten die jeweiligen Nutznießer der Schenkungen sicher enger an das Königshaus gebunden werden. Diese Kämpfe um die Macht trugen dazu bei, dass die hethitischen Herrscher die Kontrolle über die Gebiete südlich des Taurus wieder verloren. Erst „Tuthalija I.“ scheint die großkönigliche Macht wieder unumschränkt hergestellt zu haben. Dennoch blieb seine Herrschaft im Wesentlichen auf Anatolien beschränkt. Das Obermesopotamische „Mitanni-Reich“ übte weiterhin die Kontrolle über das nördliche Syrien aus, und die Pharaonen der 18. Dynastie vermochten ihren Einfluss zumindest bis Mittelsyrien zu erhalten.
Erst unter der Herrschaft von „Suppiluliuma I.“ vollzogen sich Veränderungen, die das zuvor auf Anatolien beschränkte hethitische Reich zu einem Imperium werden ließen, zu dem auch Teile Syriens und Mesopotamiens gehörten. Diese neue Phase, auch „Neues Reich“ genannt, wurde durch einen Feldzug des Königs im Gebiet des oberen Euphrat eingeleitet. „Suppiluliuma“ stieß auf keinen nennenswerten Widerstand. Der König von Ugarit, „Niqmadu II.“ stellte sich sogleich unter seinen Schutz. Wichtige Hafenstädte kamen unter hethitische Kontrolle.
Das Heer drang weiter nach Süden vor, besiegte das Land „Nija“ am Orontes, plünderte die Stadt „Qatna“, vermied aber einen Angriff auf die Stadt „Kadesch“, die unter ägyptischer Oberhoheit stand. Der Fürst von Kadesch war aber so unvorsichtig die schützenden Mauern seiner Stadt zu verlassen. In einer offenen Feldschlacht wurde er von den Hethitern besiegt und gefangen genommen. Sein Sohn „Aitaggama“ bestieg daraufhin den Thron von Kadesch.
Durch die erfolgreichen militärischen Aktionen in Syrien war aus dem hethitischen Staat ein Großreich entstanden, das sich mit dem der ägyptischen Pharaonen und dem der Könige von Assur und Babylons auf eine Stufe stellen konnte.
Nach dem frühen Tode des Pharaos „Tutanchamun“ war in Ägypten ein Machtkampf ausgebrochen. Die junge Witwe des Pharao bat den Hethiterkönig „Suppiluliuma I.“ brieflich um die Entsendung eines seiner Söhne, den sie heiraten wolle, um nicht einen „Diener“ als Gatten nehmen zu müssen. Eine ungeheure, von einer Ägypterin königlichen Geblüts nie zuvor geäußerte Werbung um einen ausländischen Bräutigam. Auch der Hethiter-König war von dieser Hochzeits-Werbung überrascht. Er bat um eine erneute Bestätigung und schickte schließlich einen seiner Söhne nach Memphis.
Kostbare Zeit war verstrichen. Die Feinde der Pharaonen-Witwe hatten sich formiert. Der Prinz starb auf der Reise an den Nil unter ungeklärten Umständen. Das nahm „Suppiluliuma I.“ zum Anlass, dem neuen Pharao „Eje“ den Krieg zu erklären. Auch wenn es nicht sofort zu direkten Auseinandersetzungen kam, so herrschte doch fortan Feindschaft zwischen diesen beiden Mächten. Die letzten Jahre seiner Regierung verbrachte „Suppiluliuma I.“ damit, die Position des Königshauses in Anatolien zu verteidigen und zu stärken. Vor allem die stets unruhigen „Kaskäer“ im Norden des Reiches hatten die längere Abwesenheit des Großkönigs in Syrien genutzt, um Überfälle auf hethitisches Gebiet zu unternehmen. Aber auch ein ganz anderes Problem machte dem Großkönig zu schaffen: Eine Epidemie, vermutlich die Beulenpest, war aus Syrien eingeschleppt worden und forderte auch im Königshaus zahlreiche Opfer. Die Seuche wurde von den Untertanen als göttliche Strafe dafür verstanden, dass „Suppiluliuma I.“ bei seinem Weg auf den Thron sehr skrupellos vorgegangen war. Aus Rache hätten die Götter nicht nur den König sterben lassen, sondern auch seinen Sohn und kurzzeitigen Nachfolger „Arnuwanda II.“.
Vor allem dem Gouverneur der wichtigen „Unteren Länder“, „Hannutti“, sowie dem Fürsten „Pijasili von Karkamis“ dürfte es zu verdanken gewesen sein, dass das hethitische Reich nicht schon damals den Angriffen der Nachbarn zum Opfer fiel. Zumal Arnuwandas Nachfolger „Mursili“ noch jung war und wenig Erfahrung besaß. Doch der junge König lernte schnell, vergaß nicht den Göttern zu opfern und schlug lokale Aufstände rasch und blutig nieder. Seine zwei Jahrzehnte währende Herrschaft konsolidierte das Reich der Hethiter wieder. Prinz „Muwattalli“ konnte ohne größere Schwierigkeiten die Nachfolge seines Vaters „Mursili“ antreten. Auf den Wänden der ägyptischen Tempel in Abydos, Luxor und Abu Simbel sind noch heute Reliefs zu sehen, die eine der berühmtesten Schlachten des orientalischen Altertums zeigen. Sie werden von hieroglyphischen Texten begleitet, die einen großen Sieg des Pharaos „Ramses II.“ über den Hethiterkönig „Muwattalli“ feiern: Die Schlacht von Kadesch. Trotz eines möglicherweise sehr tapferen Einsatzes des Pharaos waren die Hethiter jedoch nach dem Kampf im Vorteil und damit die eigentlichen Sieger. Das zwischen Hethitern und Ägyptern umstrittene mittelsyrische „Amurru“ gelangte jedenfalls wieder unter hethitische Kontrolle.
War Ägyptens Vordringen in das hethitisch beherrschte Syrien nach der Schlacht von Kadesch zurück gewiesen worden, so gestaltete sich die Situation an der Euphrat-Grenze weniger günstig. Die Assyrer hatten ihren Einfluss in Obermesopotamien ausgeweitet und provozierten damit ganz offen König Muwattalli. Dem Reich der Hethiter schien niemals eine längere Periode des Friedens vergönnt gewesen zu sein.
Vielleicht haben die Expansionsgelüste des assyrischen Reiches dazu geführt, dass „Hattusili III.“, der Enkel von „Muwattalli“, sich nun veranlasst sah, den Ausgleich und einen Frieden mit Ägypten anzustreben. Dort regierte immer noch Pharao „Ramses II.“. Nun schien es an der Zeit, den seit der Regierung „Suppiluliumas I. „bestehenden latenten Kriegszustand mit Ägypten zu beenden. Der Abschluss des berühmten Staatsvertrages wurde von einer in babylonischassyrischer Sprache geführten Korrespondenz begleitet, in der beide Seiten ihre Genugtuung über das „brüderliche“ Verhältnis zueinander zum Ausdruck brachten und die aus diesem Anlass fälligen gegenseitigen Geschenke absprachen. Dies ist der erste internationale Friedensvertrag, der in seinem Wortlaut bekannt ist. Er stellt die Absicht heraus, die frühere Freundschaft zwischen Ägypten und dem hethitischen Reich wieder aufzunehmen und Frieden und Bruderschaft zwischen ihren Königen „auf ewig“ festzuschreiben.
Er enthält schließlich ein Nichtangriffsversprechen, die Zusage gegenseitiger Unterstützung gegen äußere und innere Feinde und eine Garantie des Pharaos für die Thronfolge des Sohnes „Hattusilis III.“. Weiterhin wird die Auslieferung sowohl hochrangiger als auch einfacher ägyptischer wie hethitischer Gefangener vereinbart, sowie deren Amnestie. Der Vertrag schließt mit einer Liste der Schwurgötter und der Segnung dessen, der den Vertrag einhält, sowie der Verfluchung des Partners, der sich einer Verletzung des Vertrages schuldig macht. Als Krönung dieses Friedensvertrages durfte der Pharao, längst kein junger Mann mehr, auch noch die älteste Tochter des Großkönigs in sein Schlafgemach führen. Dieser geschickte diplomatische Schachzug stärkte die Position Hattusilis gegenüber seinen Konkurrenten – Assyrien, Babylonien und dem ägäischen „Ahhijawa“.
Doch die Atempause war nur von kurzer Dauer. Zwar war der Friedensvertrag mit Ägypten ein Höhepunkt in der Geschichte der hethitischen Diplomatie, aber gleichzeitig war er auch ein Signal der Schwäche und des Niedergangs. Dynastische Fehden verunsicherten die Bevölkerung. Der Großkönig „Arnuwanda III.“ starb ohne einen Erben zu hinterlassen. In den Provinzen brachen Unruhen aus, lokale Fürsten probten den Aufstand. Die kriegerischen Assyrer drängten die hethitischen Truppen an vielen Orten über den Taurus zurück.
Aus der königlichen Familie bestieg daraufhin ein Mann den Thron, der den ruhmreichen Namen des Begründers des hethitischen Großreiches trug: „Suppiluliuma“. Ausgerechnet ihm war es beschieden, das Ende des Imperiums einzuläuten. Allerdings ist bis heute unklar, was wirklich den Untergang dieses Großreiches kurz nach 1200 v. Chr. bewirkte. Wahrscheinlich waren es mehrere Faktoren, die dazu beitrugen.
Hungerrevolten der Bevölkerung und Auseinandersetzungen innerhalb der Aristokratie hatten sich bereits während der letzten hethitischen Großkönige abgezeichnet. Texte aus den letzten Jahrzehnten des Hethiter-Staates bezeugen umfangreiche Importe von Getreide aus Syrien und Ägypten nach Anatolien.
Es scheint aber inzwischen sicher, dass das Ende des hethitischen Reiches in einem größeren Zusammenhang zu sehen ist. Die so genannten „Seevölker“ plünderten am Ende der späten Bronzezeit die Länder und Inseln im Mittelmeer-Raum. Selbst dem mächtigen Ägypten gelang es nur unter größten Anstrengungen, ihre Attacken abzuwehren.
Das geschwächte Reich der Hethiter aber, gebeutelt von Miss-Ernten und erschöpft durch innere Zwistigkeiten, brach unter dem Druck dieser wilden Völker zusammen. Der hethitische Staat in Klein-Asien hörte in kürzester Zeit auf zu bestehen. Er verschwand so gründlich aus dem schriftlichen Gedächtnis der nachfolgenden Jahrtausende, dass er erst durch die Ausgrabungen und Textfunde des 20. Jahrhunderts wieder zu einem Kapitel in der Menschheitsgeschichte werden konnte.