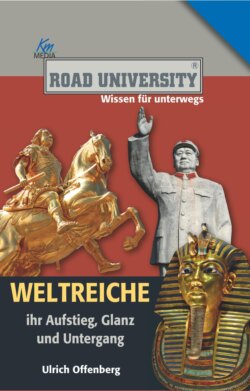Читать книгу Weltreiche - Ulrich Offenberg - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Assyrer – die Preußen des Orients
ОглавлениеGegen Ende des 2. Jahrtausends v. Chr. bestieg „Tiglatpileser I.“ den assyrischen Thron. Ein Herrscher, der eine aggressive Expansionspolitik betrieb. Zunächst konzentrierte er sich auf die Feinde im Norden. Doch dann überfiel der babylonische König „Marduknadinachi“ die assyrische Stadt „Ekallate“. Dies war so tollkühn, als würde man einen Löwen am Schwanz ziehen. Die Assyrer straften den südlichen Nachbarn mit verheerenden Feldzügen, im Land brach eine entsetzliche Hungersnot aus.
Was aus dem König wurde, der die Assyrer so gereizt hatte, ist in keiner Urkunde erwähnt.
Aber so richtig bekamen die Völker Mesopotamiens den aggressiven Militarismus der Assyrer erst unter König „Tukultininurta II.“ zu spüren. Sein Sohn und Nachfolger „Assurnassirpal II.“ – er herrschte von 883 – 859 v. Chr. – vollendete, was der Vater begonnen hatte. Unter seiner Herrschaft expandierte das Land im Westen bis ans Mittelmeer und eroberte die Gebiete am Oberlauf des Tigris bis zur Quelle. Der König verlegte seine Residenz in die Stadt „Kalchu“, die „Salamanassar I.“ 400 Jahre zuvor gegründet hatte.
Über weite Teile des 9. Jahrhunderts v. Chr. bestanden – der kriegerischen Vergangenheit zum Trotz – offenbar diplomatische und sogar freundschaftliche Beziehungen zwischen Babylonien und Assyrien. Als gegen Ende des Jahrhunderts eine Revolution Assyrien ins Chaos stürzte, half Babylonien dem neuen König, „Schamschiadad V.“ – 823 – 811 v. Chr. – die Ordnung wieder herzustellen, verlangte dafür aber eine hohe Gegenleistung. Schamschiadad marschierte daraufhin in Babylonien ein, schlug den dreisten Forderer vernichtend und erklärte sich zum neuen Herrscher.
Bei seinen Entscheidungen unterstützte ihn seine Respekt einflößende Gemahlin „Sammuramat“. Unter ihrem griechischen Namen „Semiramis“ wird sie von dem Historiker „Diodor“ im 1. Jahrhundert v. Chr. in seinen Annalen als schöne und kluge Frau gefeiert. Nach dem Tod ihres Mannes 811 v. Chr. regierte sie fünf Jahre lang im Namen ihres minderjährigen Sohnes und gab eigene politische Erklärungen ab, die Vorrang vor denen des jungen Königs hatten. Sie war so angesehen, dass man zu ihrem Andenken eine Stele errichtete.
Die assyrische Gesellschaft war ausgesprochen militant. Assurnassirpals Sohn „Salmanassar III.“ – 859 – 824 v. Chr. – führte während seiner 35jährigen Regentschaft 31 Jahre lang Krieg. Alle wehrfähigen Männer wurden zum Militärdienst heran gezogen. Die Armee bildete das Rückgrat des Staates und prägte seine Struktur und Hierarchie. Vom König erwartete man, dass er sein Heer persönlich in die Schlacht führte. Militärs übernahmen auch die Aufgaben von Provinzstatthaltern und Richtern. Zumindest zu Beginn dieser Periode fanden alle Feldzüge im Sommer statt, nachdem die Ernte eingebracht worden war. Stehende Heere entstanden erst später. Dennoch konnte Assyrien eine bis zu 50.000 Mann starke Armee ins Feld schicken. Wenn die eigene Wehrkraft nicht ausreichte, rekrutierte man Ausländer. Häufig waren das Spezialisten wie Wagenlenker aus Samarien oder Seeleute aus Phönizien.
Die militärische Taktik war simpel und brutal. Sie zielte darauf ab, die assyrischen Truppen zu schonen. Dabei rückten die Assyrer mit einem massiven Truppenaufgebot gegen ein Gebiet vor. Wenn der dortige Herrscher nicht kapitulierte, drängten Gesandte die örtliche Bevölkerung, zu den Assyrern überzulaufen. Wenn diese Taktik fehl schlug, griffen die Assyrer verwundbare Ziele wie Dörfer und Kleinstädte an, zerstörten sie, folterten, vergewaltigten, verstümmelten und verbrannten die Einwohner, streuten Salz auf ihre Felder und entwurzelten die Obstbäume.
Meist genügten solche Maßnahmen, um den Gegner einzuschüchtern und zur Kapitulation zu bewegen. Falls sie einmal doch nicht ausreichten, waren die örtlichen Streitkräfte der assyrischen Militärmaschinerie selten gewachsen. Langwierige Belagerungen, nur mit hohem Kostenaufwand aufrechtzuerhalten, waren in der Regel erst das letzte Mittel. Die Assyrer ließen aber keinen Zweifel daran, dass sie nach dem Fall einer belagerten Stadt keine Gnade walten lassen würden, nicht einmal gegenüber den Kindern. Massendeportationen sorgten dafür, dass es nach der Eroberung in den jeweiligen Gebieten nicht zu Aufständen kam. Diese Migranten stärkten Assyriens Bevölkerung und Wehrkraft. Deportationen gehörten auch zum üblichen Vorgehen der chaldäischen Könige, die nach dem Fall Assyriens herrschten.
Bei der Thronfolge fiel die Krone nicht zwangsläufig an den ältesten Sohn, sondern an den fähigsten. Sobald der neue König gewählt war, wurde er im Thronfolgerhaus unterrichtet. Er erhielt eine Ausbildung in Kriegskunst und Diplomatie, absolvierte ein anstrengendes körperliches und militärisches Training und lernte Jagen, Schreiben sowie, wenn er sehr begabt war, Fremdsprachen. Unabhängig davon, wo ein König seine Residenz hatte, wurde er in „Assur“, der Stadt der Vorfahren, beigesetzt.
Nach einer vorübergehenden Schwächephase führte „Sargon II.“ – 721 – 705 v. Chr. – das Reich zu neuer Stärke. Die Politik seiner 16jährigen Regierungszeit war von dem erfolgreichen Bemühen geprägt, sein Reich in Ordnung zu bringen. Er konsolidierte die militärischen Erfolge seines Vaters, zerschlug das armenische Königreich „Urartu“, dehnte sein Herrschaftsgebiet im Osten nach „Elam“ und im Westen in die Levante aus und brachte Assyrien eine Blütezeit, wie das Reich sie zuletzt unter „Assurnassirpal“ erlebt hatte. Die Herrschaft „Saigons II.“ fand ein abruptes Ende, als er 705 v. Chr. auf einem Feldzug in Kleinasien fiel.
Sein Sohn und Nachfolger „Sanherib“ verlegte seine Residenz von Sargons unvollendeter Stadt „Dur-Scharrukin“ nach „Ninive“, das auf eine 3000jährige Geschichte zurück blicken konnte. Mit diesem Schritt konnte er sich von seinem Vater distanzieren, dessen Kriegstod, wie üblich, als schlechtes Omen galt. Vielleicht hatte diese Entscheidung aber auch politische Gründe. Ninive besaß einen hohen Symbolwert für die Armee. Hier hatte „Assurnassirpal“ seine Feldzüge begonnen, und hierher sandten eroberte Länder ihre Tributzahlungen.
Da Sanherib mit Aufständen in der Levante und Judäa zu kämpfen hatte, herrschten in Babylonien für einige Zeit politisch instabile Verhältnisse. Dies versuchte sich der babylonische Regionalfürst „Mardukapaliddina“ zu nutzte zu machen und sich zum Herrscher über Assyrien und Babylonien aufzuschwingen. In zwei Strafaktionen vertrieb „Sanherib“ ihn 700 v. Chr. endgültig und machte seinen ältesten Sohn zum König Babyloniens. Kronprinz „Assurnadinschumi“ regierte sechs Jahre in relativen Frieden. Die Ostgrenzen wurden aber weiter von den „Elamitern“, ehemalige Verbündete „Mardukapaliddinas“, bedroht. „Sanherib“ ließ von Phöniziern in Ninive eine Flotte bauen, segelte flussabwärts an die Küste des Persischen Golfs, griff die Elamiter an und schlug sie vernichtend. Das genügte jedoch nicht. Denn während „Sanherib“ im Süden kämpfte, wurde sein Sohn in Babylon ermordet und durch einen Marionettenkönig der Elamiter ersetzt. Dieser wurde nach einigen Monaten wiederum von einem König gestürzt, der die Unterstützung der „Aramäer“ hatte. Er hielt sich drei Jahre auf dem Thron, bis „Sanherib“ Babylon 689 v. Chr. stürmte und die Stadt dem Erboden gleich machte.
Triumphierend diktierte der siegreiche König seinen Schreibern: „Wie ein Wirbelwind griff ich die Stadt an und fiel wie ein Sturm über sie her … Ich verschonte ihre Bürger nicht, weder Jung noch Alt, und füllte die Straßen mit ihren Leichen … Ich zerstörte die Stadt und ihre Häuser von den Grundmauern bis zu den Dächern. Mit Feuer brannte ich sie nieder … damit in Zukunft selbst der Grund ihrer Tempel in Vergessenheit gerät, mit Wasser verwüstete ich sie und verwandelte sie in Weideland.“
Anschließend übernahm er den Königstitel von Babylonien selbst, vertraute aber die Verwaltung des Landes seinem Sohn „Asarhaddon“ an. „Sanherib“ wurde 681 v. Chr. von zwei seiner Söhne ermordet. Nach einem Machtkampf unter seiner Nachkommen trat schließlich „Asarhaddon“, den „Sanherib „testamentarisch zu seinem Erben bestimmt hatte, seine Nachfolge an. Der baute Babylon, dessen Zerstörung von den Zeitgenossen als großes Sakrileg empfunden wurde, in alter Pracht wieder auf. Er war mit einer Babylonierin verheiratet und hatte während seiner achtjährigen Amtszeit als Statthalter Babyloniens die Landestraditionen schätzen gelernt. Sein Versöhnungs- und Wiederaufbauprogramm war jedoch auch durch Omen motiviert, die ihm ein schlimmes Schicksal voraus sagten, falls er eine andere Politik verfolgen sollte.
Sobald die Ruhe in Babylonien wieder hergestellt war, griff „Asarhaddon“ Ägypten an, das damals gegenüber seinen Glanzzeiten erheblich an Stärke eingebüßt hatte. Nach ersten, spektakulären Erfolgen erkrankte der Herrscher und starb 669 v. Chr., als er mit seinem Heer erneut gegen Ägypten zog, um Pharao „Taharka“ aus Memphis zu vertreiben, das dieser zurück erobert hatte, nachdem ihn die Assyrer in früheren Kriegen nach Süden abgedrängt hatten. „Assarhaddon“ hatte zu Lebzeiten seinen jüngeren Sohn „Assurbanipal“ zu seinem Nachfolger als König von Assyrien bestimmt. Sein ältester Sohn „Schamaschschumaukin“ wurde König von Babylonien. Die beiden Brüder regierten 20 Jahre ihre benachbarten Königreiche offenbar in gutem Einvernehmen. Aber 650 v. Chr. zettelte „Schamaschschumaukin“ dann doch eine Rebellion an. Es folgten zwei Jahre erbitterter Kämpfe, die in langwierigen Belagerungen Babylons und „Borsippas“ durch die Assyrer gipfelten. Babylon stand 648 v. Chr. allein da, von Hunger und Krankheiten gezeichnet. Die Stadt kapitulierte, nachdem sich „Schamaschschumaukin“ in die Flammen seines brennenden Palastes gestürzt hatte.
„Assurbanipal“ diktierte seinem Schreiber nach der Eroberung Babylons: „Was die Männer angeht, die Böses gegen mich sannen, so riss ich ihnen die Zunge heraus und vernichtete sie vollends. Die anderen erschlug ich bei lebendigem Leib mit eben den Statuen der Schutzgötter, mit denen sie meinen Großvater Sanherib erschlagen hatten – nun endlich als Grabopfer für seine Seele. Ihre Leichen schnitt ich in kleine Stücke und verfütterte sie an Hunde, Schweine, Zibu-Vögel, Geier, an die Vögel des Himmels und die Fische der Meere.“
Die Stadt wurde, ganz gegen die Gewohnheit der Assyrer, nicht geplündert und niedergebrannt. „Assurbanipal“ setzte einen König namens „Kandalanu“ ein, der in seinem Namen 20 Jahre bis zu seinem Tod 627 v. Chr. regierte. „Assurbanipal“ starb im selben Jahr. Bei seinem Tode herrschten die Assyrer über das größte Imperium, das es bis dahin in Mesopotamien gegeben hatte. Es erstreckte sich von Ägypten bis Elam, vom Persischen Golf bis ans Mittelmeer, dessen Ostküste sie vom Taurus bis an den Nil beherrschten. Es sollte allerdings nur noch 20 Jahre bestehen. Vier Nachfolger des verstorbenen Großkönigs stritten um die Macht im Staat. Das einstmals so mächtige Reich war so ganz plötzlich in unbedeutende, rivalisierende Kleinstaaten zerfallen. Vorübergehend wurden in Babylonien zwei Assyrer als Herrscher anerkannt, ein General und der vorletzte König des zerfallenen Reichs, „Sinscharischkun“. Der General hieß „Nabopolassar“, war nicht adliger Herkunft, konnte sich aber auf mächtige Stammesverbindungen stützen und entwickelte sich dank seiner Tatkraft bald zum starken Mann im Staate.
Mit Geduld, militärischem Geschick, Entschlossenheit und Diplomatie verschaffte sich „Nabopolassar“ eine Vormachtstellung in ganz Südmesopotamien. Nun konzentrierte er sich auf den Norden. Die Bedrohung war so groß, dass sich der ägyptische Pharao „Psammetich I.“ mit dem assyrischen Herrscher „Sinscharischkun“ zusammen tat.
Unbeeindruckt rückte „Nabopolassar“ 615 v. Chr. gegen Assur vor. Er wurde zwar zurück geschlagen, allerdings nur bis „Tikrit“. Damit verlor er nicht das gesamte eroberte Terrain.
Unerwartete Hilfe erhielt er vom Mederkönig „Chavachschtra“, der eigene territoriale Interessen verfolgte. Während die Assyrer „Nabopolassar“ in Tikrit belagerten, erfuhren sie, dass der Mederkönig an der Ostgrenze Truppen zusammen zog und traten daraufhin den Rückmarsch an, um dieser neuen Gefahr entgegen zu treten.
Die „Meder“ waren ein altiranisches Volk, das um 1000 v. Chr. nach Westen gezogen war und sich im Nordwesten des heutigen Iran nieder gelassen hatte. Nun wollten sie ein eigenes Reich aufbauen und waren ebenso wie „Nabopolassar“ daran interessiert, die Reste des Assyrischen Reichs zu zerschlagen. 614 v. Chr. drangen sie von Norden nach Assyrien ein, nahmen unweit von Ninive die Festung „Tarbisu“ ein, plünderten Kalchu und eroberten schließlich Assur.
Aber die Assyrer besaßen nach wie vor eine schlagkräftige Armee und starteten einen Gegenangriff. Sie marschierten 613 v. Chr. in Babylonien ein, eroberten Kalchu zurück und setzten die zerstörten Wehranlagen instand. Doch nur kurz konnten sie die Initiative behalten. Die Allianz aus babylonischen, medischen und nun auch skythischen Truppen griff die assyrische Metropole Ninive an und eroberte die Stadt nach dreimonatiger Belagerung. König „Sinscharischkun“ starb 612 den Heldentod. Sein Nachfolger, „Assuruballit II.“, der praktisch kein Reich mehr besaß, zog sich nach Harran zurück. „Nabopolassar“ verfolgte ihn, nahm die Stadt 610 v. Chr. ein und richtete dort eine Garnison ein. „Assuruballit“ flüchtete weiter nach Westen und wartete auf ägyptische Unterstützung. Die Meder eroberten unterdessen Kleinasien, und die „Skythen“ dehnten ihr Reich bis auf den östlichen Balkan sowie ein Gebiet zwischen Donau und Don aus. Babylonien erhielt Mittelassyrien und die gesamte Region zwischen Babylon und Assur, also ganz Mesopotamien. Höchstwahrscheinlich starb der letzte assyrische Herrscher „Assuruballit“ in dieser Zeit.
Märchenhaftes Babylon
Es waren die Hethiter, die dem altbabylonischen Reich den Todesstoß versetzten. Ihr König „Mursili“ ließ sich jedoch nicht auf Dauer dort nieder, sondern kehrte in seine Heimat zurück. Das Machtvakuum, das er hinterließ, nutzten neue Invasoren aus dem Nordwesten für sich aus, die „Kassiten“. Diese Invasion begann als mehr oder weniger friedliches, stetiges Einsickern. Als die „Kassiten“ sich schließlich etabliert hatten, beherrschten sie annährend 450 Jahre Babylon und sein Umland von „Sippar“ im Norden bis „Ur“ im Süden. Die „Kassiten“ stellten die Dynastie, die von allen am längsten in Mesopotamien herrschte.
Sie brachten ihre eigenen Götter mit, übernahmen aber auch heimische. Die von ihnen eroberten Städte behandelten sie mit Respekt und bauten Nippur, Lasa, Ur und Uruk wieder auf. Sie führten die Pferdezucht ein und brachten eine Technik mit, die spätere assyrische Könige zu einer hohen Kunst weiter entwickelten: Das Flachrelief. Sie entwickelten ein System, Landbesitz zu dokumentieren. Symbolische Grenzsteine mit Inschriften dienten als Besitzurkunden. Sie wurden im Tempel hinterlegt, während der Grundbesitzer eine Kopie aus Ton erhielt.
Doch im Norden wuchs die Macht der Assyrer. Unter König „Tukultinurta“ – 1243 – 1207 v. Chr. – war das Reich stark genug, Babylonien anzugreifen, die Hauptstadt zu plündern und König „Kaschtiliasch“ als Gefangenen nach Assur zu bringen. „Tukultinurta“ brüstete sich: „Ich trat mit Füßen auf seinen fürstlichen Hals wie auf einen Fußschemel.“ Doch der Triumph des assyrischen Königs war nur von kurzer Dauer. Sein Sohn stürzte ihn. Die Kassiten kehrten zurück und herrschten für weitere 80 Jahre in Babylon.
Ihrer Herrschaft setzten die Elamiter schließlich ein Ende und verschleppten die Götterstatuen von „Sin“ und „Marduk“ nach „Susa“. Erst dem Herrscher „Nebukadnezar I.“ von der neuen Dynastie der „Isin“, die inzwischen die Macht in Babylon übernommen hatte, gelang es rund 500 Jahre später, die Elamiter endgültig zu vertreiben und ein neues, mächtiges Staatsgebilde zu formen. „Nebukadnezar“ plünderte Susa und brachte die geraubten Götter im Triumphzug in die Heimat zurück.
Die Erzählungen des „Buches Daniel“ zeichnen das Bild eines exzentrischen Herrschers. Wie schon seine Vorfahren war „Nebukadnezar“ stolzer auf seine Verdienste als Baumeister als auf seine militärischen Triumphe. Trotzdem vergrößerten die Babylonier unter seiner Herrschaft ihr Reich. Aber auch die Künste und Wissenschaften erlebten während seiner langen Regierungszeit – er herrschte 42 Jahre, von 604 v. bis 562 v. Chr. – eine bisher nicht gekannte Blüte. Die Errungenschaften Babylons in der Architektur, der Astronomie und der Mathematik wirkten weit über die Grenzen des Reiches hinaus. Solche Zeiten hatte das Reich nur selten erlebt. Zudem sorgten die militärischen Erfolge für außenpolitische Stabilität. Eine Mischung aus Strenge und Gerechtigkeit sicherte ihm lange Zeit die Akzeptanz bei dem Großteil seiner Vasallen. Jeder Ansatz von Unabhängigkeitsbestrebung wurde konsequent unterdrückt.
Obwohl er als König viele Neuerungen einführte, war „Nebukadnezar“ auch Erbe einer großen Tradition. Sein Vater, der General „Nabopolassar“ hatte nicht nur das assyrische Joch abgeschüttelt, sondern der Kernregion des Reiches auch Frieden und Stabilität gebracht. So konnte sich „Nebukadnezar“ von Anfang an auf Eroberungen und den Anschluss neuer Regionen konzentrieren. Die Meder, die im Norden und Osten des Reiches siedelten, blieben zumindest bis zum Ende seiner Herrschaft mit ihm verbündet. Die nomadischen Araber in den Wüsten stellten keine Gefahr dar. Die Herausforderungen des Reiches lagen im Westen. „Nebukadnezar“ hatte Aram erobert – etwa das heutige Syrien und Jordanien – die Levante und die Mittelmeerregion. Dazu gehörten die Territorien der Phönizier, Moabiter, Ammoniter und Philister sowie Israel. Die Herrscher von Damaskus, Tyros und Sidon waren ihm tributpflichtig.
Der König führte die Tradition einer alljährlichen Reise durch die neu erworbenen Regionen ein. Das diente dazu, Stärke zu demonstrieren und die Menschen daran zu erinnern, wer ihr Herrscher war. Gleichzeitig wurden bei dieser Gelegenheit Steuern und Abgaben kassiert. Außerdem konnten Unruhen im Keim erstickt werden.
Der ägyptische Pharao „Necho“ wollte jeder Gefahr einer babylonischen Expansion begegnen. Es kam zu einem kurzen, blutigen Krieg zwischen den beiden Mächten. Die Auseinandersetzung scheint ergebnislos geendet zu haben, brachte für Babylon dennoch einen Imageschaden. Sofort fühlte sich das Reich Juda unter König „Jojakim“ dazu ermutigt, das fremde Joch abzuschütteln. „Nebukadnezar“ sandte ein Heer nach Jerusalem und belagerte 597 v. Chr. die Hauptstadt der Juden. Der Feldzug dauerte nur drei Monate, dann kapitulierte Israel.
Jojakims Sohn und Erbe „Jojachin“ wurde zusammen mit seiner Armee, seiner Familie und den meisten wichtigen Beamten und militärischen Führern sowie nützlichen Handwerkern nach Babylon verschleppt und dort angesiedelt. Insgesamt etwa 10.000 Bewohner Israels mussten in die so genannte „Babylonische Gefangenschaft“. Deportationen in großem Stil waren damals ein gängiges Mittel, um den Feind zu schwächen. Außerdem brachten sie frisches Blut und junge Talente nach Babylon. Viele Städte in Juda blieben verlassen zurück. Nach babylonischer Tradition wurden zudem die Schätze des Tempels und des Palastes konfisziert. Nebukadnezars Statthalter in Israel, „Zedekia“, verbündete sich, seine Macht überschätzend, ein Jahrzehnt später mit den Ägyptern und zettelte eine Revolte gegen die babylonische Herrschaft an. Diesmal belagerte das Heer Nebukadnezars Jerusalem 18 Monate lang, bis die Bewohner schließlich, halb verhungert, aufgeben mussten.
Der babylonische König statuierte ein Exempel: Zunächst musste der Aufrührer mit ansehen, wie seine Söhne hingerichtet wurden. Dann blendete man ihn und brachte ihn in Ketten nach Babylon, wo er den Rest seines Lebens in einem Kerker verbrachte. Jerusalem wurde geplündert, die Stadtmauern geschleift, Tempel und Palast in Brand gesetzt. Alle Mitverschwörer Zedekias mussten sterben und ein großer Teil der Bevölkerung wurde nach Babylon verschleppt.
Das babylonische Exil der hebräischen Elite endete mit der Machtübernahme der Perser in Mesopotamien. Als „Kyros der Große“ den Deportierten erlaube, in ihr Heimatland zurückzukehren, nahmen 40.000 von ihnen das Angebot an.
Nebukadnezars Eroberungen im Westen waren zwar imposant, hatten aber im Alten Orient nur eine relative Bedeutung. Er hätte gut daran getan, mehr auf die Gewitterwolken zu achten, die sich an der östlichen Grenze seines Reiches zusammen brauten. Die Bibel berichtet davon, wie der babylonische König Nebukadnezar in einem Traum ein gewaltiges Standbild erblickte, dessen Haupt aus reinem Gold, Brust und Arme aus Silber, Körper und Hüften aus Bronze, Beine und Füße aus Eisen und zum Teil aus Ton gewesen seien. Dieses Standbild wurde, so sah es der König im Traum, von einem Stein zermalmt. Einem Stein, der zu einem großen Berg wurde und die ganze Erde erfüllte. Die Weisen des Reiches deuteten diesen Traum als das unausweichliche Auseinanderbrechen von mächtigen Reichen und das Entstehen neuer Herrschaften.
Der König sah darin einen Fingerzeig seines Gottes und entließ das Volk der Juden aus der so genannten „Babylonischen Gefangenschaft“ in ihre Heimat nach Palästina. Doch damit konnte er sich nicht den ewigen Bestand seines Reiches erkaufen. Babylonien ging genauso unter wie andere Imperien vor und nach ihm.
20 Jahre nach seinem Tod traten die Perser ihren Siegeszug an.