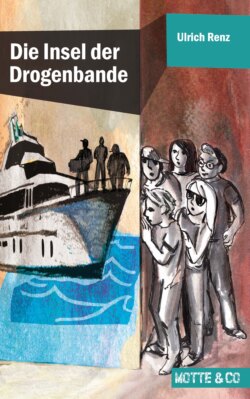Читать книгу Motte und Co Band 4: Die Insel der Drogenbande - Ulrich Renz - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Strammscheitel
ОглавлениеIn den nächsten Tagen groovten wir uns dann vollends ein ins Ferienleben. Unsere Hautfarbe ging schon Richtung Dunkelbraun, außer bei JoJo, der sich nicht von seiner Ganzkörpermontur trennen konnte. In MMs braunem Gesicht leuchteten ihre meerblauen Augen so, dass ich gar nicht mehr hinschauen konnte. Es war jedes Mal so, als ob ich einen leichten Stromschlag bekäme. Aber das musste sie ja nicht wissen. Sie hatte wahrscheinlich recht, dass es besser war, wenn wir „normale Freunde“ blieben.
Inzwischen hatten wir mit sämtlichen Bewohnern auf dem Campingplatz Bekanntschaft gemacht. Die meisten waren Deutsche oder Österreicher, mit Ausnahme der holländischen Familie, die wir schon am ersten Tag im Swimmingpool gesehen hatten. Die Kinder waren wie die Orgelpfeifen, das kleinste noch ein Baby, das älteste ein Junge von vielleicht 16 Jahren. Auch außerhalb des Pools hatten sie immer Sachen in orange an – der holländischen Nationalfarbe, wie uns JoJo aufklärte („Weiß doch jeder, der Fußball guckt“). Zu allem Überfluss hatten alle acht auch noch orangene Haare, ungefärbt. Die ganze Familie sah aus, wie man sich eben Holländer so vorstellt: Die Mama, Britta, hatte blonde Haare und eine Stupsnase, der Papa war zwei Meter groß. Eines der Mädchen hieß Leonie und lief mit einem Eimerchen rum, in dem sie einen toten Fisch herumtrug, den sie jedem zeigen musste. „Fisch slaapt!“, sagte sie dazu.
Papa war inzwischen seinen Verband los und hatte nur noch ein Pflaster um den Daumen. Er hatte sich mit dem Platzwart angefreundet, der sich mit dem Namen „Evangelos“ vorgestellt hatte und in dem hellblau gestrichenen Häuschen gleich neben dem Eingangstor zur Straße wohnte. Wir hatten ihn „Koala“ getauft, wegen den Haarbüscheln in den Ohren. Papa und der Koala unterhielten sich in einer merkwürdigen Mischung aus Altgriechisch und Englisch, vor allem aber mit Händen und Füßen. Papa war ganz beglückt, über den Koala einen „authentischen Einblick ins Leben der Griechen“ zu gewinnen, wie er sich ausdrückte. „Authentisch, von griechisch authentikos, echt“, kam natürlich gleich noch hinterher.
Der abgefahrenste Typ auf dem ganzen Campingplatz aber war der „Rastamann“.
So nannten wir den zerzausten Hippie, der in einem verrosteten VW-Bus hauste, der keine Räder mehr hatte, sondern auf Steinen aufgebockt war. Seine Rasta-Mähne ging bis über die Schultern, dazu hatte er einen ebenso verfilzten, schon grauen Bart, den er auf beiden Seiten des Kinns zu Zöpfchen geflochten hatte. Es war schwer zu sagen, wie alt er war, aber bestimmt war er älter als Papa und Mama, jedenfalls hatte er tiefe Furchen im Gesicht. Außer einer langen bunten Stoffhose hatte er nie etwas an, auch keine Schuhe. Auf der Schulter und auf beiden Unterarmen hatte er Tattoos mit merkwürdigen Mustern und Schriftzeichen und an allen Fingern trug er breite Silberringe.
Meistens saß er im Schneidersitz vor seinem Bus und bastelte Schmuck aus Messing, bunten Steinen und Lederbändchen, den er am Strand den Touristen verkaufte.
Wie sich herausstellte, war er Deutscher. Er hatte uns gleich am ersten Morgen angesprochen, als wir auf dem Weg zum Wohntempel bei ihm vorbeikamen. Am Anfang war er mir, ehrlich gesagt, etwas unheimlich, und den anderen ging es wohl genauso. Aber als wir dann so miteinander sprachen, legte sich das. Er hatte eine warme Stimme und grüne, offene Augen. Er wollte von jedem von uns den Namen wissen, fand „MM“ ziemlich lustig und wollte wissen, wie man zu so einem Namen kommt.
„Wenn man eigentlich Mariekje Marienhoff heißt und die Leute einen Knoten in die Zunge bekommen“, erklärte MM, und wir anderen hielten natürlich die Klappe. Schließlich musste nicht jeder wissen, dass MM am Anfang eigentlich mal für „Mathe Mausi“ gestanden hatte, als MM neu in unsere Klasse gekommen war und wir alle sie für eine Streberin hielten, weil sie schon zwei Klassen übersprungen hatte.
Der Rastamann hieß eigentlich Erwin. Er lebte schon seit Ewigkeiten auf der Insel. Warum er denn nicht zurückgegangen sei, wollte JoJo wissen.
„Ich habe hier doch alles, was ich brauche“, war seine Antwort, „Luft, Sonne, Freiheit.“ Dabei schaute er uns lächelnd an, aber irgendwie wirkte er auch ein bisschen traurig.
„Was wollte denn dieser Hippie von euch?“, fragte Mama mich, als wir am Wohntempel ankamen. Der Frühstückstisch unter dem Vordach war schon gedeckt.
„Nichts, wir haben uns nur ein bisschen unterhalten.“
„Man soll ja nicht nach dem Äußeren gehen, aber ehrlich gesagt, der sieht aus wie ein Junkie.“
„Ein was?“
„Ein Junkie, so sagt man zu Rauschgiftsüchtigen. Also Leuten, die Drogen nehmen, …“
Von Papa kam dazu automatisch: „Junkie von englisch junk, Müll, Abfall.“
Mir war nicht ganz klar, was Drogen mit Müll zu tun haben sollten.
„… also seid besser ein bisschen vorsichtig“, sagte Mama.
„Ja klar. Mach dir keine Sorgen.“ Was soll man sonst sagen zu einer Mama, die sich hauptberuflich Sorgen macht?
Wir machten uns über die Wassermelonenstücke, Pfirsiche und Weintrauben her, die Mama von einem Bauern gekauft hatte, der seinen Stand auf dem Parkplatz vor der Ferienanlage hatte. Außerdem gab es superleckeren griechischen Sahnejoghurt. Das Campingtischchen brach fast unter der Last zusammen.
Als wir schon fast fertig waren, trudelte auch noch Tati ein. Im Lauf der Ferien kam er jeden Tag ein bisschen später, und jeden Tag sah er ein bisschen verwilderter aus. Seit er griechischen Boden betreten hatte, war er kaum noch wiederzuerkennen. Professor Marienhoff, den man eigentlich nur in Anzug und Krawatte kannte, hatte jetzt eine Fischermütze auf dem Kopf, das Hemd vorne offen und einen wilden Stoppelbart im Gesicht. Und in den Fingern ein kleines Kettchen aus Perlen, an dem er ständig rumspielte. Zum typischen Griechen fehlte nur noch, dass er das Rauchen anfing.
Zu Hause hatte er wohl noch davon geschwärmt, dass er im Urlaub endlich mal in Ruhe arbeiten könne, und den Koffer mit Laptop, Festplatten und sogar einem Drucker vollgepackt. Nun lebte er hier entspannt in den Tag hinein: Nach dem Frühstück machte er es sich erst einmal mit einer Zeitung im Café auf dem „Dorfplatz“ (wie sie hier den zentralen Platz nannten) gemütlich. Nachmittags fuhr er meistens mit dem Bus in das Städtchen, das so eine halbe Stunde entfernt war. Er hatte sich dort mit den Fischern angefreundet, ganz besonders mit einem, den er „Zweistein“ nannte. Auf die Frage, woher er den Namen hatte, kam die Antwort: „Weil er mit seiner weißen Wuschelmähne aussieht wie Einstein – der zweite Einstein, also Zweistein, logisch.“ Was daran logisch sein sollte, war mir allerdings nicht ganz einsichtig.
Nach dem Frühstück war es jeden Tag meine Aufgabe, das Geschirr abzuspülen. Mamas Erziehungsprogramm ging natürlich auch im Urlaub weiter. Ihre größte Befürchtung ist ja, dass aus mir so was Schlimmes wie ein „Macho“ wird. Das ist wohl jemand, der zu Hause die Füße hochlegt, während seine Frau für ihn arbeitet.
Das Abspülen war aber gar nicht so wild, die anderen waren ja mit von der Partie. Im Waschhaus war so ein langer Schlauch, mit dem wir nicht nur das Geschirr, sondern uns auch gegenseitig abspritzten. Leider hatte auch der Koala einmal eine kalte Dusche abgekriegt, was der nur so mäßig komisch fand.
Nach dem Abwaschen machten wir uns alle zusammen auf den Weg ins Dorf, nur Papa blieb meistens noch auf seinem Campingstuhl sitzen und vertiefte sich in seinen Schmöker mit der griechischen Kulturgeschichte oder philosophierte mit dem Koala.
Mama dagegen fuhr voll auf das „Clubprogramm“ ab. Gleich nach dem Frühstück zog sie los, meistens zusammen mit Britta, unserer holländischen Nachbarin, mit der sie sich angefreundet hatte. Erst zur Morgengymnastik, dann zum Yoga oder Batiken oder was weiß ich. Am Nachmittag war dann ihr heiß geliebtes Zumba dran. Darunter muss man sich einen Tanz vorstellen, bei dem alle mit dem Arsch wackeln. Schien aber echt anstrengend zu sein. Mama hatte sich schon zu einer richtigen Zumba-Queen entwickelt und trug jetzt auch außerhalb der Trainingsstunden ein leuchtendes rosa Tuch um die Stirn, was super aussah.
Wir erholten uns erstmal bei Luigi von den Strapazen des Abspülens. Wir hatten sein Café inzwischen in „Eis-Tanke“ umgetauft. Dann liefen wir im Dorf herum, dort kannten wir inzwischen jeden Weg wie unsere Westentasche. Früher oder später landeten wir am Strand. Den konnte man ewig entlanggehen und überall bestens baden. Ich spüre noch heute den feinen Sand unter den Füßen, wie er zwischen den Zehen rausquillt. JoJo sorgte mit seinem abgefahrenen Ganzkörperanzug natürlich für viel Aufmerksamkeit. Zum Schwimmen zog er einen blauen Thermoanzug an, der ihn vor irgendwelchen Killerfischen schützen sollte, die es „in diesen Breiten“ angeblich in Massen gab. Er sah aus wie das Sams höchstpersönlich.
Zum Glück hatten wir Ute nicht an der Backe, sie hatte nämlich beim Schminkkurs jede Menge Tussen kennengelernt, von denen eine auch Melanie hieß. Wenn sie nicht im Schminkkurs waren, saßen sie zusammen am Pool. Die anderen waren noch ein bisschen jünger, und Ute war der absolute Mittelpunkt. In ihrem pinken Bikini saß sie auf der Liege und hatte ein Glas Fruchtsaft-Cocktail mit Strohhalm in der Hand, an dem sie von Zeit zu Zeit vornehm nippte. Das hatte sie vermutlich aus irgendeiner ihrer Serien, die sie mit der anderen Melanie anschaute. Es war natürlich nicht irgendein Cocktail, sondern einer der angesagten XXL-Cocktails mit Mango und Papaya, von Luigi frisch gemixt, sechs Euro das Glas. Der Trick, wie sie ohne Geld und ohne gelbes Bändchen zu ihren Cocktails kam, hieß Benni. So hieß der sommersprossige Kleine von der Strammscheitel-Bande. Er litt ganz offensichtlich an einem schweren Fall von Verliebtheit und tat nichts lieber als sie von vorne bis hinten zu bedienen.
Ute fand es megaaufregend, so umschwärmt zu werden, aber viel lieber wäre sie natürlich im Surfkurs bei ihrem Chrissy gewesen – der war aber ausgebucht, weil alle Mädchen bei Chrissy surfen lernen wollten. Ute war aber auf der Warteliste und rückte jeden Tag weiter ihrem Traum entgegen. Wahrscheinlich musste sich der arme Sommersprossenknabe ihr ganzes Chrissy-Verliebtheitsgestöhne anhören. Aber gut, er machte es schließlich freiwillig.
Durch Ute waren wir über die Strammscheitel so ziemlich auf dem Laufenden. Sie hatte jedenfalls immer viel zu erzählen, wenn wir uns mittags alle vor dem Wohntempel zum Picknick trafen. Benni war wohl der jüngere Bruder von Wulfius, dem Blonden mit der Brille. Und eigentlich hatte er gar nicht mit nach Griechenland gewollt, aber seine Eltern hatten ihn kurzerhand dazu verdonnert, mit seinem Bruder zu fahren. Sie mussten nämlich unbedingt nach San Francisco düsen, um auf der Ausstellung irgendeines unglaublich angesagten Künstlers ein paar Bilder zu kaufen, für ein paar Zehntausender das Stück.
„Der arme Benni“, seufzte Ute immer wieder. Man konnte sich fragen, ob sie jetzt vielleicht auch noch in den Kleinen verknallt war. „Er tut mir so leid. Und diese Typen sind wirklich nicht nett zu ihm. Das Großmaul, das bei denen offenbar den Ton angibt, heißt übrigens Attila. Habt ihr so einen Namen schon mal gehört? Die Typen haben gerade Abitur gemacht, an irgend so einem piekfeinen Privatinternat, und haben von ihren Eltern zur Belohnung diese Reise geschenkt bekommen. Ihr glaubt gar nicht, was das kostet. Eine Riesenwohnung haben die, mit ner Dachterrasse, da machen sie die ganze Nacht Party …“
Sie hörte gar nicht mehr auf zu erzählen. Dass es schon ein paarmal Ärger mit den Nachbarn gegeben habe, und sie deshalb vom Manager schon verwarnt worden seien. Und dass Benni sich Sorgen mache, dass sein Bruder so viel trinkt. Im Internat durften die Schüler wohl überhaupt keinen Alkohol trinken und auch sonst keinerlei Drogen nehmen, sonst wären sie sofort von der Schule geflogen. Und jetzt wollten sie hier so richtig die Sau rauslassen und mal „alles Mögliche ausprobieren“.
„Und die sind wirklich schon 18?“, fragte Mama. „Also ich finde das eine Schande, dass die hier so viel Alkohol ausschenken. Wo es hier so leckere Kräuter gibt, und Honig, daraus könnte man die tollsten Drinks machen!“
„Doofe gibt es immer“, sagte Papa, „man muss ihnen nur aus dem Weg gehen.“
Das versuchten wir, so gut wir konnten.
Nur einmal gelang es uns nicht. Und das hatte mit dem Quallenalarm zu tun. Es muss am vierten oder fünften Tag gewesen sein, da war der Strand plötzlich mit roten Bändern abgesperrt und überall standen Warnschilder, dass das Meer voller Feuerquallen sei. Die Tiere hatten sich wohl wegen der Hitze wahnsinnig vermehrt, und dann hatte der Wind gedreht und sie zum Strand getrieben. „Die Berührung mit den Tieren kann extrem schmerzhaft sein. Es wird dringend davon abgeraten, ins Wasser zu gehen.“
„Da seht ihr, warum ich meinen Schutzanzug dabeihabe. Man muss in diesen Breiten mit allem rechnen.“ JoJo war jetzt natürlich sehr zufrieden mit sich, aber ganz alleine wollte er dann doch nicht schwimmen gehen.
Also landeten wir am Pool. Dort war es ziemlich voll, weil ja die anderen Strandgänger irgendwo baden wollten. Wie durch ein Wunder hatten wir aber trotzdem einen der besten Plätze ergattert, nämlich zwei Liegen nebeneinander direkt am Pool, im Schatten der Palmen. Genialer ging es nicht, und bald hatten wir unseren Rhythmus gefunden: Rein ins Wasser – raus zur Eis-Tanke – wieder rein ins Wasser und so weiter. Meistens machten wir Reiterkämpfe bis zum Umfallen.
Und jetzt wollten wir uns auf unseren Liegen erholen.
Auf denen saßen aber, feixend und johlend, die Strammscheitel, mit ihren Biergläsern in der Hand.
„Da sind ja wieder unsere Billig-Campis!“, wurden wir von Attila begrüßt. „Das war wirklich artig von euch, uns die Liegen freizuhalten!“ Die anderen prosteten ihm begeistert zu. Er machte eine lässige Handbewegung in unsere Richtung. „Ihr könnt euch jetzt trollen, falls ihr keinen Ärger wollt.“
Mein Herz pochte wie wahnsinnig. „Ihr könnt den Leuten doch nicht einfach ihre Plätze wegnehmen!“, kam es trotzdem aus mir raus.
Attila grinste mich höhnisch an und zeigte auf sein gelbes Bändchen „Können wir doch! Schließlich haben wir ja auch bezahlt, im Gegensatz zu euch Billig-Touris. Ihr könnt euch ja ne Liege auf eurem Campingplatz aufstellen.“
Seine Bande brüllte vor Lachen.
„Und falls ihr jetzt nicht abzieht, können wir ja ein bisschen nachhelfen.“ Er stand auf, nahm unsere Badetücher und warf sie in hohem Bogen in den Pool.
Während ich noch nach Luft schnappte, hörte ich auf einmal Tatis Stimme hinter mir. Ich wusste gar nicht, dass er so laut werden konnte. „Hol die Sachen wieder raus, und zwar sofort! Und wehe, ihr lasst die Kinder nicht Ruhe!“
Das Gebrüll zeigte Wirkung. Attila fischte die Badetücher aus dem Wasser und warf sie auf unsere Liegen. Bevor er mit seiner Bande abzog, hörte ich ihn noch zischen: „Wir sehen uns wieder!“