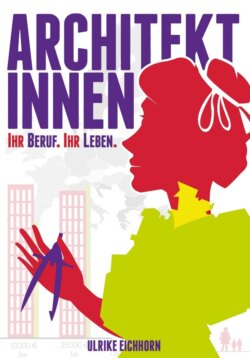Читать книгу Architektinnen. Ihr Beruf. ihr Leben. - Ulrike Eichhorn - Страница 4
Vorwort
ОглавлениеLiebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Leserinnen und Leser,
bevor ich Sie in die Welt der Architektinnen entführe, möchte ich ein paar Worte in eigener Sache voranstellen, denn viele Kolleginnen haben mich gefragt, was mich zu diesem Projekt bewogen hat.
Ehrlich gesagt, war es nichts anderes als die Suche nach Antworten auf Fragen, die sich im Laufe meines Berufs- und Lebensweges gestellt haben und die Neugier auf Lösungen. Wie kam es zu den Fragen? Voller Begeisterung hatte ich nach dem Schulabschluss das Architekturstudium aufgenommen und nach dem Diplom die berufliche Tätigkeit begonnen. Nach anfänglichen Eingewöhnungsschwierigkeiten habe ich arbeitsreiche, zufriedenstellende, erfüllende, lehrreiche und heitere Jahre mit meinem Beruf verbracht. Eine Wende vollzog sich, einhergehend mit einer allgemeinen Baurezession, mit der Geburt meines Kindes, dessen aufmerksame Erziehung mir und meinem Mann sehr am Herzen lag. Die folgende Lebensphase war geprägt von einer Gratwanderung, zwischen Berufsausübung, Kinderbetreuung und Erziehung, Partnerschaft, Familie und der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Vielen von uns, und so auch mir, wurden die Pflege der Eltern und die Begleitung bis zu ihrem Tod nicht abgenommen, sodass auch diese Phase Bestandteil meines Lebensweges ist. Nicht nur einmal habe ich mich gefragt, was aus meinem elanvollen Berufsstart geworden ist und wie ich ihn hätte fortsetzen können. Wie gehen meine Kolleginnen mit ihrer Situation um? Wie kann ich als Architektin erfolgreich arbeiten, wenn ich Kinder versorge, in einer Partnerschaft lebe und zudem die Elternpflege auf mir lastet? Hätte ich mit einem anderen Partner, einem Architekten, vielleicht größere Chancen gehabt, meine Karriere fortzusetzen? Und wenn, hätte ich dann genug Freiraum für eine eigene Entwicklung gehabt? Wäre ich beruflich erfolgreicher geworden, wenn ich mich mit Kolleginnen zusammengetan hätte? Ist es überhaupt möglich, in diesem Beruf erfolgreich zu arbeiten, wenn Kinder Teil des Lebens sind? Unter welchen Umständen sind Beruf und Kinder vereinbar? Wie sind die Chancen, nach einer Erziehungspause wieder in den Beruf einzusteigen?
Viele Fragen haben mich über Jahre begleitet, bevor ich mich zeitlich und mit Hilfe moderner technischer Entwicklungen in der Lage sah, ihnen nachzugehen um nach Antworten zu suchen.
Um mich den Antworten zu nähern, beschloss ich, mir zunächst mir einen geschichtlichen Überblick über die Entwicklung des Berufs für Frauen zu verschaffen. Dass die Anfänge in der Geschichte der weiblichen Berufsausübung von der ungleichen Behandlung von Mann und Frau geprägt war, und dass Frauen generell erst ab Anfang des 20. Jahrhunderts zum Studium der Architektur zugelassen wurden, war mir bekannt. Dass es damals trotz aller Schwierigkeiten bei der Zulassung aber viele Frauen gab, die das Architekturstudium absolvierten, wusste ich nicht. Und die Anzahl der Absolventinnen wuchs stetig, ebenso wie die Anzahl der in diesem Beruf tätigen Frauen. 1930 waren in der Architektenschaft nahezu 16 Prozent Frauen registriert. Die politischen Ideologien der Naziherrschaft stoppten diese Entwicklung eklatant. Zahlreiche jüdische Frauen, die zu der Zeit erfolgreich als Architektinnen tätig waren, sahen sich gezwungen zu emigrieren. Andere wurden in der Ausübung des Berufs gehindert, viele zogen sich aus der aktiven Tätigkeit zurück. Nachhaltig geprägt von den Ideologien der Kriegs- und Nachkriegszeit wuchsen mindestens zwei Generationen damit auf, dass Kindererziehung, Karriere und Familie keinesfalls miteinander zu vereinbaren seien, und dass Frauen, die diesen Lebensweg anstrebten, als karrierekrank oder Rabenmütter galten. Nicht wenige Frauen sahen sich gezwungen, die Situation als gegeben hinzunehmen. Die Biografie der Architektin Trudy Frisch zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie sich eine hervorragend ausgebildete Architektin mit Beginn des Ehelebens und mit der Geburt der Kinder aus dem Beruf zurückzog. Sicherlich nicht, weil sie den Beruf nicht mehr liebte. Aber weder wurde sie von ihrem Mann noch von ihrer Familie unterstützt, ihren Beruf weiterauszuüben. Am Ende entschwand sie ganz im Schatten einer Berühmtheit, die ohne die persönliche und finanzielle Unterstützung seiner Frau sicherlich niemals diese Bekanntheit erlangt hätte.
Es ist nicht die einzige Biografie, die dieses Schicksal erzählt. Bis vor kurzem noch wurde in der Nationalgalerie Berlin die von Aino Aalto entworfene Vase Savoy als Entwurf von Alvar Aalto präsentiert. Niemand störte sich daran. Bis heute gilt es nicht als angemessen, sich als Frau in den Vordergrund zu spielen, und vielen Frauen scheint es auch nicht so wichtig, öffentlich aufgrund ihrer beruflichen Leistungen anerkannt zu werden. Warum eigentlich?
Leider ist diese Haltung ein großes Problem. Die Anerkennung einer Leistung wird durch Geld entlohnt. Frauen und auch Architektinnen erhalten 20 bis 30 Prozent weniger Entgelt als Männer bei gleichwertiger Leistung. Das führt dazu, dass Männer bei Gründung einer Familie häufig aus ökonomischen Gründen ihre berufliche Tätigkeit fortsetzen und ihre Frauen sich gegebenenfalls mit einer Teilzeittätigkeit arrangieren. Viele Architektinnen tun dies.
Auch meine berufliche Tätigkeit beschränkte sich auf die Zeiten, in denen unser Kind von zu bezahlenden Kräften betreut wurde. Das Hin- und Hereilen zwischen Büro und Übergabe des Kindes musste minutiös geplant werden. Schulferien, Öffnungszeiten des Horts, Krankheiten ließen sich nicht mit Bauzeitplänen in Einklang bringen. Der Stress zehrte an meinen Nerven. Nach Verrechnung meiner Einkünfte, die ich aus meiner Arbeit erzielte und den Ausgaben für Büro, Versicherungen, Kammerbeiträgen etc., musste ich feststellen, dass mir wenig eigenes Einkommen blieb. Es gab aber Architektinnen, die dieses Problem nicht kannten. In Zeitschriften und Feuilletons jedenfalls wurde vielfach davon berichtet. In mir keimten Frust und Selbstzweifel. Was hatte ich in meiner Lebensplanung falsch gemacht? Noch während ich darüber nachdachte, wie ich mein Leben in zufriedenstellende, neue berufliche Bahnen lenken konnte, wurde ich durch ein Thema, von dem inzwischen viele Menschen meiner Generation betroffen sind, gefordert: die Pflege der Eltern. Gerade als unser Sohn zur Schule kam, im Hort versorgt wurde, ich die familiäre Situation erreicht hatte, in der ich hätte wieder beruflich durchstarten können, ereilte mich die Nachricht aus dem Krankenhaus, dass ich mich um die Zukunft meiner kranken Mutter zu kümmern hätte.
In dieser Situation bin ich kein Einzelfall. Sie wird mittlerweile auch in den Medien äußerst vielfältig kommuniziert. Die Thematisierung hat aber leider noch keine Lösungen parat, die es uns zeigen, Kinder, Beruf, und pflegebedürftige Eltern unter einen Hut zu bringen.
Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil ich zehn Jahre vor dem Eintritt in das Rentenalter bin und feststellen muss, dass ich in Relation für ein engagiertes Leben in Beruf, in der Erziehung, der Betreuung kranker Familienangehöriger und im Zusammenleben mit meinem Partner eine völlig unangemessene Rente erhalte. Sollte mein Mann versterben, erhalte ich 60 Prozent seiner Rente. Warum eigentlich? Mein Mann bekommt 100 Prozent.
„Schön blöd, wer da noch Kinder bekommt, vor allem in einem Beruf, der zeitaufwendig und verantwortungsvoll ist. Das kann nicht Ziel der Politik sein“, sagte eine Kollegin bei einem Interview.
Da eine Lösung dieses gesamtgesellschaftlichen Problems nicht absehbar ist, können wir zurzeit nur darüber nachdenken, wie Architektinnen die Herausforderung meistern und Beruf und Familie vereinbaren können. Gibt es Kolleginnen, die das zufriedenstellend umsetzen? Wie gestaltet sich dieser Lebensweg? Gibt es alternative Lebensformen, in denen das möglich ist? Welche Schlüsse können wir aus diesen Beispielen ziehen?
Recherchen, Statistiken, die Ergebnisse einer Umfrage1 und 16 Interviews gaben mir Antworten. Die Erkenntnisse spiegeln natürlich nur einen Ausschnitt wieder. Meine Herangehensweise an die Fragen ist nur eine Variante und es gibt sicherlich viele andere Sichtweisen, die es darzustellen gilt. Ein neuer Fragebogen wirft neue Fragen auf und ein weiteres Interview würde ergänzende Sichtweisen offenbaren. Es bleibt ein steter Prozess, wie ein Rückblick in die Geschichte zeigt. Und ich denke, dass dieser unerlässlich ist, um für die Zukunft Veränderungen zu erzielen. Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft, sagte Wilhelm von Humboldt.
Das vorliegende Buch ist nicht nur eine Übersicht der Geschichte und eine Bestandsaufnahme, sondern vielmehr auch als Diskussionsgrundlage gedacht, nicht nur für Architektinnen. Viele der dargestellten und angesprochenen Probleme, Wünsche und Sorgen gelten auch für Frauen in anderen Berufen. Für Architektinnen aber ist, und das ist anders als in anderen Berufen, ein viel weiter gespanntes Aufgabenfeld Bestandteil des beruflichen Alltags. Deshalb ist dieses Buch auch für diejenigen Frauen gedacht, die sich für den Beruf interessieren, ihn ergreifen und studieren möchten. Denn so vielseitig dieser Beruf auch ist, so vielfältig sind auch die Herausforderungen.
Als ich mein Studium 1986 beendete, waren nur sehr wenige Architekturbüros mit einem CAD-System ausgestattet. Nahezu alle Pläne wurden per Hand gezeichnet und mithilfe von Rasierklingen geändert und den Wünschen des Bauherrn angepasst. Selbst Anfang der 1990er-Jahre war CAD noch kein Bestandteil in den Büros, selbst in Chicago nicht, wo ich in einem Architekturkonzern für ein Jahr tätig war. Inzwischen werden in nahezu allen Architekturbüros, selbst in den kleinsten, Pläne am PC oder Mac erstellt und nicht mehr mit der Post versandt, wie zurzeit meines beruflichen Einstiegs, sondern per E-Mail. Die Entwicklung wird kein Ende nehmen und immer neue Anforderungen werden immer neue Herausforderungen stellen. Wie orientieren sich junge Architektinnen im Dschungel der zahlreichen Möglichkeiten? Wie finden sie die Spezialisierung, die ihren Neigungen weitestgehend entspricht? Und wie sind diese mit Familie und Kindern vereinbar?
Die aufgezeigten Daten, Fakten und Lebenswege können eine Orientierungs- und Diskussionsgrundlage sein, Studentinnen und angehende Kolleginnen bei ihrer individuellen Lebensplanung zu unterstützen. Aber auch Architektinnen, die auf der Suche nach Veränderungen und Verbesserungen sind, kann das Buch eine Anregung sein, neue Wege anzusteuern, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue Ziele in Angriff zu nehmen. Dieser Beruf bietet nach wie vor, und mehr denn je, wunderbare Möglichkeiten, künstlerische wie technische und kaufmännische Neigungen auszuleben.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Berlin, im Herbst 2013