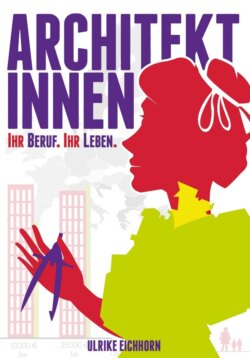Читать книгу Architektinnen. Ihr Beruf. ihr Leben. - Ulrike Eichhorn - Страница 6
1. Rückblick Anfänge
ОглавлениеSchon in der Antike und im frühen Mittelalter wurde über Frauen berichtet, die als Architektinnen, Ärztinnen, Philosophinnen tätig waren. Zwar war es ihnen nicht erlaubt, in diesen Berufen zu arbeiten, aber immerhin möglich, an Akademien zu studieren und zu lehren. Leider blieb es nicht dabei. Im weiteren Verlauf der Zeitgeschichte reduzierte sich diese Freiheit und Frauen durften sich nur noch im klösterlich-medizinischen Umfeld beruflich bilden. Auch das wurde über die Jahrhunderte mehr und mehr eingeschränkt. Letztendlich wurde Frauen der Zugang zu Bildung und Lehre gänzlich verwehrt.
Erst mit Beginn des 17. Jahrhunderts und der Unterstützung des Philosophen, Theologen und Pädagogen Johann Amos Comenius (1592 — 1670), Bischof der Unität der Böhmischen Brüder, veränderte sich dies. Nach dem lateinischen Grundsatz „omnes-omnia-omnino“ (alle alles ganz zu lehren) setzte sich Comenius dafür ein, dass auch Mädchen staatliche Schulen besuchen durften. Sie zu einer weiterführenden Ausbildung zuzulassen, war man aber noch weit entfernt. So wurde ein weiteres Jahrhundert heftig diskutiert, ob Frauen von ihrer geistigen Leistungsfähigkeit und körperlichen Verfassung her überhaupt für ein Studium geeignet seien. Beispiele beweisen, dass Frauen zweifellos dazu imstande waren:
Eine von ihnen war Dorothea von Erxleben (1715 — 1762) aus Quedlinburg, die als erste deutsche Frau in den deutschen Staaten zu einer Promotion zugelassen wurde. Mit Unterstützung ihres Vaters, einem Arzt, war sie in der Medizin unterrichtet und ausgebildet. Nur mit Genehmigung des preußischen Königs wurde sie zur Disputation zugelassen. 1754 erhielt sie in Halle die Promotionsurkunde mit Auszeichnung. Eine andere Ausnahme war die Freifrau Dorothea von Rodde-Schlözer (1770 — 1825). Die Tochter eines Göttinger Professors für Staatsrecht und Geschichte wurde in klassischer Literatur, Bergbau, Baukunst und Mathematik ausgebildet. Sie promovierte 1787 zur Doktorin der Philosophie, obwohl sie keine Dissertation vorlegen musste. Zu den Ausnahmen gehörte auch Sofja Wassiljewna Kowalewskaja (1850greg. Moskau — 1891greg. Stockholm), die russischer Herkunft war. Da der slawische weibliche Name in den westlichen Ländern unbekannt war, wurde über sie meist unter dem Namen des Ehemanns berichtet. Sofia studierte ab 1869 als Gasthörerin an der Universität Heidelberg, weil ihr in Russland der Besuch einer Hochschule nicht gestattet war. 1870 wechselte sie nach Berlin. Trotz zahlreicher Empfehlungen damaliger namhafter Professoren wurde ihr eine Universitätszulassung nicht gewährt. Doch sie ließ sich nicht entmutigen und nahm Privatstunden bei ihrem Professor, der sie für eine Promotion nach Göttingen empfahl, wo sie 1874 trotz vieler Widerstände die Doktorwürde mit summa cum laude erhielt. Ihr Traum wieder zu ihrer Familie nach Russland zurückzukehren, um dort mit ihrer Promotion eine Anstellung an einer Hochschule zu bekommen, zerschlug sich. Die Lehre an einer russischen Universität blieb ihr weiterhin versagt. Auf Einladung des Mathematikers Gösta Mittag-Leffler ging sie nach Schweden, um dort als Privatdozentin tätig zu sein. Der Preis dafür war hoch: Ihre 1878 geborene Tochter musste sie in Russland bei einer nahen Freundin zurücklassen. Sofia war befreundet mit Julija Wsewolodowna Lermontowa (1847greg Sankt Petersburg — 1919 bei Moskau). Lermontowa war die erste Frau, die im Fach Chemie ihre Dissertation vorlegte. Auch sie wurde in Göttingen promoviert und 1874 mit summa cum laude ausgezeichnet. Ebenfalls in Göttingen wurde die Amerikanerin Margaret Eliza Maltby (1860 — 1944) promoviert. Sie war physikalische Chemikerin und leidenschaftliche Frauenrechtlerin. Sie hatte Naturwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology in Boston studiert und schloss dort 1891 mit dem Bachelor of Science ab. Um ihre Forschungsarbeit in Physik fortzusetzen, entschloss sie sich, nach Deutschland zu gehen, wo sie die Doktorwürde 1895 erhielt. Maltby arbeitete anschließend in Berlin als wissenschaftliche Assistentin an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin-Charlottenburg. Im Jahr 1900 kehrte sie in die USA zurück, um an der Columbia University, einem College, das dort ausschließlich für Frauen gegründet worden war, zu lehren. 1903 wurde sie außerordentliche Professorin, 1910 Juniorprofessorin und 1913 ordentliche Professorin und Vorsitzende des Fachbereichs Physik. Margaret Maltby engagierte sich zeitlebens für die Gleichstellung der Frau in Studium und Beruf, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich. Sie ermunterte ihre Studentinnen, sich nicht entweder für das Studium oder für die Familie zu entscheiden, sondern möglichst beides miteinander zu verbinden. Als langjähriges Führungsmitglied der American Association of University Women rief sie 1926 ein Stipendien-Programm für studierende Frauen ins Leben.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es zahlreiche Frauen, die sich als Wegbereiterinnen für das Frauenstudium in Deutschland einen Namen machten. Zu ihnen gehörte Katharina Charlotte Friederike Auguste Windscheid (1859 — 1943), die im Jahr 1895 die Doktorwürde im Fach Philosophie erhielt. Zu nennen sind ebenfalls Marianne Theodore Charlotte v. Siebold Heidenreich, (1788 — 1859, Doktorwürde in der Entbindungskunst 1817 in Gießen), Schriftstellerin Daniel Jeanne (Johanna) Wyttenbach, (1773 — 1830, philosophische Ehrendoktorwürde 1827, Marburg), Elsa Neumann (Physik, 1899, Berlin) und Clara Immerwahr (Chemie, 1900, Breslau). Sie alle machten ihrem Geschlecht alle Ehre, auch wenn sie durch ihr Tun zunächst keine Veränderungen für die allgemeinen Zulassungsbedingungen erreichte. 1888 hatte der Allgemeine Deutsche Frauenverein eine Petition beim preußischen Abgeordnetenhaus eingereicht, um die Zulassung von Frauen zum Medizinstudium und zur wissenschaftlichen Lehrerinnenausbildung zu erreichen. Im selben Jahr hatte auch der Frauenverein Reform die Zulassung für Frauen zu allen Fächern gefordert. Dennoch konnten diese Initiativen keine unmittelbaren Erfolge verbuchen. Das pragmatische Vorgehen einzelner Frauen, eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken, sollte sich als erfolgreich erweisen. Der erste Schritt dazu war die Zulassung als Gasthörerin. So war Hope Bridges Adams Lehmann die erste Frau in Deutschland, die ihr Medizinstudium als Gasthörerin begann und die es letztendlich mit einem Staatsexamen abschloss. Durch diese Hintertür gelang vielen der Zugang zu den Universitäten. Was als Ausnahme begann, wurde schließlich schnell zur Regel. Die weitaus meisten Gasthörerinnen konnte die Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin verzeichnen. Jüdische Frauen, besonders solche aus dem Russischen Reich, waren unter diesen ersten Jahrgängen ausnehmend zahlreich vertreten. An der Medizinischen Fakultät stellten sie sogar die Mehrheit der Studentinnen. Viele dieser Frauen hatten zuvor in der Schweiz studiert, konnten also schon Studienleistungen vorweisen. Die guten Erfahrungen, die die Schweizer Universitäten mit studierenden Frauen gemacht hatten, waren ein wichtiges Argument, die deutschen Hochschulen für Studentinnen zu öffnen. So betrachtet ist die Einführung des Frauenstudiums in Deutschland den vielen russisch-jüdischen Frauen zu verdanken, die an Schweizer Universitäten studiert hatten. Die bekannteste unter ihnen ist Rosa Luxemburg (1871 — 1919), die an der Universität Zürich Volkswirtschaft studierte. Ein anderes Beispiel ist die Philosophin Anna Tumarkin (1875 — 1951), die erste Professorin an der Universität Bern. Im Jahr 1906 wurde sie Honorarprofessorin und 1908 Extraordinaria. Sie war die erste Professorin Europas, mit dem Recht, Doktoranden und Habilitanden zu prüfen. Zudem war sie die erste Frau, die einen Sitz im akademischen Senat hatte.
Nach und nach öffneten sich die deutschen Universitäten, und noch vor der Jahrhundertwende wurde vielen Frauen der volle Zugang zu allen Studiengängen ermöglicht. Ab dem Sommersemester 1900 waren Frauen an nahezu allen Landesuniversitäten als „ordentliche Studierende“ zugelassen. Unter ihnen war auch die jüdische Medizinstudentin und spätere Ärztin Rahel Straus (1880 — 1963). Sie gilt es insofern zu erwähnen, da sie nicht nur die erste Abiturrede einer jungen Frau in Deutschland hielt (1899), als erste Medizinstudentin an der Universität Heidelberg eingeschrieben war, sondern sich auch aktiv in der Vereinigung Studierender Frauen engagierte. 1902 bestand sie das Staatsexamen mit Erfolg, promovierte 1907 und setzte ihren beruflichen Weg mit der Eröffnung einer gynäkologischen Praxis 1908 fort. Mit ihrem Ehemann, einem promovierten Juristen, bekam sie fünf Kinder. Auch mit Familie und Kindern setzte sie ihren beruflichen Weg beständig fort, kämpfte für die Abschaffung des Paragrafen 218 und engagierte sich im jüdischen Frauenbund. Nach dem Tod ihres Mannes 1933 emigrierte Rahel Straus nach Palästina, arbeitete dort weiter als Sozialarbeiterin und gründete 1952 die israelische Gruppe der Woman´s International League for Peace and Freedom, deren Ehrenpräsidentin sie bis zu ihrem Tod 1963 blieb.
Neben Erfolgsgeschichten soll nicht unerwähnt bleiben, dass es auch traurig endende Lebensläufe von Akademikerinnen gab, die zwar zuversichtlich begannen, im Laufe der Jahre aber in die Mühlen des Zeitgeschehens gerieten. So geschehen mit Emilie Kempin-Spyri (1853 — 1901), die erst nach der Geburt ihrer drei Kinder (1876 bis 1879) die Reifeprüfung ablegte. Im Anschluss schrieb sie sich 1885 an der Staatswissenschaftlichen Fakultät Zürich zum Jurastudium ein, promovierte mit 34 Jahren 1887 und bewarb sich auf eine Dozentenstelle. Aufgrund ihres Geschlechts wurde sie sowohl von der Universität als auch bei der Zulassung zur Anwältin abgelehnt. Wütend ob dieser Rückständigkeit überzeugte sie ihren Mann, mit ihr und den Kindern 1888 in die USA auszuwandern. Dort fand sie allerdings ähnliche Bedingungen vor. Durch eine glückliche Fügung lernte sie eine wohlhabende New Yorkerin kennen, die sie unterstützte, eine Schule für Anwältinnen zu gründen. (Die „Emily Kempin-Law-School“ ermöglichte in späteren Jahren vielen Frauen eine Ausbildung zum Anwaltsberuf.) Emily war die erste Frau, die an einer amerikanischen juristischen Fakultät lehren durfte. Sie hielt Vorträge, verfasste Aufsätze für Zeitschriften und engagierte sich in der Frauenbewegung. Doch sie war hin- und hergerissen zwischen beruflichem Erfolg und familiären Herausforderungen. Ihr Mann war mit zweien ihrer Kinder 1889 wieder in die Schweiz zurückgekehrt, da er in den USA nicht Fuß zu fassen vermochte. Schuldgefühle der jüngsten Tochter gegenüber wegen vermeintlicher mangelnder Betreuung und eine Krankheit ihres Sohnes in Zürich veranlassten sie 1891 zur Rückkehr in die Schweiz. Dort bewarb sie sich für eine Dozentenstelle. Sie gründete einen Frauenrechtsverein und engagierte sich mit Zeitungsartikeln und Vorträgen für die Sache. Das Glück stand nicht auf ihrer Seite, denn der finanzielle Erfolg blieb aus und ihre Ehe scheiterte. 1895 zog Kempin zunächst allein nach Berlin, holte ihre Kinder nach und verliebte sich in einen Privatlehrer. Dieser zog ihr allerdings ihre jüngste Tochter vor und zeugte mit ihr ein Kind. Emilie erlitt einen Nervenzusammenbruch, lebte seit 1897 in einer Heil- und Nervenanstalt und hoffte auf Erholung. Doch die Ärzte hielten sie für geisteskrank und empfahlen dem Ehemann, für sie die Vormundschaft zu übernehmen. Emilie versuchte vergeblich, aus der Anstalt zu fliehen. Sie wurde in eine Baseler Irrenanstalt überführt, wo sie einsam von Familie und Freunden abgeschottet dahinvegetierte, bis sie 1901 mit achtundvierzig Jahren starb.
Ein ähnliches Schicksal erlitt Camille Claudel (1864 — 1943). Die Bildhauerin lebte und arbeitete an der Seite des berühmten Auguste Rodin. Auch sie wurde diskriminiert und in ihrem künstlerischen Schaffen behindert, weil sie sich von Rodin getrennt hatte. Claudel begann zu trinken und vereinsamte. Ihre Familie veranlasste eine gewaltsame Überführung in eine Irrenanstalt, wo sie mehr als 30 Jahre verbrachte, bevor sie am 19. September 1943 starb.
Ungeachtet dieser betrüblichen Lebenswege konnten im Laufe der Jahre und aufgrund der Bemühungen zahlreicher Vorreiterinnen viele Frauen ermutigt werden zu studieren. Im Jahre 1913 waren etwa 8 Prozent aller Studierenden weiblichen Geschlechts. Ihr Anteil stieg bis 1930 auf etwa 16 Prozent. So können wir ab der Jahrhundertwende bis zum Beginn der nationalsozialistischen Strömungen zahlreiche Frauenbiografien lesen, die in akademischen Berufen erfolgreich waren. Zu ihnen gehörten auch zahlreiche Architektinnen: