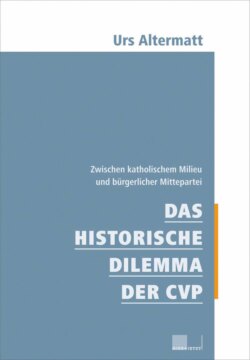Читать книгу Das historische Dilemma der CVP - Urs Altermatt - Страница 10
1.4 STAMMLANDE VERSUS DIASPORA: ZWEI KATHOLIZISMEN, ZWEI POLITIKEN
ОглавлениеNur dreizehn Jahre, von 1957 bis 1970, führte die CVP einen Namen, der eigentlich auf treffende Weise die soziale Identität der Partei umschrieb, wenn man die Partei nicht – fälschlicherweise – auf das Schlagwort «Katholikenpartei» reduzieren will: «Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei».
Durch das ganze 20. Jahrhundert charakterisierte der innerparteiliche Antagonismus zwischen dem konservativen und dem christlichsozialen Flügel die Parteigeschichte. Die Begriffe «konservativ» und «christlichsozial», die übrigens auch die CSU Bayerns für sich in Anspruch nimmt, gehen in ihren Ursprüngen auf die Sozialgeschichte des Schweizer Katholizismus zurück. Dahinter verbergen sich zwei Schwerpunktspole, die die Partei noch im 21. Jahrhundert in sich trägt. Auf dieses Faktum spielte der Zuger Nationalrat Gerhard Pfister wahrscheinlich an, als er in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» 2012 erklärte: «Im Moment haben wir den Status einer Sonderbundpartei, das müssen wir ändern.»1
In der Tat: Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren in der Volkspartei Interessenkonflikte zwischen den Katholiken in den «Stammlanden» und in der «Diaspora» prägende Faktoren. Hat der Politgeograf Michael Hermann Recht, wenn er in einer Zeitungsanalyse die CVP als «eine Partei aus Flügeln, jedoch ohne Rumpf» bezeichnet hat?2
Konfession als Bindemittel zweier Welten
Die Verfassung von 1848 brachte die Niederlassungs- und Religionsfreiheit für die Christen aller Bekenntnisse, für die Juden erst 1866 beziehungsweise 1874.3 Dank der rasanten Industrialisierung führte die Personenfreizügigkeit zu einer fortschreitenden Binnenwanderung. Bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts lebten mehr Katholiken ausserhalb der früheren Sonderbundskantone Luzern, Freiburg, Wallis, Uri, Ob- und Nidwalden, Schwyz und Zug.
Die Kulturkämpfe der 1840er-Jahre bewirkten eine Verkonfessionalisierung der Politik, was zur Folge hatte, dass sich die kirchentreuen und politisch aktiven Katholiken der gesamten Schweiz zusammenschlossen. Während die altkonservativen Eliten der Sonderbundskantone die Stärkung der Stammland-Bollwerke als oberstes Ziel verfolgten, nutzte die junge Schule des «Studentenvereins», der als einziger Verein die Sonderbundskatastrophe von 1847 überlebt hatte, die liberal-demokratischen Freiheitsrechte, um das weitgehend zerstörte Vereins- und Zeitungswesen wieder aufzubauen.
Aus diesen sozialen und politischen Entwicklungen entstanden zwei Katholizismen, die bis zum Ersten Weltkrieg die katholisch-konservative Politik prägten: der Stammland- und der Diasporakatholizismus. Nach ihrer Niederlage mussten sich die Eliten der Sonderbundskantone den politischen Realitäten anpassen. Der Luzerner Politiker Philipp Anton von Segesser und die Urschweizer Landammänner waren der Meinung, die katholisch-konservative Politik erlange nur dann gestaltende Kraft im Bundesstaat, wenn katholische Kantonalstaaten als modernisiertes «corpus catholicum» mit ihrem Gewicht die schweizerische Politik mitbestimmten. Daraus folgerten sie einerseits eine klare Opposition zum freisinnig dominierten Bundesstaat und andererseits die politische Rückeroberung der katholischen Sonderbundskantone, die sie «Stammlande» nannten.4
Hinter dem Begriff «Stammlande» verbarg sich die politische Strategie der im Bürgerkrieg geschlagenen und von den Posten des Bundesstaats weitgehend ausgeschlossenen Sonderbündler, ihre regionale Identität im Bundesstaat zu erhalten. In der national-liberalen Geschichtsschreibung wurde dieses Stammland-Konzept zu lang als hinterwäldlerischer und rückwärtsgewandter Hyperföderalismus gedeutet.
Als Diasporakatholizismus bezeichnete man die Glaubens- und Lebenswelt der Katholiken ausserhalb der Stammlande. Wie der Kirchenhistoriker Franz Xaver Bischof schreibt, nimmt der aus dem Griechischen stammende Begriff «Diaspora» auf die zahlenmässigen Konfessionsverhältnisse Bezug und steht für «jede unter einer andersgläubigen Mehrheit lebende religiöse Minderheit».5 In der Terminologie der katholisch-konservativen Eliten bezog sich allerdings Diaspora nicht in erster Linie auf die zahlenmässige Stärke des katholischen Volksteils, sondern auf die Stellung des parteipolitischen Katholizismus in den Kantonen. Wichtiger als die konfessionelle Minderheitensituation war die Tatsache, dass die Katholisch-Konservativen ausserhalb der Stammlande in keinem Kanton eine stabile Regierungsmehrheit besassen und als Minderheitspartei Oppositionspolitik betreiben mussten.
Neben den klassischen Diasporakatholizismen in den ursprünglich protestantischen Kantonen Zürich, Bern (mit dem 1815 dazu gekommenen katholischen Nordjura und dem Laufental), Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Waadt, Neuenburg und Genf (mit den 1815 zugeteilten katholischen Gemeinden) zählten auch die Katholizismen der konfessionell gemischten (d. h. paritätischen) Kantone Glarus, Graubünden, Aargau, Thurgau und St. Gallen sowie die ursprünglich katholischen Nicht-Sonderbundskantone Tessin und Solothurn (mit dem reformierten Bucheggberg) dazu. Je nach ihrer zahlenmässigen Stärke waren hier die Katholisch-Konservativen als Minderheit in der Regierung vertreten oder standen völlig ausserhalb der kantonalen Regierung.
Mit der Industrialisierungswelle am Ende des 19. Jahrhunderts wanderten Innerschweizer, Freiburger und Walliser als erste Migranten in die industrialisierten Zentren des Mittellandes aus. Sie waren für die protestantischen Einheimischen «Fremde», was in der Geschichtsschreibung lange übersehen worden ist. Die dem politischen Katholizismus verbundenen Einwanderer bauten in der Diaspora katholische Vereine und Parteien auf, die einen sozialreformerischen, das heisst christlichsozialen Kurs einschlugen. Im Unterschied dazu konnten sich die Parteien in den Stammlanden auf eine gewerblich-agrarische Wählerbasis mit einer ausgeprägt bürgerlich-konservativen Elite stützen.
Diese unterschiedlichen Strukturen hatten zur Folge, dass in der Landespartei zwei Katholizismen mit unterschiedlichen Zielen und Strategien entstanden. Als Bindemittel wirkte die katholische Konfession, die den weltanschaulichen Zusammenhalt vermittelte, der die soziökonomischen und kulturellen Gegensätze zu überwinden half. Dabei entwickelten die Vorgängerparteien der CVP spezielle neokorporativistische Ausgleichsmechanismen, die die Eliten steuerten, um die Einheit der Landespartei zu erhalten.
Vom Ende der hundertjährigen Alleinherrschaft in den konservativen Stammlanden
In der konkreten Politik waren die im Bürgerkrieg unterlegenen Katholisch-Konservativen nach 1848 bestrebt, die von der Siegerpartei aufgezwungenen radikal-liberalen Regimes so rasch als möglich abzulösen. Traumatisiert durch den Bürgerkrieg und die Willkür der freisinnigen Bundesgewalt, verbanden sich katholische Konfession und Regionalismus zu einer Allianz, die die Machtstellung der Katholisch-Konservativen im Zeichen eines gegen Bundes-Bern gerichteten Affekts über mehr als ein Jahrhundert am Leben erhielt.
Mit Hilfe der katholischen Kirche gelang es so der katholisch-konservativen Bewegung, die Herrschaft in den Landsgemeindekantonen Uri, Schwyz und Ob- und Nidwalden in kürzester Zeit zurückzugewinnen. Berühmt geworden ist der Fall des liberalen Nidwaldner Nationalrats Johann Melchior Joller, der nach inszenierten Spukgeschichten in seinem Stanser Haus aus seiner Heimat emigrierte und in die päpstliche Armee in Rom eintrat.6 In Freiburg erfolgte der Umschwung 1856 und im Kanton Luzern im Jahr 1871.
Als die neue Bundesverfassung 1874 in Kraft trat, waren die Regierungen aller Sonderbundskantone wieder in den Händen der katholisch-konservativen Partei, die ihre Kantone zu Bollwerken im Bundesstaat ausbauten, in denen sich die katholisch-konservativen Kräfte zurückziehen und sich regenerieren konnten. Die Erfolge hatten ihre Kehrseite und förderten den defensiven Réduitgeist, der sich nicht nur gegen Zentralisierungen des Bundesstaats wandte, sondern aus Angst vor zentralistischen Organisationen sogar die Gründung einer eigenen Landespartei hemmte.
Erst die kulturelle Integration der Katholiken in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erschütterte die katholisch-konservativen Hegemoniestellungen. In den 1990er-Jahren gelang der SVP der Einbruch in die Stammlande, indem die Nationalkonservativen die in Jahrzehnten gewachsene Abwehrhaltung gegen jedwelche Zentralisierung in einen Protest gegen das Europa Brüssels umfunktionierten und im kollektiven Gedächtnis an den Kampf der Alten Eidgenossen gegen fremde Vögte appellierten. Damit lockte die SVP Teile der Katholisch-Konservativen, die durch das Bindemittel des katholischen Milieus nicht mehr genügend zusammengehalten wurden, in die nationalkonservative Partei.
Mit Verspätung auf die Mittelland-Schweiz entfaltete die Moderne auch in den katholisch-konservativen Stammlanden ihre Erosionskräfte.7 In Freiburg büsste die Partei 1966 im Grossen Rat und 1981 in der Regierung die absolute Mehrheit ein, und 1982 folgte als erster Innerschweizer Kanton das wirtschaftlich aufstrebende Zug. Um die Mitte der 1980er-Jahre besassen die Christlichdemokraten noch in den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Wallis und Appenzell Innerrhoden die absolute Mehrheit.
Doch schon 1987 verlor die Luzerner CVP die Mehrheit im Kantonsparlament, während sie diese in der Regierung bis 2005 halten konnte. Ende der 90er-Jahre brachte der SVP-Aufstieg auch die Parteienlandschaft in der Urschweiz durcheinander. In Schwyz verlor die CVP 1988 die Mehrheit im kantonalen Parlament, 2004 in der Regierung.
Diesen Verlusten in den Kantonsregierungen gingen Rückschläge bei den doppelten Ständeratsvertretungen voraus.8 Den Anfang machte der Kanton Luzern mit der Wahl des freisinnigen Christian Clavadetscher im Jahr 1955. Das war eine Zäsur, denn bis in die Mitte des 20.Jahrhunderts hatte die CVP in den ehemaligen Sonderbundskantonen alle vierzehn Ständeratsmandate inne, eine Regel, von der es temporäre Ausnahmen gab. Gerade weil die CVP in den Stammlanden über hundert Jahre stabile Hochburgen besass, stellte der Verlust der Doppelmandate in der Kleinen Kammer ein Alarmzeichen dar, das als Fanal für das Ende einer Ära gedeutet werden konnte.
1971 büssten die Christlichdemokraten einen Ständeratssitz in Zug ein, 1979 in Freiburg und 1991 in Schwyz. 1998 verloren sie in Obwalden das einzige Ständeratsmandat. Der Tiefpunkt war erreicht, als die Christlichdemokraten 2011 wegen innerparteilicher Streitigkeiten den einzigen ihnen verbliebenen Ständeratssitz im Kanton Schwyz an die SVP abgeben mussten. Zum ersten Mal seit 1848 stellt die CVP Schwyz keinen Ständerat. Der Kanton Wallis ist der letzte Kanton, in welchem die Christlichdemokraten mit ihren beiden Flügeln 2011 die zwei Ständeratssitze halten konnten. Nur dank der kleinen Urschweizer Kantone konnte die CVP 2011 im Ständerat ihre relative Stärke von 13 Sitzen aufrechterhalten.
Nachhaltiger Aufstieg der Christlichsozialen in den paritätischen und Diasporakantonen
Die 1880er-Jahre bildeten eine «Sattelzeit», die die Gesellschaft und damit auch die Politiklandschaft von Grund auf veränderte. Die Binnenwanderung und der Ausbau der Volksrechte zeitigten Rückwirkungen auf das Parteiwesen. So hatten die ansteigenden Katholikenzahlen ausserhalb der Stammlande neue Parteigründungen zur Folge; und es waren die sogenannten Diasporakatholiken, die um 1900 mit Vehemenz eine Landespartei forderten.
Der Aufstieg des Diasporakatholizismus kann in drei Phasen eingeteilt werden. In den paritätischen Kantonen Graubünden und St. Gallen kamen die Katholisch-Konservativen schon vor 1874 in die Regierung. In diesen Kantonen mit starken katholisch-konservativen Minderheiten entwickelte sich bereits im 19. Jahrhundert eine Art freiwilliger Proporz. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden die Aargauer, Solothurner, Thurgauer und Glarner ebenfalls regimentsfähig, 1885 im Aargau, 1887 in Solothurn, 1895 im Thurgau. Diese Erfolge verliefen parallel zum erstmaligen Einsitz im Bundesrat im Jahr 1891.
Bereits Ende der 1860er-Jahre war es im politisch turbulenten Kanton Tessin den Konservativen gelungen, während einer Periode die Mehrheit zu erobern. Nach den Tessiner Unruhen, die dem katholisch-konservativen Regierungsrat Luigi Rossi 1890 das Leben gekostet hatten, führte der vom Bundesstaat erzwungene Proporz 1892 zu einer permanenten Regierungsbeteiligung im Südkanton.
Um die Zeit des Ersten Weltkriegs setzte die zweite Phase ein. Die Einführung des Proporzwahlrechts auf eidgenössischer Ebene ermöglichte es den christlichdemokratischen Diasporakatholiken in den städtischen Zentren der reformierten Schweiz, Vertreter in den Nationalrat zu entsenden. 1917 kam der bekannte Basler Advokat Ernst Feigenwinter und 1919 der Redaktor an den «Neuen Zürcher Nachrichten» Georg Baumberger in den Nationalrat. 1928 entsandten auch die Baselbieter einen Katholisch-Konservativen in die Volkskammer. Schwieriger war es für die Christlichdemokraten in diesen Kantonen, einen Vertreter in die Kantonsregierung zu entsenden. In Basel und Genf gelang dies für gewisse Perioden am Ende des Ersten Weltkriegs, in Baselland 1936.
Erst 1963 – und das war die dritte Phase – eroberten auch die Zürcher Christlichsozialen einen Regierungssitz, den sie allerdings 1975 wieder abgeben mussten, bis sie ihn 1993 zurückgewannen und 2011 wieder verloren. Bisher waren die Christlichdemokraten in den Kantonen Bern, Schaffhausen, Waadt, Neuenburg und Appenzell Ausserrhoden nicht in den Kantonsregierungen vertreten.
Die Nichtberücksichtigung der christlichdemokratischen Nordjurassier in der Berner Regierung war eine der Antriebsfedern für die Gründung des Kantons Jura. Ohne dass die Medien dies speziell beachten, nimmt die CVP im Kanton Jura daher eine starke Stellung ein, was mit ihren Verdiensten bei der Kantonsgründung 1978 zu erklären ist.
Heimliche Macht der Stammlande über den Ständerat
Wenn ich die Entwicklung seit 1848 überblicke, komme ich zu folgenden Schlussfolgerungen:
1. Die total revidierte Bundesverfassung von 1874 bildete für die Christlichdemokraten eine Zäsur. Diese hatte zur Folge, dass in den Volksabstimmungen jede Stimme zählte. Damit verloren die auf sich bezogenen kantonalen Bastionen der Stammlande in der Partei ihre unbestrittene Vormachtstellung. Die Stimme des katholisch-konservativen Solothurners zählte ebenso viel wie diejenige des Innerschweizers und Wallisers. Erst die Referendumsstärke gab den Katholisch-Konservativen das notwendige Gewicht, um auf Bundesebene von der Oppositionsbank in die Regierung zu wechseln.
2. Nach der Einführung des Proporzwahlrechts im Ersten Weltkrieg beschleunigte sich die innerparteiliche Gewichtsverlagerung von den Stammlanden in die Ausser-Schweiz. 1919 entsandten die Katholisch-Konservativen der Stammlande 20 Nationalräte in die Volkskammer, die übrigen Kantone bereits 21. Die St. Galler Konservativen allein zählten 1919 mehr Parteiwähler als die Urschweizer Kantone zusammen.
3. In den Spitzenämtern der Partei wiederspiegelte sich diese Machtverschiebung äusserst langsam. Die Stammlande gaben ihre Macht nur schrittweise ab. Geht man die Liste der Fraktionspräsidenten seit 1848 durch, standen bis 1900 nur Politiker aus den Stammlanden an der Spitze.
Von 1902 bis 1911 führten erstmals zwei Politiker von Regionen ausserhalb der Stammlande die Fraktion, der Bündner Caspar Decurtins (1902–1905) und der St. Galler Othmar Staub (1905–1911). Später folgten der Thurgauer Alfons von Streng (1914–1919), der Aargauer Emil Nietlispach (1940–1942), der St. Galler Thomas Holenstein (1942–1954), der Bündner Giusep Condrau (1954–1960) und der St. Galler Kurt Furgler (1963–1971). Im Unterschied dazu gelangten in der Landespartei regelmässig Politiker von ausserhalb der Stammlande zum Präsidentenamt. Zu erwähnen ist als Erster 1932 der St. Galler Eduard Guntli. Es folgten der Aargauer Emil Nietlispach (1935–1940), der Aargauer Max Rohr (1950–1955), der Italienischbündner Ettore Tenchio (1960–1968), die St. Gallerin Eva Segmüller (1987–1992), der Thurgauer Philipp Stähelin (2001–2004) und die Aargauerin Doris Leuthard (2004–2006).9
4. Wie die Staaten in den USA entsenden alle Kantone gleich viele, nämlich zwei Ständräte, in die Kleine Kammer. Dieser föderalistische Grundsatz privilegiert die kleinen Kantone. Im Ständerat lebt auf diese Weise das Konzept der Stammlande in veränderter Weise fort, weshalb die CVP mit ihren 13 Sitzen auch noch nach 2011 eine bestimmende Rolle im interfraktionellen Kräfteparallelogramm des Ständerates einnimmt.
5. Bis 1950 besass die katholische Weltanschauung genügend Integrationskraft, um die Gegensätze zwischen den agrarisch-gewerblichen Stammlanden und den sozialreformerischen Christlichdemokraten in den urbanen Mittelland-Agglomerationen zu überwinden. Mit Hilfe von innerparteilichen Entscheidungsmechanismen entwickelte sich ein Ausgleich zwischen den Konservativen und den Christlichsozialen. Mit dem Zusammenbruch des Milieukatholizismus seit den späten 60er-Jahren begann dieses Band zu zerreissen. Innerhalb der Partei verschärften sich die Konflikte.
Obwohl die Reformer von 1970 eine Homogenisierung der Landespartei anstrebten, wurden die innerparteilichen Konflikte seit den 80er-Jahren stärker. Wenn der Politgeograf Hermann im Vergleich mit der deutschen Schwesterpartei in der CVP einen vermittelnden «Rumpf» vermisst, ist ihm teilweise zuzustimmen. Wie indessen das Beispiel der CSU Bayerns zeigt, lassen sich die konservativen und christlichsozialen Flügel unter einem Dach vereinen, sofern ein gemeinsamer Nenner – im Fall Bayerns die regionale Identität – vorhanden ist. Welches Kohäsionsmittel nach dem Wegfall des K (= katholisch) in der CVP zur Verfügung steht, bleibt die Kardinalsfrage.