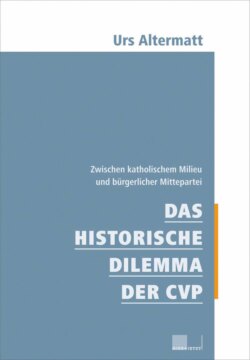Читать книгу Das historische Dilemma der CVP - Urs Altermatt - Страница 8
1.2 VON DER HINTERBANK IM PARLAMENT ZUM SCHARNIER IN DER ZAUBERFORMEL-REGIERUNG
ОглавлениеDer Gründung des Bundesstaats im Jahr 1848 ging eine rund 50-jährige Periode von Revolutionen und Gegenrevolutionen voraus.1 Verfassungsänderungen und Regierungsstürze, Putschs und Staatsstreiche, Volksaufstände und Befreiungsbewegungen, kurz politische Gewalt beherrschten vorab in den 1840er-Jahren die eidgenössische Politik. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren. 1839 erregte die Wahl eines liberalen Theologieprofessors an die Zürcher Universität das fromme reformiertkonservative Landvolk so sehr, dass daraus eine Volksbewegung entstand, die zum Sturz der freisinnigen Zürcher Regierung führte. 1845 fiel im Kanton Luzern der konservative Bauernführer Josef Leu von Ebersoll einem politischen Attentat zum Opfer.
Die Auseinandersetzungen zwischen den Radikal-Liberalen und den Katholisch-Konservativen (so lauteten die zeitgenössischen Parteibezeichnungen) erreichten Mitte der 1840er-Jahre einen ersten Höhepunkt. Als Gegenaktion auf die Berufung der Jesuiten nach Luzern organisierten die Radikalen zwei interkantonale Befreiungsbewegungen zum Sturz des ultramontan-katholischen Luzerner Regimes. Zum Schutz gegen die Freischarenzüge bildete sich 1845 der «Sonderbund» der sieben katholisch-konservativen Kantone Luzern, Freiburg, Wallis, Uri, Schwyz, Zug, Ob- und Nidwalden. Die Schweiz spaltete sich faktisch in zwei Teile auf. Im Spätherbst des Jahres 1847 löste die radikal-liberale Bundesmehrheit in einem Bürgerkrieg den Sonderbund mit Waffengewalt auf. Der Weg zur Gründung des modernen Bundesstaats war frei.
1848–1874: «Bürger zweiter Klasse» im neuen Bundesstaat
Die freisinnige Siegerpartei errichtete aus Furcht vor einer konservativen Restauration ein Ausschliesslichkeitsregime, in dem für die Verlierer des Bürgerkriegs kein Platz war. Als Vaterlandsfeinde und Sonderbündler verfemt und als ultramontane und jesuitische Reaktionäre verachtet, wurden die Katholisch-Konservativen aus der freisinnig-eidgenössischen Gemeinschaft des neuen Bundesstaats ausgeschlossen.
Die Lage der katholisch-konservativen Partei war in den Kantonen nicht besser als im Bund. Mit Hilfe des eidgenössischen Militärs und der kantonalen Marionetten der Sieger von 1847 hatten sich in den Sonderbundskantonen freisinnige Willkürherrschaften installiert. Nur gerade die drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden liessen sich nicht völlig gleichschalten.
Vor diesem Hintergrund versteht man, dass die katholisch-konservative Opposition in der Anfangszeit im Parlament des Bundesstaats ein Hinterbänkler- und Aschenbrödeldasein fristete. Auf Bundesebene war sie eine diskriminierte und exkommunizierte Minderheit, eine machtlose und vielfach rechtlose Opposition, die froh sein durfte, dass sie von der freisinnigen Staatspartei nicht noch mehr schikaniert wurde. Die katholisch-konservative Opposition marschierte im Bundesstaat neben der Entwicklung her, die sie kaum beeinflussen konnte. Vom Luzerner National- und Regierungsrat Philipp Anton von Segesser stammt das Wort: «Für mich hat die Schweiz nur Interesse, weil der Canton Luzern – dieser ist mein Vaterland – in ihr liegt. Existirt der Canton Luzern nicht mehr als freies, souveränes Glied in der Eidgenossenschaft, so ist mir dieselbe so gleichgültig als die grosse oder kleine Tartarey.»2
Notgedrungen zogen sich die Katholisch-Konservativen vor dem Zugriff der radikalen Alleinherrschaft in jene Bereiche der Gesellschaft zurück, wo der Freisinn an seine Grenzen stiess: in die Kantone und in die Kirche. So machten sich die Katholisch-Konservativen unmittelbar nach 1848 an die Rückeroberung ihrer «Stammland»-Kantone. Bereits 1850 kam es in Zug zu einem Regierungswechsel, 1856 folgte Freiburg und 1857 das Wallis. Zehn Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs hatten die Katholisch-Konservativen mit Ausnahme von Luzern alle Sonderbundskantone wieder fest in der Hand. Der Umschwung in Luzern erfolgte 1871 im Zeichen des aufkommenden Kulturkampfes.
Über das Gebiet des früheren Sonderbundes kam die katholisch-konservative Rückeroberung nicht hinaus. Kein reformierter Kanton wechselte das Lager. Das konservative Regime in Bern von 1850 bis 1854 blieb Episode. Auf die Dauer gesehen bedeutete der Ausfall Berns den Verlust der protestantischen Variante im politischen Konservativismus.
Die starre Ausschliesslichkeitspolitik der freisinnigen Gründungsväter milderte sich erst, als sich der Bundesstaat über die kritischen Anfangsjahre hinweg konsolidiert hatte. Der Aufbau des modernen Industriestaats mit Eisenbahnen und Fabriken zwang die ehemaligen Bürgerkriegsgegner zur Zusammenarbeit auf politischer und wirtschaftlicher Ebene.
Die weltanschaulichen Konflikte traten hinter die praktischen Fragen des politischen Alltags zurück. Noch waren die Katholisch-Konservativen strikt von den eidgenössischen Regierungspfründen ausgeschlossen, doch die Alltagspolitik begann sie in den bestehenden Bundesstaat zu integrieren. Sie verstanden sich mehr und mehr als loyale Opposition und wollten auch als solche vom Freisinn behandelt werden. Die Wunden des Bürgerkriegs schienen in der zweiten Hälfte der 1860er-Jahre allmählich zu vernarben. Da brachen die alten Gegensätze Anfang der 1870er-Jahre mit der unheilvollen Verquickung von Bundesrevision und Kulturkampf neu auf.
1874–1891: Fundamentalopposition gegen das freisinnige «System»
Das Jahr 1874 bildete mit der Totalrevision der Bundesverfassung eine wichtige Zäsur in der eidgenössischen Politik. Unter Ausnützung der Kulturkampfstimmung gelang es der freisinnigen Regierungspartei, die Katholisch-Konservativen zu isolieren und damit das Revisionsprojekt im zweiten Anlauf durchzubringen.
In der Rückschau gesehen erwies sich der kulturkämpferische Antikatholizismus des Freisinns als Bumerang. Der Kampf des antiklerikalen Freisinns mobilisierte die Massen des kirchentreuen katholischen Volksteils. Wie nie zuvor wurden die katholische Kirche und ihre Vereine zu einem Rückzugsgebiet und Aufmarschfeld gegen den freisinnigen Zeitgeist und seine Partei. Der politische Konservativismus nahm nun endgültig konfessionelle Züge an. Die konservativen Katholiken zogen sich in eine katholische Sondergesellschaft zurück, in der sie sich heimisch einrichteten und zum Kampf gegen den Radikalismus antraten. Um Zeitungen, Vereine und Parteien begannen sie die katholisch-konservative Volksbewegung auf breiter Front aufzubauen. Im Jahr 1871 begannen in Luzern das «Vaterland» und in Freiburg «La Liberté» als Zentralorgane der katholischen Schweiz zu erscheinen.
Der Kulturkampf hatte zur Folge, dass sich der politische Katholizismus konsolidieren konnte. Er vermochte seine Positionen in den Stammlandkantonen zu soliden Bastionen auszubauen und in den Kantonen ausserhalb des alten Sonderbundes Fuss zu fassen. So erzwangen sich die Katholisch-Konservativen zunächst in St. Gallen und im Tessin den Eintritt in die Kantonsregierung. In den 1880er- und 90er-Jahren folgten die Kantone Aargau, Glarus, Solothurn, Graubünden und Thurgau nach.
Ein weiterer Aspekt kam hinzu. Hatte die katholisch-konservative Opposition in den Eidgenössischen Räten von 1848 bis 1874 eine unbedeutende und von der freisinnigen Staatspartei mehr oder weniger ignorierte Minderheit dargestellt, so wuchs sie nach 1874 dank des direktdemokratischen Referendums zu einem ernstzunehmenden Faktor in der eidgenössischen Politik heran. In zahlreichen Referendumsabstimmungen machte sie gegen das freisinnige Bundesregime erfolgreich Opposition und kompensierte damit ihre Aussenseiterrolle in Parlament und Regierung.
Unter der Fahne des Föderalismus scharte sie von Abstimmung zu Abstimmung eine wechselnde Koalition von unzufriedenen Kampfgenossen zusammen, deren Loyalität zum freisinnigen Bundesstaat bröckelte. Im Jahr 1884 schickte die konservative Protestbewegung ein ganzes Paket von vier verhältnismässig unbedeutenden Gesetzesvorlagen unter dem zügigen Slogan «vierhöckriges Kamel» bachab. «Weniger Staat» lautete die konservative Parole.
Die konservativen Referendumsstürme, die zwischen 1875 und 1884 obstruktionistische Züge angenommen hatten, brachten die freisinnige Regierung ins Wanken, die die bisherige personelle Ausschliesslichkeitspolitik aufgeben musste. 1873/74 präsidierte erstmals ein Katholisch-Konservativer den Ständerat, 1879 nahm zum ersten Mal ein Vertreter katholisch-konservativer Couleur Einsitz ins Bundesgericht. Im Jahr 1887 stieg ein katholisch-konservativer Politiker zum Präsidenten des Nationalrats und damit der Vereinigten Bundesversammlung auf.
Damit begann der lange Marsch der katholisch-konservativen Opposition zur Beteiligung an der Macht im Bundesstaat. Mitte der 1880er-Jahre verlor die Opposition ihren fundamentalisitischen Charakter. Im Programm von 1883 stellte sich die Fraktion auf den Boden der bestehenden Bundesordnung und signalisierte klar ihre Bereitschaft zu konstruktiver Mitarbeit. Die Mehrheit der Katholisch-Konservativen gab ihre Fundamentalopposition gegen den bestehenden Staat auf.
Damit war ein wichtiger Wendepunkt erreicht. Zwischen der freisinnigen Regierungspartei und der katholisch-konservativen Opposition begann sich auf der sachpolitischen Ebene ein Basiskonsens einzuspielen. Dieser Konsens entzog der radikalen Ausschliesslichkeitspolitik ihre Daseinsberechtigung. Der historische Kompromiss stand vor der Tür.
Doch wie im Drehbuch eines Dramas spitzte sich der Gegensatz vor der endgültigen Aussöhnung nochmals explosiv zu. Im September 1890 stürzte ein radikaler Putsch die konservative Regierung im Tessin. Damals wurde zum letzten Mal in der Geschichte des Bundesstaats ein amtierender Regierungsrat das Opfer eines politischen Attentats. Eidgenössische Truppen marschierten im Südkanton ein, stellten Ruhe und Ordnung her und liessen über eine Volksabstimmung den Regierungsproporz in der Verfassung verankern. Damit kehrte im Tessin nach jahrzehntelangen blutigen Parteikämpfen endlich Ruhe ein.
Man spürte es allenthalben: Die langsame Agonie der freisinnigen Hegemonie hatte eingesetzt. In einem letzten trotzigen Aufbäumen verwehrte die regierende Staatspartei im Jahr 1890 aus kulturkämpferischen Ressentiments heraus den Katholisch-Konservativen nochmals den Eintritt in die Landesregierung. Hartnäckig verteidigte sie ihre Monopolstellung. Der freisinnige Affront löste bei der oppositionellen Minderheit Verbitterung aus. Das deutschschweizerische Zentralorgan «Vaterland» schrieb: «Alle Minoritäten werden vergewaltigt.»3
1891–1943: Juniorpartner in der «Bürgerblock»-Regierung
Anfang der 1890er-Jahre wurde die Krise des freisinnigen Regierungssystems offenkundig. Wenn man verhindern wollte, dass das politische System der Schweiz völlig unregierbar wurde, musste die katholisch-konservative Opposition über kurz oder lang in die Landesregierung integriert werden.
1891 war es endlich so weit. Den Anstoss gab eine eidgenössische Staatskrise kleineren Ausmasses. Als eine Vorlage für die Verstaatlichung von Eisenbahnen vom Schweizer Volk verworfen wurde, trat der Vorsteher des Post- und Eisenbahndepartementes 1891 gegen alle bisherigen Bräuche zurück. Damit offenbarte sich die Krise des bisherigen freisinnigen Ausschliesslichkeitsregimes vor aller Öffentlichkeit. Der Freisinn fing die Regierungskrise dadurch auf, dass er der katholisch-konservativen Opposition einen Platz in der Landesregierung anbot.
Mit dem Einzug des Luzerners Josef Zemp in den Bundesrat erlangten die Katholisch-Konservativen 1891 den Status einer regimentsfähigen Regierungspartei. Allerdings verstanden sie sich gleichzeitig weiterhin fallweise auch als Oppositionspartei, ein Begriff, der für sie «Kampf dem System» bedeutete, denn mit einem einzigen Bundesrat waren sie in der Landesregierung weit untervertreten. Als Volkspartei sahen sie sich als Gegensatz zur «Beamten- und Herrenpartei», lies: zur «classe politique».
Um die Jahrhundertwende von 1900 liess der Druck des aufkommenden Sozialismus die bisherigen Protagonisten zu einer bürgerlich-konservativen Sammlungsbewegung zusammenrücken. Dabei behielt der Freisinn nach wie vor das Zepter der Macht fest in der Hand – dank der absoluten Mehrheit im Parlament und im Bundesrat. Die konservativen Katholiken blieben auch fortan das, was sie bisher waren, Eidgenossen zweiter Klasse, die von den Gnadenerweisen der freisinnigen Mehrheitspartei abhängig waren. Im Gegensatz zu den ersten Jahrzehnten des Bundesstaats hatten sie nun aber das Stigma von Sonderbündlern verloren und konnten sich als gute Patrioten präsentieren.
Damit das Parteivolk beieinander blieb, liess man die weltanschaulichen Gegensätze weiter bestehen. So behielt der Konfessionalismus beiderseits seine Funktion, denn er hielt die Massen zusammen und ermöglichte es, diese bei Bedarf zu mobilisieren.
Der Landesstreik, den die sozialistische Linke 1918 ausrief, schuf eine bürgerkriegsähnliche Lage. Nun formte sich der «Bürgerblock» endgültig heraus. In der kritischen Stunde von 1918 legten die konservativen Katholiken den Beweis ihrer Staatstreue ab und stellten sich auf die Seite des von ihnen jahrelang bekämpften freisinnigen Staats. Damit stärkten sie ihre Stellung in der antisozialistischen Bürgerblock-Regierung.
Für das reale politische Gewicht war ausserdem wichtig, dass die 1919 erstmals durchgeführten Proporzwahlen der bisherigen freisinnigen Vorherrschaft in den eidgenössischen Räten ein Ende setzten. Der Freisinn verlor die absolute Mehrheit und war nunmehr auf bürgerliche Koalitionspartner angewiesen. Aus diesem Grund baute er die Zusammenarbeit mit den Katholiken aus und gestand ihnen 1919 einen zweiten Sitz im Bundesrat zu. Die Katholisch-Konservativen stiegen zum Juniorpartner in der freisinnig dominierten Landesregierung auf.
1929 nahm auch die agrarische Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) Einsitz in den Bundesrat. Damit hatte sich der antisozialistische Bürgerblock zwischen Freisinn, politischem Katholizismus und reformiertem Bauerntum formiert. Ein Bürgerblock, der die Schweiz der Zwischenkriegszeit im Zeichen eines mehr oder weniger militanten Antisozialismus regierte.
Den Ton in der Bundespolitik gab weiterhin der Freisinn an. Er besass im Bundesrat immer noch die absolute Mehrheit. Die grössere Regierungsverantwortung integrierte die Katholiken unter der Führung des legendären Fraktionspräsidenten Heinrich Walther stärker denn je in den bestehenden Bundesstaat. Aus Angst, die schwer erkämpfte Stellung im helvetischen Machtkartell wieder zu verlieren, benahmen sie sich oft antisozialistischer als der bürgerliche Freisinn, nationaler als die freisinnige Staatspartei.
Auch auf kantonaler Ebene konnten die Katholiken ihre Stellungen ausbauen. Nach dem Ersten Weltkrieg stiessen sie in die Regierungen von Diasporakantonen vor, so in Genf und in Basel-Stadt, etwas später, in der Mitte der 30er-Jahre, auch in Basel-Landschaft.
1943–1959: Zauberformel als Folge einer schwarz-roten Allianz
Mitte der 30er-Jahre schwächten sich die Konflikte zwischen Bürgertum und Sozialdemokratie ab. Die bisherigen Klassenfeinde rückten unter dem innenpolitischen Einfluss der Wirtschaftskrise und der aussenpolitischen Bedrohung durch den Faschismus zusammen. Die Sozialisten gaben ihre Fundamentalopposition gegen den bürgerlichen Staat und seine Gesellschaft auf. 1935 bekannte sich die Sozialdemokratische Partei zur Landesverteidigung, 1937 schlossen die Gewerkschaften das berühmt gewordene Friedensabkommen in der Metall- und Uhrenindustrie ab. Der parteipolitische Burgfriede zwischen der Sozialdemokratischen Partei (SP) und bürgerlichen Parteien war etabliert, die soziale Partnerschaft zwischen sozialistischen Gewerkschaften und kapitalistischen Unternehmern organisiert. Die Sozialdemokraten waren bereit, in die Landesregierung einzutreten.
Es war nun nur eine Frage der Zeit, bis der Freisinn seine Vormachtstellung im Bundesrat aufgeben musste. Seit 1919 hatten die Freisinnigen bei den eidgenössischen Wahlen ständig leicht an Boden verloren. In den 30er-Jahren wurden sie von den Sozialdemokraten als stärkste Partei überflügelt, und nach den Wahlen von 1943 beziehungsweise 1951 mussten sie ihre bisherige Stellung als stärkste Fraktion der Bundesversammlung an die Katholisch-Konservativen abtreten.
Der sozialdemokratische Regierungseintritt war nicht mehr aufzuhalten. Bei den Bundesratswahlen von 1940 wäre es vermutlich so weit gekommen, wenn die bürgerlichen Wahlstrategen nicht allzu stark auf das faschistische Ausland Rücksicht genommen hätten. Als sich die internationale Lage zugunsten der Alliierten wandelte, stiegen die Chancen eines sozialdemokratischen Bundesrats in der neutralen Schweiz. Nach den Nationalratswahlen von 1943 nahm mit dem Zürcher Stadtpräsidenten Ernst Nobs erstmals ein Sozialdemokrat im Bundesrat Einsitz, ein Landesvater, der rund 25 Jahre vorher als Teilnehmer am Landesstreik in einem Zürcher Bezirksgefängnis gesessen hatte. Auf diesem Weg verloren die Freisinnigen nach fast 100-jähriger Vorherrschaft die Mehrheit in der Landesregierung. Gleichzeitig mussten sie 1943 zum ersten Mal den Posten des Bundeskanzlers an die Katholisch-Konservativen abtreten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hielt die Politik der Sozialpartnerschaft, des politischen Burgfriedens und der «geistigen Landesverteidigung» an. Die Schweiz befand sich endgültig auf dem Weg zu einer proportionalen Vierparteien-Regierung. Doch wie schon am Ende des 19. Jahrhunderts bäumte sich die freisinnige Regierungspartei nochmals auf, bevor sie von ihrer alten Machtherrlichkeit definitiv Abschied nahm. 1951 rissen die Freisinnigen den Bundeskanzlerposten wieder an sich und brüskierten damit ihren bürgerlichen Regierungspartner, den sie an die Seite der Sozialdemokraten trieben. Die Konservativen begannen damals ihren prononciert vorgetragenen Antisozialismus aufzugeben und machten wie die Democrazia Cristiana in Italien eine Linkswendung. Die innerkatholische Linksöffnung widerspiegelte den Aufstieg des christlich-sozialen Arbeiter- und Angestelltenflügels und entsprach dem durch den Regierungsantritt Papst Johannes XXIII. eingeleiteten Aggiornamento des römischen Katholizismus.
Das gespannte Verhältnis zwischen Konservativen und Freisinnigen verschlimmerte sich zwei Jahre später. Als 1953 der einzige sozialdemokratische Bundesrat nach einer Volksabstimmung über die Finanzordnung unerwartet aus der Landesregierung austrat, kehrten die Sozialdemokraten in stolzer Allüre in den «Jungbrunnen der Opposition» zurück. Aus der heutigen Perspektive wäre es nun nahegelegen, den freigewordenen Bundesratssitz den Katholisch-Konservativen zu überlassen. Doch die Freisinnigen eroberten den frei gewordenen Zürcher Sitz zurück und besassen mit vier Sitzen wieder die absolute Mehrheit im Bundesrat.
Die Rückkehr zur freisinnigen Vorherrschaft war freilich von kurzer Dauer. Ein Jahr später, 1954, beendete eine informelle schwarz-rote Allianz die freisinnige Hegemonie. Die Christlichdemokraten – so kann man sie nach 1950 nennen – errangen den dritten Sitz in der Landesregierung und stiegen zum gleichberechtigten Partner in der nunmehr wieder bürgerlichen Landesregierung auf. Endlich hatte die Partei die lang erstrebte Parität mit dem freisinnigen Seniorpartner erreicht.
Die 1954er-Formel war eine Übergangslösung. Der Rücktritt von vier Bundesräten im Jahr 1959 schuf die Voraussetzung für eine vollständige Umkrempelung der parteipolitischen Zusammensetzung der Landesregierung. Als Stratege wirkte im Hintergrund der Generalsekretär der Konservativ-Christlichsozialen Volkspartei Martin Rosenberg. Die «Zauberformel» aus zwei Freisinnigen, zwei Christlichdemokraten, zwei Sozialdemokraten und einem Vertreter der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei war geboren.
Die neue Regierungszusammensetzung schloss einen langen Prozess ab und entsprach den gesellschaftspolitischen Entwicklungslinien, die durch einen wachsenden Pluralismus gekennzeichnet waren und auf eine Beruhigung der politischen Verhältnisse und damit auf eine Proportionalisierung der Landesregierung hinausliefen. Keine Partei war fortan in der Lage, die Regierungsgeschäfte allein zu führen. Die Regierungsarbeit musste möglichst breit abgestützt werden.
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der freiwillige Proporz Schritt für Schritt auch in der Bundesverwaltung Einzug hielt.4 1969 gaben sich 29 Prozent der Chefbeamten als freisinnig aus, 8 Prozent als christlichdemokratisch, 3 Prozent als sozialdemokratisch und 5 Prozent als BGB. Der Rest, rund die Hälfte, war parteilos. Noch kam die Zauberformel in der Bundesadministration nicht voll zum Tragen. Man sprach vom magischen Sesseltanz der Zauberformel bei der Vergabe der Posten.
Historisch gesehen bestand das grosse Verdienst der Zauberformel darin, dass sie die beiden klassischen Minderheiten auf der Basis des freiwilligen Proporzes endgültig in den Bundesstaat einbezog. In der zeitlichen Abfolge versöhnte sich zunächst der ländlich-bäuerlich und gewerblich geprägte Konservativismus in der Form der Katholisch-Konservativen und der BGB mit dem Bundesstaat. Die gesamtgesellschaftliche Säkularisierung beschleunigte nach dem Zweiten Weltkrieg den Abbau letzter Reste des Kulturkampfes. 1963 traten die Christlichdemokraten in die Zürcher Kantonsregierung ein und schlossen damit ihren langen Marsch durch die Kantonalregierungen vorläufig ab.
Nach dem politischen Katholizismus integrierte sich die Sozialdemokratie in die moderne pluralistische und kapitalistische Schweiz. Die wirtschaftliche Hochkonjunktur der Nachkriegszeit ermöglichte den Ausbau des sozialen Wohlfahrtsstaats, der durch ein breites Netz sozialer Einrichtungen den Anliegen der früher klassenkämpferischen Arbeiterbewegung entgegenkam.
Alles in allem besteht die helvetische Konkordanzdemokratie aus einer Koalition wechselnder Minderheiten. Diese Kraftfeldervielfalt darf indessen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wege der drei grossen Regierungsparteien zur Zauberformel unterschiedlich waren. Während sich die konservativen Katholiken aus ihrer spezifischen Konfessionslage heraus von Anfang an mit dem Minderheitenstatus begnügten, hatten die Freisinnigen und Sozialdemokraten zunächst Schwierigkeiten, die Minderheitenrolle zu akzeptieren. Die Freisinnigen, weil sie noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von den goldenen Zeiten freisinniger Machtherrlichkeit träumten, und die Sozialdemokraten, weil sie im klassenkämpferischen Marsch zur Macht dem Traum einer antikapitalistischen Volksmehrheit in einer besseren Zukunft nachhingen.
Zauberformel oder Formelzauber?
Die ersten Jahre der Zauberformel-Regierung fielen in die Zeit der Hochkonjunktur. Der Wirtschaftsboom brachte die Finanzen ein, mit denen die Anspruchsgesellschaft befriedigt und die Profite auf die Gesellschaftspartner verteilt werden konnten. Das helvetische Wirtschaftswunder förderte die Flucht vor der Politik ins Private. Man sprach von der Entideologisierung der Politik. Heftige Parteienkonflikte waren unschicklich und störten die Wohlstandsidylle. Der Bundesrat verwaltete als zentrale Schaltstelle das Land und erliess die Regeln der «formierten Gesellschaft».
In der ersten Hälfte der 1960er-Jahre schlich sich Kritik ins Konkordanzsystem ein. Nonkonformistische Störenfriede sprachen vom «helvetischen Malaise» (Max Imboden). Die Zauberformel geriet ins Gerede und setzte Patina an. Im Überschwang des Reformismus sprachen politische Kommentatoren um die Wahlen von 1971 und 1975 von einer möglichen Mitte-links-Regierung unter Einbezug des «Landesrings der Unabhängigen». Realpolitischen Wert besassen diese intellektuellen Spielereien nicht, da keine der Bundesratsparteien die Zauberformel ernsthaft in Frage stellte.
Die eigentliche Wende kam erst, als 1973/74 eine Rezession über das Land hereinbrach. Das helvetische Malaise begann nun konkrete Formen anzunehmen. Damit wurde das Zauberformel-Kartell brüchig. Die zunehmende Polarisierung der Politik erhöhte die Spannungen zwischen den Bundesratsparteien. Auf der rechten und auf der linken Seite des parteipolitischen Spektrums gewannen Oppositionsbewegungen an Bedeutung. Wie in anderen westlichen Industriestaaten entstanden Alternativbewegungen, die die bewährten politischen Institutionen und Spielregeln fundamental in Frage stellten und eine Art Antipolitik gegen das bestehende System betrieben. Die Sozialdemokraten und die Freisinnigen schlugen eine schärfere Gangart ein, und die auf den Ausgleich ausgerichteten Christlichdemokraten gerieten erstmals ins Wanken.
Die auf Konsens und Harmonie ausgerichtete Zauberformel-Regierung wurde einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt, denn das viel gerühmte Konkordanzsystem konnte die «neuen sozialen Minderheiten» wie zum Beispiel einen Teil der ausländischen «Gastarbeiter», die xenophoben Anti-«Überfremdungs»-Bewegungen und die Jugendbewegungen von 1968 und 1980 nicht mehr richtig integrieren. Eine steigende Zahl von Staatsbürgern misstraute dem Staat, den Parteien und Verbänden und der «classe politique» in Bern. Bei einer schweigenden Volksmehrheit – denken wir an die niedrige Wahl- und Abstimmungsteilnahme – machten sich über die abgekarteten Spiele der «Filzokratie» von Parteien- und Interessenlobbys Argwohn und Verdrossenheit breit. Man diagnostizierte eine Legitimationskrise des politischen Systems. Doch die Zauberformel blieb bestehen und wurde zum Zauberberg, ja zu einer Notformel der helvetischen Konkordanz.
Scharnier im Machtkartell der Vierparteien-Regierung
Von der Minderheitspartei par exellence im Jahr 1848 war die CVP seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in einem langen Marsch durch die politischen Institutionen zur zuverlässigen Regierungspartnerin herangewachsen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Zauberformel-Regierung den Christlichdemokraten wie keiner andern Regierungspartei auf den Leib, auf ihre ideologischen Traditionen und – was nicht unwichtig war – auf ihr Sozialprofil geschrieben.
Als klassische Minderheitspartei trat die CVP seit der Gründung des Bundesstaats für Parität und Proporz aller politischen und sozialen Gruppen in der Gesellschaft ein. Vom sozialen Profil der Wählerschaft her umfasste die Partei von Anfang an ein breites Spektrum; vom Bauern, Gewerbler und Arbeiter bis zum Beamten, Akademiker und Manager. Diese soziale Bandbreite zwang die CVP stets zu einem komplizierten innerparteilichen Konfliktregelungsverfahren. In der Zauberformel-Regierung konnte sie diesen internen Ausgleichsmodus auf die Versöhnung von Gegensätzen in Staat und Gesellschaft anwenden.
Als Partei von Randregionen – ich erinnere an den «Sonderbund» – war die CVP eine konservative Partei, die im politischen Alltag die Politik der kleinen Schritte jener der grossen Entwürfe vorzog. Die konservative Grundhaltung entsprach später dem Politikstil der Zauberformel-Regierung, die auf dem Weg zum helvetischen Kompromiss in der Regel eine Politik der kurzen Schritte und der langen Bank betrieb.
Alle diese Faktoren machten die CVP in den 1950er-Jahren – wie ich schon am hundertjährigen Jubiläum der CVP-Fraktion 1983 festhielt – zur Architektin und bis Ende des 20. Jahrhunderts zum Amalgam der Zauberformel, die in der Vierparteien-Regierung so etwas wie eine Scharnierstellung einnahm und als Mittlerin zwischen dem Freisinn und der Sozialdemokratie politisierte.5 Es verwundert daher nicht, dass die christlichdemokratischen Regierungs- und Parlamentspolitiker daran interessiert waren, das zunehmende Konsensdefizit der Zauberformel seit den 1970er-Jahren durch formelle Absprachen und Mechanismen wie zum Beispiel durch Legislaturziele zu vermindern.
Umgekehrt stärkte die Zauberformel die Stellung der CVP in der Bundespolitik. Die sozial- und wirtschaftspolitische Brückenfunktion nach rechts und nach links ermöglichte ihr einen geradezu spektakulären Positions- und Imagewechsel. Die CVP entfernte sich in den 1960er- und 70er-Jahren endgültig aus dem rechten Spektrum der Parteienlandschaft, in der sich die Katholisch-Konservativen bis in die Weltkriegszeit durchaus heimisch gefühlt hatten, und bewegte sich in die Mitte.
Allerdings blieb die 1971 feierlich proklamierte Formel von der «dynamischen Mitte» im Alltag der konkreten Politik eine Formel ohne deutliches Profil, da sich die Partei in der Regierung nach rechts und nach links an ihre Koalitionspartner anpasste. Unter dem Druck der Rezession verflüchtigten sich die Konturen der «dynamischen Mitte» als eigenständiger «dritter Weg». Von der Scharnierstellung blieb in den Zeiten der Polarisierung oft wenig übrig, vielfach nur die Dynamik auseinander strebender Parteiflügel. Kritische Beobachter warfen der Partei schon kurz nach den Reformen von 1970/71 vor, sie trage ihr Herz auf der linken Seite, mache aber die Politik mit der rechten Hand – nach dem Motto: links fühlen, rechts handeln und in der Mitte regieren.
So paradox es tönt: Mit dem politischen Erfolg in der Regierung setzte als Folge des unscharfen Profils eine schleichende Erosion bei den Wählern ein, die die Stellung der CVP als Mehrheiten bildende Regierungspartei aushöhlte. Die eigentliche Zäsur brachte dann der Verlust einer der beiden bisherigen Bundesratssitze, da nun ihre Rolle in der Landesregierung an machtpolitischem Gewicht verlor. 2003 stieg die CVP nach 84 Jahren von der ersten in die zweite Liga der Regierungsparteien ab. Wie der verlorene Bundesratswahlkampf gegen die FDP 2009 (Urs Schwaller gegen Didier Burkhalter) zeigt, handelte es sich dabei nicht nur um einen vorübergehenden Unfall. Der Wiederaufstieg ist beschwerlich.6