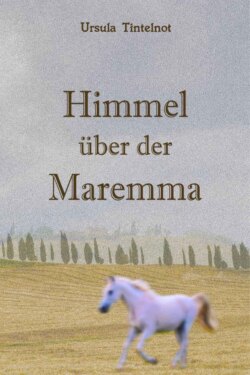Читать книгу Himmel über der Maremma - Ursula Tintelnot - Страница 5
La Pineta
ОглавлениеAmalia saß auf ihrem Lieblingsplatz in einer der tiefen Fensternischen der Bibliothek.
Der schwere Vorhang, der das Fenster verbarg, verbarg auch sie. Die Läden waren gegen die hochsommerliche Hitze geschlossen. Waren sie geöffnet, hatte man einen guten Blick über den Hof, den anschließenden Park und das schillernde Wasser des Sees hinter den Ställen. Nur das Schnurren des Katers unterbrach die Stille.
Dunkelblonde Locken fielen dem Mädchen über den Rücken.
Als sich die Tür öffnete, verhielt sie sich ganz still. Onkel Maximilian. Er würde in seinen tiefen Ledersessel sinken, einen Cognac trinken, die Hände falten und einschlafen. Sobald er schlief, konnte Amalia ungesehen die Bibliothek verlassen. Aber diesmal wurde er von Frederico, ihrem Cousin, begleitet.
»Ich weiß wirklich nicht, was du an dem Mädchen findest. Warum schickst du sie nicht in ein Internat?«
»Ich will diese Diskussion nicht immer wieder führen.« Max von Osstens Stimme klang genervt. »Das ist meine Entscheidung. Und nun lass mich allein.«
»Wie du meinst, Papa, aber ich versteh es nicht. In einem Internat wäre sie gut betreut, und wir müssten nicht Erzieherinnen, Lehrer und Therapeuten im Haus dulden.«
Frederico klatschte die Reitgerte gegen seine Stiefel und zog die Tür laut zu. Sein Vater fragte sich, was der Junge gegen seine Cousine hatte. Selbst Fredericos Großmutter schien dem Charme dieses verwaisten Kindes zu erliegen. Vielleicht war es genau das, was ihn in seiner Antihaltung bestärkte.
Frederico war ein verwöhnter Knabe, der seinen Platz als Jüngster in der Familie hatte abgeben müssen, als Amalia als Vierjährige vor gut acht Jahren ins Haus kam. Es wurde Zeit, dachte sein Vater, dass er seine Eifersucht überwand.
Amalia hörte das schabende Geräusch, als ihr Onkel den Kristallstöpsel aus der Karaffe zog, um sich einen Cognac einzuschenken. Onkel Maximilian war zwanzig Jahre älter als ihr Vater Johann. Sein dichtes kurzes Haar war grau, während das ihres Vaters noch dunkelblond wie ihr eigenes gewesen war.
Sie kannte den Inhalt der Unterhaltung. Frederico mochte sie nicht. Er ärgerte sie, wann immer es ihm gefiel. Und es gefiel ihm oft.
Als Amalias Vater starb, war sie vier Jahre alt gewesen. An ihre Mutter konnte sie sich nicht erinnern.
Warum sie ihren Vater und sie verlassen hatte, wusste Amalia nicht. Damals war sie zu klein gewesen, um Fragen zu stellen, und jetzt gab es niemanden mehr, den sie fragen konnte. Onkel Maximilian war ihr einziger auffindbarer Verwandter. So war sie vor acht Jahren wie ein Postpaket von Hamburg nach Italien geschickt worden. Ihre Erinnerungen an eine große Stadt, den Hafen und die Wohnung mit dem Ausblick auf eine belebte Straße verblassten.
Maximilian reiste in Gedanken dreizehn Jahre zurück.
Zum letzten Mal war er seinem Bruder und dessen Frau Bella vor mehr als zwölf Jahren begegnet. Er sah Bella noch vor sich. Sie war zauberhaft. Eine Frau, die ihn in den Wahnsinn trieb. Er wollte sie, und er nahm sie sich.
Nie wieder sprach Johann ein Wort mit ihm. Bella verließ ihren Mann und ihr Baby gleich nach der Geburt. Und jetzt war dieser verhasste Bruder längst nicht mehr am Leben, und dessen Tochter lebte in seinem Haus.
Maximilian hatte das Erbe seines Vaters an sich gerissen, die Ehe seines Bruders zerstört, und nun gehörte auch Amalia ihm. Das Mädchen, ein Abbild seiner Mutter, erinnerte ihn Tag für Tag an Bella und an das, was zwischen ihnen gewesen war. Aber er war kein Mann, der sich über Dinge aufregte, die der Vergangenheit angehörten.
In gewisser Weise verstand er seinen Sohn. Frederico war ihm sehr ähnlich. Unversöhnlich in seiner Ablehnung. Und unerbittlich, wenn es um sein Territorium ging.
Amalia war ein unabhängiges Mädchen. Sie beklagte sich nie über Frederico. Wenn er sie zu demütigen versuchte, nahm sie es stoisch hin, was ihn zu noch gröberen Scherzen veranlasste.
Auch Maximilian hatte mit dem spät geborenen Bruder die Zuneigung seiner Eltern teilen müssen. Zwanzig Jahre lang war er ihr Kronprinz, ihr Stolz gewesen.
Johann entwickelte sich zu einem Wunderkind. Mit drei Jahren begann er Klavier zu spielen, mit fünf bekam er seine erste Geige. Sein musikalischer Höhenflug war unaufhaltsam. Mit zwanzig Jahren war er erster Geiger in einem großen Orchester. Er reiste um die ganze Welt. Während Johann sich seiner Kunst widmete, widmete sich Maximilian den Firmen seines Vaters und sorgte dafür, dass sein Bruder am Ende keinen Heller erhielt.
Dass sein Vater nicht mehr Herr seiner Sinne war, begünstigte Maximilians Pläne. Nachdem seine und Johanns Mutter gestorben war, verlor sein Vater nicht nur jegliches Interesse an den Geschäften, sondern auch seinen Verstand. Es war nicht schwer, ihm einzureden, dass Johann nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Der Alte enterbte seinen jüngeren Sohn und überschrieb alles seinem Ältesten.
Als Johann zur Beerdigung seines Vaters anreiste, brachte er seine wunderschöne junge Frau mit. Maximilian konnte den Blick nicht von ihr wenden. Die gerade Nase, ihre schön geschwungenen Lippen. Das streng zurückgebundene Haar schimmerte. Er hatte viele Frauen gekannt. Diese wollte er, auch, weil sie die Frau seines Bruders war.
Maja war eine wunderbare Köchin. Und sie liebte Amalia. Das Mädchen rührte sie.
Amalia war so zierlich, viel zu dünn, und manchmal sah sie traurig aus. Als sie vor acht Jahren kam, sprach sie nicht. Maja schob es darauf, dass die Kleine kein Italienisch konnte. Aber das war es nicht. Auch, nachdem sie alles verstand, sprach sie nicht. Amalia sagte kein Wort. Umso mehr drückten ihre strahlenden Augen aus, wenn sie sich freute, die sich verschleierten, wenn sie traurig war.
Amalia schmiegte sich an Maja, wenn sie ihr einen Leckerbissen zusteckte, und sie lächelte so voller Dankbarkeit, dass das Herz der Köchin schmolz.
Die Familie traf sich zum Abendessen in der großen verglasten Veranda. Einem ganz in Frühlingsgrün und Weiß gehaltenen Raum mit Blick auf die sanften Hügel gegenüber.
Theresa bestand darauf, dass die Familie sooft wie möglich an einem Tisch zusammenkam. Frederico stand am Fenster und sah gelangweilt hinaus in die Dunkelheit. Seine Großmutter Maria betrat in diesem Moment das Zimmer.
»Wo ist Theresa? Kann meine Tochter nicht ein einziges Mal pünktlich sein?« Sie sah sich um.
Maximilian begrüßte seine Schwiegermutter. »Nein«, sagte er spöttisch, »das kann sie nicht. Ein eklatanter Erziehungsfehler.«
»Rede keinen Unsinn, ich habe sie anders erzogen.«
Die alte Dame ließ sich auf einem Stuhl am Tisch nieder. Sie war schlank und saß aufrecht, ohne die Rückenlehne in Anspruch zu nehmen.
»Du hast sie gar nicht erzogen.«
Maria schmunzelte. »Hat sie dir das erzählt?«
»Ja, hat sie.«
»Das stimmt, ich war zu häufig auf Reisen.«
Maria betrachtete ihren Schwiegersohn. Er sah gut aus und war ein sehr großzügiger Mann. Kaum jünger als sie selbst. Wenn sie Lust auf einen jüngeren Liebhaber gehabt hätte … dem Alter nach hätte er besser zu ihr gepasst. Aber er war zu alt, um sich eine noch ältere Geliebte zu nehmen, dachte sie zynisch.
»Wo ist Amalia?«
Frederico wandte sich endlich seiner Großmutter zu. »Der Stockfisch ist auch noch nicht da.«
Maria hob die Brauen. Ihr jüngster Enkel ließ keine Gelegenheit aus, sich über seine Cousine lustig zu machen. Die Tür öffnete sich, und Theresa trat ein.
»Endlich, Kind, du weißt, dass ich nicht gerne warte.«
»Ich weiß, Mama.« Sie begrüßte ihre Mutter mit einem flüchtigen Kuss. »Ich habe den Nachmittag im Stall verbracht und musste mich noch umziehen.«
Ihren Mann begrüßte sie mit einem Lächeln. Sie konnte ihm ansehen, was er dachte. Raffael, der junge Verwalter, war ein fähiger Mann und Maximilian ein Dorn im Auge.
»Guten Abend, mein Lieber.«
Sie streifte die Wange ihres Mannes mit den Lippen. Verführerische Lippen, dachte er.
Amalia im Schlepptau enterte Madame Durand den Raum. »Ich habe sie am See gefunden. Zum Umziehen war keine Zeit.«
»Wasser ist der natürliche Lebensraum eines Fisches.« Frederico formte den Mund zu einem runden Fischmaul.
»Frederico!« Theresas Augen wurden schmal.
Sie sah hinüber zu Amalia. Die stand aufrecht hinter ihrem Stuhl. Mit keiner Bewegung, keinem Blick gab sie zu erkennen, dass sie die höhnische Bemerkung ihres Cousins gehört hatte.
»Wollen wir heute noch essen? Ich will mich früh zurückziehen.« Marias Finger klopften ungeduldig auf die Tischplatte. Ihr Gesichtsausdruck sprach Bände. Als sie aufblickte, fing sie Amalias winziges Lächeln auf, das sofort wieder verschwand. Marias Lippen zuckten.
Theresa setzte sich. Maja kam mit einer Schüssel voll dampfender Spaghetti herein. Es roch nach Pilzen, dem erdigen Duft der Trüffel. Sie zwinkerte Amalia zu und stellte einen Teller Spaghetti Bolognese mit einer extra Portion Parmesan vor sie hin. Amalias Lächeln belohnte sie.
»Du könntest langsam mal anfangen, das zu essen, was wir alle essen.« Frederico stopfte sich eine übervolle Gabel in den Mund.
»Und du, mein Junge, könntest langsam mal anfangen, anständig zu essen.«
Überrascht sah Frederico seine Großmutter an. Sie mischte sich mit verblüffender Taktlosigkeit in alles ein, allerdings höchst selten in Erziehungsangelegenheiten. Frederico lief rot an.
»Hast du etwas von Konstantin gehört?« Maria wandte sich an ihre Tochter und beachtete ihren Enkel nicht weiter.
Theresa fragte sich, ob er wütend oder beschämt war. Ihr jüngster Sohn war so ganz anders als sein Stiefbruder. Sie hatte Konstantin mit in die Ehe gebracht. Maximilian war nicht sein biologischer Vater.
Sie hatte ihren ersten Mann geliebt und geglaubt, nie mehr einen Mann so sehr lieben zu können, mit dieser glühenden Leidenschaft und der Angst, ihn zu verlieren. Thomas hatte einige Kurzgeschichten veröffentlicht, ein paar Theaterstücke geschrieben, aber erst am Anfang seiner Karriere gestanden. Sie war dreiundzwanzig und praktisch mittellos, als er starb.
Theresa war ausgebildete Pferdewirtin. Auf eine Anzeige in einer Pferdezeitschrift hin, bewarb sie sich um die Stelle. Sie schnallte ihren damals vier Jahre alten Sohn in ihrem knallroten Mini an, setzte sich in ihr Auto und fuhr in die Toskana. Das Gut lag in der Nähe Grossetos inmitten der Maremma. Als sie ausstieg, kam ihr ein Mann entgegen. Sicher zwanzig Jahre älter als sie selbst. Gebräunt, attraktiv und selbstsicher.
»Theresa, ich habe dich etwas gefragt.«
»Entschuldige, Mutter.«
Maria wiederholte ihre Frage. Amalia zeigte zum ersten Mal an diesem Abend Interesse. Auch Frederico erwartete die Antwort seiner Mutter.
»Ich denke, er wird am Wochenende hier sein.«
Amalia bemühte sich, ihre Freude nicht allzu deutlich zu zeigen. Sie hatte gelernt, in Fredericos Gegenwart vorsichtig zu sein. Wenn er überhaupt an jemandem hing, so war das sein älterer Bruder. Dass Konstantin seine kleine Cousine liebte, schürte seine Eifersucht.
Maja brachte eine Platte mit Vitello al latte und verschiedenen Gemüsen herein.
»Wo ist Alicia?«
»Sie hat heute frei, Signora.«
Es war ungewöhnlich, dass Maja selbst auftrug.
»Ist keines der Mädchen mehr im Haus?«
»Nein, sie wollten zusammen auf das Fest unten im Dorf gehen. Bei Silvio ist Tanz.«
Amalia lief das Wasser im Mund zusammen. Der in Milch geschmorte Kalbsbraten gehörte zu ihren Lieblingsgerichten.
»Wir nehmen uns selbst, Maja, es ist gut.«
Amalia beobachtete besorgt, wie die Platte die Runde machte, bis sie endlich bei ihr ankam. Ihr Onkel aß und trank unmäßig. Frederico besaß den gesunden Appetit eines Neunzehnjährigen. Maria nahm sich nur eine Scheibe des zarten Fleisches.
Madame Durand verzichtete ganz darauf. »Essen am späten Abend ist ungesund.« Sie aß nur ein wenig von dem Gemüse.
Theresa legte Amalia zwei Bratenscheiben auf den Teller. Eine zarte Berührung ihrer Hand war Amalias Dank. Theresa lächelte ihr zu. »Das magst du doch besonders gerne?«
Amalia nickte. Wie schade, dass sie nicht spricht, dachte Theresa. Nach Auskunft der Ärzte, lag kein körperlicher Schaden vor. Amalia war verstummt, als ihr Vater starb.
Aber die Miene des Kindes drückte so vieles aus, war wunderbar ausdrucksvoll, und neben ihr lag immer ein Tablet, auf dem sie in Windeseile schreiben konnte. Sie sah auf das Display, das Amalia leicht zu ihr drehte. »Wie geht es Luna?«, stand da.
Luna, Theresas mondfarbene Stute, bekam ihr erstes Fohlen, und Amalia fieberte ihm entgegen.
»Wenn es ein Hengst wird, bekommst du ihn«, hatte Theresa ihr versprochen. »Du kannst ihn aufziehen und lernen, wie man mit einem eigenen Pferd umgeht.«
Theresa sagte: »Luna ist nervös und ich auch, vielleicht bleibe ich heute Nacht wieder im Stall.«
»Darf ich mitkommen?«
»Nein, das ist keine gute Idee. Zu viele Menschen würden sie noch mehr beunruhigen.«
Amalia nickte.
»Ich nehme an«, sagte Maximilian und ließ die Gabel sinken. »Raffael wird mit dir wachen?«
»Möglich.«
»Ich erwarte dich nach dem Essen, Amalia.« Maria bat niemals um etwas, sie legte dar, was sie wollte, und erwartete, dass man ihr gehorchte.
Das Mädchen nickte.
Madame Durand sah aus, als habe sie in eine Zitrone gebissen. »Das Kind hat morgen sehr früh eine Reitstunde«, wagte sie einzuwenden.
Maria erhob sich. »Amalia ist kein Kind mehr, das am frühen Abend ins Bett geschickt werden muss. Sie ist fast dreizehn.«
Automatisch sah Theresa auf ihr Handgelenk. Fast zweiundzwanzig Uhr. Sie schob ihren Stuhl zurück. »Es wird auch Zeit für mich«. Sie sah ihren Mann an. »Warte nicht auf mich, Maxim. Es kann spät werden.«
»Ein Fohlen?«
»Ja, Lunas Fohlen.«
Du hast, wie üblich, nicht zugehört, dachte sie.
»Ich hoffe, noch diese Nacht und nicht erst morgen früh?« Ihr Mann hielt ihren Blick einen Moment lang fest.
Noch während sie sich für eine Nachtwache im Stall umzog, hörte sie den Motor des Maserati. Das Cabrio ihres Mannes fuhr vom Hof. Maxim war zu seiner derzeitigen Geliebten unterwegs.
Er war noch immer ein attraktiver Mann. Sie hatte ihn vor gut zwanzig Jahren geheiratet, weil er charmant war, ihr Sicherheit bot und mit ihrem Sohn spontan Freundschaft geschlossen hatte.
Nach einem Rundgang über das Gut und durch die Ställe hatte er gesagt: »Sie können den Job haben, aber …«
»Aber?«
»Es gibt eine Bedingung.«
»Welche Bedingung?«
»Sie müssen mich heiraten.«
Sie hatte gelacht und gefragt: »Wollen Sie das Gehalt sparen?«
Ein halbes Jahr später wurde sie Frau von Ossten und zog mit ihrem Sohn und ihrer Mutter in das riesige Haus in der Maremma.
Sie war Maximilians vierte Ehefrau. Seine Ehen waren kinderlos geblieben. Als sie schwanger wurde, kannte seine Freude keine Grenzen.
Maximilian dachte an die erste Begegnung mit Theresa. Schlank und kraftvoll, eine geballte Ladung Energie. Ohne erkennbare Eitelkeit, verlockend, ohne zu locken.
Ihr dichtes gewelltes Haar glänzte wie das Gefieder eines Raben. Sie besaß diese natürliche Eleganz, die nicht erlernbar war. In seinen Augen waren alle Frauen sich ähnlich. Theresa bildete die Ausnahme. Alles an ihr war einzigartig, besonders und unwiderstehlich. Ein Hauch von Melancholie umgab sie. Sie war damals noch nicht lange Witwe gewesen, erinnerte er sich.
Theresa beklagte sich nie. Sie machte keine Szenen, nahm seine Eskapaden hin. Manchmal schien ihm, als ob sie gar nicht bemerkte, wenn er sich einer anderen Frau zuwandte. War das so, weil es ihr egal war? Er ihr egal war? Das käme einer Kränkung gleich. Ja, er war gekränkt. Ihre scheinbare Gleichgültigkeit war Gift für sein Ego.
Maximilian drückte das Gaspedal durch. Er fuhr Richtung Grosseto. Dorthin, wo eine Frau auf ihn wartete, die ihn bemerkte. Sidonie, die Frau seines Freundes und Geschäftspartners Renato, der sich mehr auf Reisen als zu Hause aufhielt, war ein blondes Versprechen. Ungehemmt und ohne die geringste Anmutung von Moral. Eine sexuell unterforderte Fünfunddreißigjährige.
Rücksichtslos fuhr er viel zu schnell über die kurvige schmale Straße.
Eine Stunde nach seiner Geburt stand der kleine Hengst auf zitternden Beinen im hoch eingestreuten Heu.
Hellbraunes Fell. Seine glänzenden Augen umgab ein weißer Kranz.
Theresa lachte. »Es sieht aus, als habe er sich eine Brille aufgesetzt.«
Raffael war dabei, die Abfohlbox zu säubern. Die Nachgeburt ließ er in einen Eimer fallen. Die würde sich die Tierärztin später ansehen.
»Das hast du gut gemacht.« Theresa streichelte den Hals ihrer Stute.
Luna schnaubte leise und blies warmen Atem in ihr Gesicht. Es war schon die dritte Nacht, in der sie bei Luna gewacht hatten. Die Stute war unruhig gewesen.
Das Fohlen hatte den Weg zu den Zitzen seiner Mutter gefunden.
Theresa war immer wieder berührt, wenn sich diese kleinen Wesen auf ihre Streichholzbeinchen kämpften und schon kurz nach der Geburt zu trinken begannen.
Müde hockte sie auf einem alten Hocker, stützte sich auf die Knie und legte ihr Gesicht in beide Hände. Sie hörte Raffael hin und her gehen, beruhigende Laute von sich geben. Wasser lief. Dann spürte sie ihn hinter sich, seine warmen kräftigen Hände auf ihren Schultern. Sie stöhnte, als er sanft ihre verspannten Schultern massierte. Noch herrschte Stille im Stall, nur unterbrochen von leisem Schnauben und dumpfem Stampfen, wenn eines der Pferde sich bewegte. Theresa legte den Kopf zurück und sah zu Raffael auf.
Es war gerade sechs Uhr früh, als sie über den Hof auf das Herrenhaus zuging. Sie hörte die Stallburschen und ihren Stallmeister, der seine Anweisungen für den Tag gab. Er war beliebt, aber auch gefürchtet. Unregelmäßigkeiten duldete er nicht.
Jetzt hörte sie ihn brüllen: »Ich stülpe dir die Nachgeburt über die Ohren, du Schweinebraten.«
Da hatte wohl einer der Stallburschen einen Fehler gemacht.
Theresa lächelte. Seine Stimme wurde leise, wenn er mit den Pferden sprach.
Sie konnte sich keinen besseren Stallmeister und Verwalter vorstellen. Er war jung, jünger als sie selbst, aber er besaß eine natürliche Autorität, die nicht durch seine Geburt zu erklären war.
Seine Eltern waren schlichte Bauern gewesen. Seine Herkunft, nun ja, eher einfach, sogar sehr einfach.
Ihre Gedanken wanderten vier Jahre zurück zu ihrem Lieblingsplatz am See. Eine riesige Trauerweide auf einer Landspitze spendete Schatten, wenn die Hitze des Sommers kaum zu ertragen war. Ihre Ranken hingen bis tief auf die Erde, bildeten kühle Räume aus grünen Vorhängen. Dorthin zog sie sich zurück, wenn sie alleine sein wollte. Von dort aus schwamm sie zu der winzigen Insel mitten im See. Ein einsamer Ort. Hier war er ihr zum ersten Mal außerhalb des Stalles begegnet.
Er stieg aus dem Wasser, nackt wie Poseidon und starrte auf sie hinunter. Sie lag regungslos auf ihrem Handtuch und starrte zurück. Ein bronzener muskulöser Körper.
Ihre Zunge strich über ihre trockene Oberlippe. Raffael drehte sich um und verschwand zwischen den herabhängenden Zweigen. Das Sonnenlicht malte unregelmäßige Flecken auf den Boden. Theresa schloss die Augen, aber sein Bild hatte sich auf ihrer Netzhaut eingebrannt. Als sie die Augen wieder aufschlug, stand er, bekleidet mit verwaschenen Jeans, über ihr. »Es tut mir leid«, sagte er. »Ich habe Sie gestört.«
Er sah nicht weg, als sie sich aufrichtete und ihr Badetuch um sich schlang.
»Mein Lieblingsplatz«, sagte sie und fuhr sich mit den Fingern durchs feuchte Haar.
»Meiner auch.«
Er ließ sich auf die Knie nieder, griff nach ihrem Tuch und öffnete es behutsam. Sie wehrte sich nicht. Er drückte sie zurück. Theresa half ihm, sich seiner Jeans zu entledigen. Sie rangen miteinander, bis sie stöhnten, bis zum Ende. Er besaß sie und sie ihn, rückhaltlos. Beide Gewinner. Sie lag an ihm, atmete seinen Duft, spürte Dankbarkeit.
Er sagte: »Ich hatte Hunger nach dir.«
Sie würde diesen Nachmittag nie vergessen.
Theresa hatte nicht bereut, Maximilian geheiratet zu haben. Aber die demütigende Erkenntnis, mit einem Mann zu leben, der sie nicht nur einmal betrog, traf sie mehr, als sie sich eingestand. Sie erzählte Raffael alles. Sie entblößte ihre Seele wie noch niemals zuvor. Eine seelische Befreiung wie zuvor die körperliche. Er hielt sie fest, bis sie eingeschlafen war.
Als sie erwachte, war er gegangen.
Sie zog sich an und lief durch den schmalen Gürtel eines Pinienwäldchens. Luna begrüßte sie mit leisem Schnauben.
»Habe ich dich zu lange alleine gelassen?«
Auf dem Waldboden bemerkte sie Spuren, die ihr sagten, dass ihre Stute keineswegs alleine gewesen war. Als er sein Pferd neben ihrer Stute angebunden hatte, musste er gewusst haben, dass er sie unter der Weide finden würde. Sie lächelte.
Marias Räume lagen in einem der Seitenflügel des Hauses, das ihre Tochter mit ihrer Familie bewohnte.
Als Pianistin war sie in der ganzen Welt aufgetreten. Nachdem sie sich das Handgelenk so kompliziert gebrochen hatte, dass an Konzerte nicht mehr zu denken war, musste sie sich etwas einfallen lassen.
Der Bruch war geheilt, die Schmerzen vergingen nie. Sie hatte unglücklich Abschied von der Bühne genommen und war dem Ruf der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg gefolgt. Junge begabte Schüler auszubilden hatte ihr zugesagt. Auf diese Weise konnte sie ihre Liebe zur Musik weitergeben.
Ein italienischer Kollege, der an der Accademia Musicale in Siena lehrte, hatte Interesse an Marias Mitarbeit gezeigt. Einmal in der Woche würde sie Kurse geben können.
Maximilian hatte ihr eine großzügige Etage in einem der Seitenflügel des Gutshauses angeboten. Allerdings, erinnerte sie sich, mit der Bedingung, dass er nicht den ganzen Tag »Klaviergeklimper« hören müsste. Sie hatte nicht gewusst, ob sie empört sein oder lachen sollte, und sich entschieden, es amüsant zu finden.
Maximilian war nur wenige Jahre jünger als sie selbst und der amusischste Mensch, den sie je kennengelernt hatte. Außer Geld, seinen Schafen und Frauen interessierte ihn nichts. In genau dieser Reihenfolge. Ja, er war ein charmanter Mann, einer dem die Frauen zu Füßen lagen, ein Genießer, der gerne gut aß und trank.
Wenn er so weitermachte, würde er bald wie ein Fass aussehen, dachte sie.
Aber noch hatte er sich eine erstaunlich gute Figur erhalten. Dass er ihre Tochter betrog, konnte sie ihm nicht verzeihen. Andererseits, das wusste sie, ging sie Theresas Ehe nichts an.
Sie streichelte den cremefarbenen Maremma- Hund zu ihren Füßen. »Du darfst gleich noch mal raus, Ludwig.«
»Nonna?« Die Tür öffnete sich. Amalia stob wie ein Wirbelwind in den Salon. Sie ließ sich, wie der Hund, zu Marias Füßen nieder.
»Wie geht es meiner Schülerin?« Maria strich Amalia über die Locken. »Willst du noch ein bisschen spielen?«
Maria öffnete den Deckel ihres Flügels und stellte den Sitz des Klavierhockers höher. Während Amalia spielte, fragte sie sich, warum das Kind mit ihr sprach, aber mit niemandem sonst. Amalia wechselte mühelos von Deutsch zu Französisch zu Italienisch. Sie sprach mit Amalia vorwiegend Deutsch, um sie die Sprache ihrer Eltern nicht vergessen zu lassen.
Die Kleine hat einen wunderbar sanften Anschlag. Ja, dachte sie, das Kind ist begabt.
Dass es für eine Laufbahn als Pianistin reichte, bezweifelte sie. Sie wusste, wie hart ein solches Leben war. Man würde sehen. Einer ihrer liebsten Komponisten war Chopin. Maria lauschte der Musik.
Erstaunlich für ein Kind in diesem Alter, dachte sie.
Aber an Amalia war alles erstaunlich. Ihre Freundlichkeit und die stoische Ruhe, mit der sie die krassesten Ausbrüche ihres Cousins hinnahm. Sie ließ sich nicht provozieren. Vielleicht blieb die Sprachlosigkeit die einzige Möglichkeit, sich zu wehren. Zu wehren gegen eine Familie, die sie zwar aufgenommen hatte, in die sie aber emotional wenig eingebunden war.
Maria hatte mit ihrem Arzt darüber gesprochen. Er war nicht so überrascht.
»Etwas bringt sie zum Schweigen. Sie könnte das nicht durchhalten, wenn es bewusst geschähe. Es war sicher ein Schock für sie, als ihr Vater starb und sie aus ihrem gewohnten Umfeld herausgerissen wurde.«
»Aber warum spricht sie mit mir?«
»Denken Sie darüber nach. Vielleicht gibt es eine Verbindung über Sie zu ihrem Vater.«
Es war seit Jahren Amalias und ihr Geheimnis. Maria befürchtete, dass das Mädchen auch ihr gegenüber verstummen würde, wenn sie dieses Geheimnis lüftete.
Sie erinnerte sich, dass Amalia ihre Räume zum ersten Mal betreten hatte, während sie sich ein Violinkonzert anhörte. Ein halbes Jahr nach ihrer Ankunft. Sie hatte sich stumm auf einen Stuhl gesetzt und zugehört, bis das Stück zu Ende war.
»Das war mein Papa«, sagte die damals knapp Fünfjährige.
Maria glaubte, nicht recht gehört zu haben. Sie hörte die leicht raue Stimme des kleinen Mädchens zum ersten Mal, und es war tatsächlich eine alte Aufzeichnung aus der Boston Symphony Hall mit dem Orchester ihres Vaters.
Von diesem Zeitpunkt an hatte sie Amalia unterrichtet.
Maria erhob sich und öffnete Fenster und Läden weit. Jetzt nahm die Hitze langsam ab, und ein leichter Wind strich durch die Räume. Sie lächelte, als sie unten Madame hin und her gehen sah. Sie wartete ganz offensichtlich auf ihre Schutzbefohlene.
Maria wandte sich um und sagte: »Amalia, ich glaube es wird Zeit. Lauf hinunter, Madame Durand erwartet dich.«
Madame Durand sah Amalia entgegen.
Seit acht Jahren betreute sie das Kind, das ihr langsam entwuchs.
Amalias noch knabenhafte Figur wandelte sich. Die graublauen Augen leuchteten neugierig auf die Welt. Das dunkelblonde Haar zu einem üppigen Pferdeschwanz gebunden, betonte ihr schmales Gesicht.
Sie war klug, konnte in drei Sprachen gebärden und schreiben. Nach einer Prüfung war sie direkt in die zweite Klasse des Gymnasiums eingeschult worden. Wenn auch weder Theresa noch Maximilian von Ossten Zeit fanden, sich um ihre Nichte zu kümmern, so sorgten sie immerhin für eine angemessene Erziehung. Die Einzige, die sich mit Amalia beschäftigte, war Maria. Auch wenn die alte Dame das, in Madames Augen, zu den ungeeignetsten Zeiten tat. Es war nach zweiundzwanzig Uhr, als das Mädchen aus dem Flügel des Hauses trat, in dem Maria lebte. Amalia sah glücklich aus, wenn sie von ihr kam.
»Du hast wunderschön gespielt«, sagte Madame, »aber jetzt wird es wirklich Zeit.« Amalia nickte. Sie konnte nie einschlafen, wenn Konstantins Besuch bevorstand.
Konstantin hatte ihr das Lesen beigebracht, sich Geschichten für sie ausgedacht und ihr die Angst vor den Pferden genommen. Auf seinen Schultern hatte er sie durch den Stall getragen und sie jedem einzelnen Pferd vorgestellt.
»Das ist Xerxes, sag guten Tag, streichle seine Samtnase. Das ist Ramses, schau dir an, wie sein dunkles Fell glänzt. Leg das Zuckerstück auf deine Hand und halte es Samson hin.«
Sie spürte den weichen, warmen Samt der Nüstern auf ihrer Handfläche. So ging er mit ihr durch die Stallgassen. Auf seinen Schultern fühlte sie sich sicher.
Eines Tages stellte er sie auf die Füße und sagte: »Das ist Cenerentola, sie gehört dir.« Damals war sie fünf Jahre alt.
Sie hob den Kopf und sah einem Pony in die sanften Augen.
Aschenputtel, dachte sie. Grau wie Asche.
Madame schloss die Verbindungstür zu Amalias Schlafzimmer. Amalia wurde erwachsen, und bald wäre sie selbst überflüssig. Sie hatte schon einige Male in ihrem Leben Abschied von »ihren« Kindern nehmen müssen. In diesem Fall würde es ihr schwerer werden als jemals zuvor. Amalia war ihr ans Herz gewachsen. Zu sehr, wie sie jetzt feststellte. Mehr als acht Jahre lang hatte sie dieses bezaubernde Kind betreut, immer bemüht, einen angemessenen emotionalen Abstand zu ihrem Schützling zu wahren. Aber Amalia besaß keine Eltern mehr, also hatte sie sich mütterliche Gefühle gestattet. Sie würde es büßen müssen, wenn der Abschied kam.
Madame erwachte früh. Sie trat ans Fenster und spähte hinaus. Morgenlicht floss über den Hof und die weiter entfernten Stallungen.
Sie zog sich vom Fenster zurück, als sie Theresa auf das Haus zukommen sah. Diese Frau war ihr ein Rätsel. Sie war … ja, was? Sie wirkte immer eine Spur blasiert, nicht unfreundlich, nein, gelangweilt, traf es eher. Dass Maximilian von Ossten seine Frau betrog, war ein offenes Geheimnis. Aber Madame hatte nie ein unfreundliches Wort aus Theresas Mund gehört. Wenn er sie berührte, ließ sie es mit einer Selbstverständlichkeit zu, als ob sie nichts wüsste von seinen Affären.
Eine gewisse Tragik lag in ihrem Verhalten.
Theresa fragte sich, als sie Madame Durands Schatten oben am Fenster wahrnahm, wann es Zeit wäre, Amalias Erzieherin zu entlassen.
Sie mochte die Französin. Madame war zurückhaltend und liebte Amalia ganz offensichtlich. Sie schob den Gedanken weg. Amalia wurde erst dreizehn. Eine Weile würde sie ihre Erzieherin noch brauchen. Außerdem war ihr durchaus bewusst, dass Madame eine sehr viel bessere Hausfrau als sie selbst war.
Theresa seufzte, schob die Haustür auf, schritt über den gewachsten Terrazzoboden der Halle und stieg über die gewundene Treppe in das obere Stockwerk. Sie ging am Schlafzimmer ihres Mannes vorbei und betrat ihren Ankleideraum.
Mein Mann, dachte sie, während sie den Overall öffnete.
Unter ihrer Ehe mit Maximilian hatte sie sich etwas anderes vorgestellt. Er war so amüsant gewesen, so großzügig und anziehend. Anziehend war er immer noch und großzügig. Dass ihr zwanzig Jahre älterer Ehemann sie betrügen würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Und es war absolut nicht amüsant. Trotzdem konnte sie sich seinem Charme nicht ganz entziehen, und wie verletzt sie war, würde er nie erfahren.
In ihrer Ehe mit Maxim hatte sie gelernt, sich zu verstellen. Sie trug eine ungerührte Miene zur Schau. Niemand sollte sie je »die arme Theresa« nennen.
Maxim bemühte sich durchaus um sie. Wenn er zu ihr kam, wies sie ihn nicht ab. Aber genauso wenig, wie sie eine Migräne vortäuschen würde, würde sie ihn davon in Kenntnis setzen, dass sie gelegentlich mit ihrem Stallmeister schlief.
Ihre erste Ehe war glücklich gewesen, glücklich und viel zu kurz.
Theresa betrat ihr Badezimmer, das ihr eigenes Schlafzimmer mit ihrem Ankleideraum verband. Nachdem sie Stunden im Stall verbracht hatte, sehnte sie sich nach einer Dusche. Sie ließ heißes Wasser von allen Seiten auf ihren Körper prasseln. Mit einem weißen, weichen Badetuch trocknete sie sich ab.
Sie lag lange schlaflos unter ihrem Laken. Ihre Gedanken konnte sie nicht abschalten.
Amalia würde ihren Hengst bekommen. Die Kleine erinnerte sie an ihre Fohlen, die sich tapfer auf die zitternden Beinchen kämpften. Wie verloren musste sie sich in ihrer Familie fühlen. Seit Konstantin studierte, kam er nur noch selten heim. Wie ein Hündchen war das Mädchen schon als Vierjährige hinter ihm hergelaufen. Wo Konstantin sich aufhielt, war die Kleine nicht weit. Er hatte sie auf seine Schultern gesetzt und war mit ihr über den Hof bis hinunter zum Stall galoppiert. Über das ganze Gesichtchen strahlend, hatte sie sich an ihm festgeklammert.
Er war wie ein liebevoller großer Bruder mit Amalia umgegangen.
Das konnte man nicht von Frederico sagen. Wo Konstantin zugewandt, offen und liebevoll war, war Frederico manchmal arrogant und abweisend. Konstantin ruhte in sich, Frederico war unberechenbar. Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder hatte er noch kein Ziel.
Sie liebte ihre Söhne, aber war sie eine gute Mutter? Waren ihr die Pferde nicht immer wichtiger?
An Amalia dachte sie mit einer gewissen Befangenheit. Sie fragte sich, warum Maxim die Tochter seines ungeliebten Bruders so ohne Weiteres in seinem Haus aufgenommen hatte. Genau wie Frederico dachte sie, dass ein Internat, selbstverständlich eines der besten, vielleicht richtiger gewesen wäre. Was also hatte ihn dazu bewogen, das Mädchen bei sich zu behalten? Amalia war ein Abbild ihrer Mutter. Hatte Maxim ein schlechtes Gewissen?
Theresa erinnerte sich an die Fotografie, die an Amalias Bett stand. Und sie erinnerte sich an den Skandal, in dessen Mittelpunkt Bella und Maximilian gestanden hatten. Theresa wünschte sich, nie davon gehört zu haben. Es war eine Geschichte von Alkohol, Verführung und Sex.
Sie konnte nicht einmal ausschließen, dass Amalia Maxims Tochter war.
Aber auch sie konnte sich, wie Maria, dem Charme des Mädchens nicht entziehen. Wenn sie sich eine Tochter wünschen dürfte, gestand sie sich ein, wäre Amalia ihre erste Wahl. Sie besaß mehr Gefühl für Pferde als Konstantin und Frederico zusammen. Ihre Söhne waren gute Reiter, aber Amalia war ihre Seelenverwandte. Frederico konnte ein Pferd rücksichtslos zuschanden reiten. Konstantin ließ dem Pferd zu viel Freiheit. Amalia besaß genau die richtige Balance.