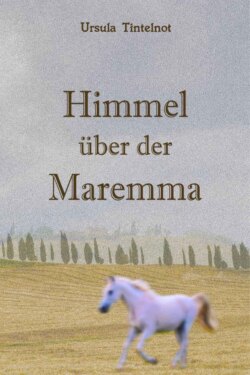Читать книгу Himmel über der Maremma - Ursula Tintelnot - Страница 7
Eitelkeiten
ОглавлениеTheresa stand, über einen Eimer Wasser gebeugt, in der Sattelkammer und wusch sich das Gesicht. Die Haare strich sie sich mit feuchten Händen zurück. Maxims Stimme drang bis zu ihr.
Wenn potenzielle Käufer erschienen, um ihre Pferde zu besichtigen, war ihr Mann gerne dabei. Er meinte, die Anwesenheit eines Mannes triebe den Preis in die Höhe, womit er nicht ganz Unrecht hatte. Männer gerierten sich wie Gockel: ‚Schau, ich habe das schönere Gefieder.’ Sprich: ‚Ich kann mir den Preis für dieses Pferd leisten.’
Um dem anderen seine Potenz zu beweisen, zahlten die meisten gern einen höheren Preis. Sie würde die Kerle nie verstehen.
Theresa klopfte sich den Staub von den Knien, wusch die Hände und trocknete sie ab. Bei ihr versuchten Männer flirtend den Preis zu drücken. Sie sah in den winzigen Spiegel, der an einem Balken baumelte.
»Das allerdings ist noch keinem gelungen«, versicherte sie ihrem Spiegelbild.
Sie setzte die Preise so hoch an, dass es nicht wehtat, ein wenig nachzugeben und den Käufer im Glauben zu lassen, er habe gewonnen.
Sie betrachtete ihre Hände, sie zitterten kaum noch. Ein vorsichtiges Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. Wem wollte Raffael eigentlich die Eier abschneiden? Dem Hengst oder dem, der die Tür der Box geöffnet hatte?
Sie streckte sich, sah noch einmal in den Spiegel und trat hinaus in die blendende Helle.
War ihr noch anzusehen, wie aufgewühlt sie war? Als Raffael gestürzt war, hatte ihr Herzschlag ausgesetzt. Sie hörte noch ihren eigenen Schrei. Scheinbar unberührt wandte sie sich jetzt dem Reitplatz zu. Sie schritt, ohne hinzusehen, vorbei an der Stelle, wo sie neben Raffael in die Knie gesunken war.
Maxim ließ Abigail traben. Die hübsche, entspannte Schwarzscheckstute war erst sechs Jahre alt, gut eingeritten und ausgesprochen brav.
Eine halbe Stunde später schüttelten sich die Männer die Hände. Sidonie küsste Maximilian auf den Mund und sah dabei Theresa frech in die Augen.
Theresa löste sich vom Zaun und ging hinauf zum Haus.
In der Bibliothek erwartete sie Maxims derzeitige Geliebte und ihren gehörnten Ehemann mit dem vorbereiteten Kaufvertrag und einem Glas Champagner.
Das Paar gehörte zu den engeren Freunden Maxims und damit auch zu ihren. Sidonie war Renatos Ehefrau Nummer fünf. Im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen wurde Sidonie nicht schwanger. Es hieß, sie wäre unfruchtbar. Vielleicht, dachte Theresa, war es das, was sie praktisch jedem Mann in die Arme trieb.
Theresa dachte an die Muli-Stute, Piccola Birbona, die mit Ariel auf der Koppel graste. Da Maultiere im Allgemeinen unfruchtbar waren, konnte ihr Hengst seine sexuellen Wünsche an ihr ausleben, ohne dass es Fohlen gab. Eine Hure für den Hengst.
Vielleicht hätte ich das Maultier ‘Sidonie’ taufen sollen, dachte sie zynisch. Aber Kleines Luder passte auch.
»Renato, wie lieb von dir, mir dieses süße Pferdchen zu schenken«, zwitscherte Sidonie.
Theresa zuckte unwillkürlich zusammen. Abigail war zweifellos eine hübsche Stute, schwarz mit vier weißen »Kniestrümpfen« und einem Stern zwischen den Augen. Aber süß? »Ich habe mir einen süßen Reitanzug bestellt, mit schwarzem Jackett und weißen Hosen. Ich werde genau wie Abigail aussehen.«
Theresa presste die Lippen zusammen und wandte sich ab.
»Du wirst reizend aussehen, meine Liebe«, hörte sie Renato sagen.
»Seid mir nicht böse, aber es warten noch weitere Kunden.« Theresa nickte in die Runde und verließ fluchtartig den Raum. Die »süße« Sidonie konnte sie keine Sekunde länger ertragen.
Sie rettete sich in die Küche, wo sie Frederico traf, der Maja von Ariels Heldentaten berichtete. »Und dann habe ich versucht …« Als er seine Mutter sah, schwieg er und wollte sich an ihr vorbei aus der Küche stehlen.
Sie packte ihren Sohn am Arm. »Wir beide sprechen uns noch. Heute nach dem Abendessen.« Ihre Stimme klang ruhig, ihre Augen loderten.
»Ja, Mama.«
»Maja, ein Glas Wasser bitte.«
»Ärger, Signora?«
»Ja, Maja.« Sie stürzte das Wasser in einem Zug herunter. »Ich muss noch einmal in den Stall.«
Maja sah und hörte vieles. Aber mit ihr über ihre Sorgen zu sprechen, brachte Theresa nicht über sich.
Es wurde bereits dämmrig. Theresa sah auf die Uhr.
Sie hoffte, dass Maxim Sidonie und Renato nicht zum Essen bitten würde. Das ginge über ihre Kräfte.
Sie tastete nach ihrem Handy und wählte die Telefonnummer der Klinik in Siena.
Ihr kamen wieder die Tränen. Es war noch nicht vorbei.
Wie Inseln ragten die Hügel in der Ferne aus dem aufkommenden abendlichen Dunst.
Raffael, mein Lieber, du bist meine Insel, ich brauche dich.
Sie war überzeugt, dass Renato genau wusste, was seine Frau trieb, ja sogar wusste, mit wem. Aber die alles verhüllende Glätte, diese sogenannten guten Manieren der Gesellschaft, ließ nicht zu, dass man sich etwas anmerken ließ. Getuschelt wurde nur hinter dem Rücken der anderen.
Renato und ihr Mann waren auch Geschäftspartner, und Geschäfte waren immer wichtiger als eine Affäre, die man ohne große finanzielle Verluste beenden konnte. Wenn Sidonie im Leben beider Männer längst keine Rolle mehr spielte, würde Renato mit Maxim immer noch Geschäfte machen.
Sie spielten alle ein Spiel, auch sie selbst. Aber heute hatte sie gespürt, dass ihre Gefühle für Raffael nicht zu diesem Spiel gehörten.
Die meisten der Boxen waren leer. Die Stuten standen auf der Sommerweide. Auch Ariel sollte ab morgen wieder auf der für die Wallache und den Hengst vorgesehenen Koppel stehen. Bis weit in den Herbst hinein konnten die Tiere sich dort austoben und unter dem Schatten der Bäume frisches Gras fressen. Theresa lief durch die lange Stallgasse, hielt kurz bei Ariel. Er streckte ihr seinen großen Kopf entgegen.
»Was hast du nur angestellt, mein Schöner!«
Theresa betrat Raffaels Büro. Außer einem Schreibtisch, auf dem ein Bildschirm neben einer Telefonanlage thronte, von der aus man direkt mit dem Stallmeister oder Theresa verbunden werden konnte, Regalen an den Wänden und zwei Stühlen, gab es hier nichts, nichts, was den Raum wohnlicher machte.
Ihr Blick blieb an einem Foto hängen, auf dem zwei lachende kleine Mädchen zu sehen waren. Seine Frau hatte ihn vor Jahren verlassen und die Töchter mitgenommen. Raffael liebte seine Mädchen und besuchte sie so oft es ging.
Auf ihre Frage, was schiefgegangen war, hatte er geantwortet: »Ich habe sie und die Kinder vernachlässigt.«
Theresa zog ihr Handy aus der Tasche und wählte eine Nummer in Siena.
Raffael bewegte sich vorsichtig.
Weiße Wände, ein hohes Fenster und eine überbreite Tür, die sich schwungvoll öffnete. Ein stechender Schmerz fuhr ihm in den Kopf. Gepeinigt schloss er die Augen.
»Da sind Sie ja wieder. Guten Morgen. Professor Donato«, stellte der Arzt sich vor.
»Wo bin ich hier?«
»Sie sind in einem Hospital in Siena. Offensichtlich reicht ein Pferdehuf nicht aus, Sie ins Jenseits zu befördern.«
Raffael versuchte sich aufzusetzen. »Verflucht geiler Zossen.«
Der Arzt grinste. »Wenn Sie nicht ein Leben lang unter Kopfschmerzen leiden wollen, bleiben Sie die nächsten Tage liegen. Prellungen und Abschürfungen haben wir versorgt. Sollen wir jemanden benachrichtigen?«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf, ließ es sofort wieder und zog eine Grimasse.
Die Schwester sah ihn besorgt an.
Vor der Tür hörte man Stimmen, erregte Stimmen:
»Sie können da nicht hinein. Der Professor hält Visite.«
»Das passt mir sehr gut, ihn will ich gerade sprechen.«
Die halb geöffnete Zimmertür schwang ganz auf, und Theresa erschien, gefolgt von einer Krankenschwester mit hochroten Wangen.
»Es ist gut, Oberschwester. Ich kümmere mich um die Signora.«
Donato beugte sich über Theresas Hand.
Wie machten sie das nur, diese Menschen, die zu einer Schicht gehörten, der er selbst nicht angehörte. Hatten sie immer alles im Griff?, überlegte Raffael.
Theresa bedachte Raffael mit einem freundlichen Blick. Mehr nicht.
Sie wandte sich sofort wieder an den Professor. »Wie geht es meinem Stallmeister?«
Wenn er die Kraft dazu gehabt hätte, er wäre aufgestanden und gegangen. ‚Meinem Stallmeister’? Dieses arrogante Miststück. Wie konnte sie nur?
»Ich brauche ihn dringend, wir stecken bis zum Hals in Arbeit.«
Donato warf einen Blick auf ihn. »Er wird durchkommen, hat einen harten Schädel. Ein paar Tage behalten wir ihn noch hier.«
Raffael wand sich innerlich. Ich bringe ihn um, ich bringe sie beide um.
Theresa bewegte sich langsam mit dem Arzt zur Tür. Ihn schien sie vergessen zu haben. Er schloss wütend und erschöpft die Augen. Sie hatte über ihn gesprochen, wie über einen Gegenstand, einen Besitz. Er fühlte sich gedemütigt und verletzt. Und jetzt war sie gegangen, ohne ein Wort. Von wegen, Stallmeister! Sie konnte ihm so fremd sein wie eine Außerirdische. Manchmal stellte er alles in Frage. Es gab Momente, in denen er glaubte, sie zu kennen wie niemanden sonst, und dann entzog sie sich ihm. Von einer Sekunde zur anderen legte sie einen Hebel um, wurde die unnahbare Chefin, die Gutsbesitzerin, die zu einer Elite gehörte, von ihm so weit entfernt wie der Mars.
Als er die Augen wieder aufschlug, saß Theresa neben seinem Bett, hielt seine Hand und sah ihn unverwandt an. Ein Blick zum Fenster zeigte ihm, dass es bereits dämmerte.
Theresa griff zu einem Glas. »Du musst trinken.«
Er schob ihre Hand zur Seite. »Ich bin kein Kleinkind.«
»Ich weiß.«
»Ich hasse dich.«
Sie lachte leise. »Was hätte es geändert, Donato zu sagen, dass ich den Mann, den ich unendlich liebe, nicht im Stall, sondern im Bett brauche?« Sie hauchte ihm einen Kuss auf die Stirn. »Ich muss gehen.«
Die Absätze ihrer Sandalen klackerten. Sie öffnete die Tür, schloss sie wieder, kam zurück und küsste ihn richtig.
Er sah ihr nach. Sie hatte ihm zum ersten Mal eine Liebeserklärung gemacht. Er lächelte. »Ich liebe dich auch«, sagte er.
»Ich weiß.« Theresa schloss die Tür.
Amalia saß mit Maria am großen Tisch unter der Kastanie. Vor ihr lag ein Skizzenblock.
»Ich habe geglaubt, dass er tot ist.«
Mit kräftigen Strichen zeichnete sie einen gewaltigen dunklen Pferdekörper. Die Vorderhufe stachen in die Luft, Hals und Kopf bogen sich dramatisch nach hinten, das Maul war weit geöffnet. Selbst die großen gelblichen Zähne waren deutlich zu sehen. Maria dachte, man hört ihn förmlich wiehern.
Sie fragte sich, ob nur sie den erstickten Schrei des Mädchens gehört hatte. War er in der Aufregung untergegangen?
»Du magst ihn?«
Amalia sah sie ernsthaft an. »Ja, Nonna, ich mag ihn. Manchmal erinnert er mich an meinen Papa. Aber …« Sie zögerte.
»Ja?«
»Er ist viel öfter da und hat immer Zeit für mich.«
Wieder ein Elternteil, das sich für die Karriere entschieden hatte, wie sie selbst.
»Dein Papa war ein großartiger Musiker.«
»Aber kein guter Papa.«
Dieses Kind! Hatte sie nicht genau solch ein Gespräch vor ein paar Tagen mit ihrer Tochter geführt? »Hättest du lieber einen anderen Papa gehabt?«
»Nein.« Die Antwort kam prompt.
Maria hörte Ludwig unter dem Tisch hecheln. Auf dem Tisch stand eine Kristallkaraffe mit Zitronenwasser, in dem Eiswürfel dem Zustand vollständiger Auflösung entgegen schwammen.
»Wo soll ich den Tisch decken?«, fragte Alicia.
Inzwischen war es dunkel geworden, doch die Hitze ließ nicht nach. Die Außenbeleuchtung tauchte die Umgebung in ein sanftes Licht.
»Die Signora ist noch nicht zurück.«
Alicia wartete auf eine Antwort.
»Decken Sie hier, Alicia, unter dem Baum ist es erträglich«, sagte Maria.
Alicia schüttelte den Kopf. Bei diesem Wetter draußen zu essen, käme ihr wohl nicht in den Sinn.
Amalia sammelte ihre Zeichenstifte ein, schloss den Skizzenblock und lief ins Haus. Maria sah ihr nach. Eine kleine ernsthafte Person, mit einem bezaubernden Lächeln. Amalia war hochintelligent und hielt ihre Emotionen weitgehend unter Verschluss. Zu Beginn der langen Sommerferien hatte sie einen Brief der Schulleitung mitgebracht. Er enthielt die Empfehlung, Amalia eine Klasse überspringen zu lassen.
»Möchtest du das denn, Kind?«, hatte Maria gefragt.
»Vielleicht ist es dann nicht mehr so langweilig«, hatte Amalia auf ihrem Tablet geantwortet und genickt.
»Wenn die Schule das empfiehlt, machen wir den Versuch«, sagte Maximilian.
»Du bist offenbar gar nicht so dumm, wie du aussiehst.«
Zum ersten Mal hatte Amalia auf Fredericos Frechheit reagiert. »Was man von dir kaum sagen kann.«
Maximilian hatte laut gelacht. »Geschieht dir ganz recht.«
Maria schmunzelte. Die Kleine besaß nicht nur einen scharfen Verstand, sie wusste auch mit Worten umzugehen, und sie hatte Frederico an einer empfindlichen Stelle getroffen. Im letzten Jahr war er durchs Abitur gerasselt. Ihr Enkel war nicht dumm, aber sträflich faul.
Maria erhob sich, als Alicia mit dem Geschirr erschien. Ludwig schlabberte den Rest des Wassers auf und schloss sich seiner Herrin an. Sie würde noch ein Stunde ruhen. Bis dahin sollten alle zum abendlichen Essen eingetroffen sein.
Madame Durand hatte am Morgen mit Maja den Speiseplan für den Tag besprochen.
Diese Aufgabe, wie viele weitere, hatte Madame schon lange übernommen. Sie war nicht sicher, ob die Signora es bemerkte. Sie schien mit ihren Pferden vollkommen ausgelastet. Eine Hausfrau war sie definitiv nicht. Sie arbeitete im Stall genauso hart wie die Pferdeburschen, gab Reitunterricht, ritt Pferde ein, bewegte sie und wachte nachts bei den trächtigen oder kranken Tieren.
Wenn sie sich um Frederico genauso kümmerte wie um ihre kostbaren Tiere, dachte sie, würde der Junge vielleicht nicht so aus dem Ruder laufen.
Der Einfluss des Vaters war eindeutig stärker als der Theresas. Seit der Pubertät, die in ihren Augen immer noch anhielt, orientierte sich Frederico am Vater.
Maximilian schien es zu gefallen. Mit dem Stolz eines Mannes auf einen Sohn, der ihm so ähnlich war.
Frederico trank zu viel. Er sah gut aus, und die Mädchen umschwärmten ihn. Für Madame war er ein Blender mit einem schwierigen Charakter. Er besaß eine gefährliche Mischung aus Charme, Bosheit und Aggressivität. In Theresas Augen glaubte sie manchmal tiefe Besorgnis und auch Trauer zu erkennen, wenn ihr Sohn bei Tisch schwadronierte, mit seinen Abenteuern angab, die alle mit M und S begannen, Motorräder und Mädchen, in dieser Reihenfolge, gefolgt von zweimal S, Spaß und Saufen. Mehr als einmal war die Polizei im Haus gewesen. Von Ossten hatte immer alles auf seine Art geregelt.
Wenn Frederico niemals die notwendigen Konsequenzen aus seinen Taten oder Untaten ziehen müsste, würde er weiter über die Stränge schlagen. Maximilian wiegelte jedes Mal ab, sprach von Testosteron und dem Übermut der Jugend.
Madame hielt Frederico für einen ausgewachsenen Sadisten, der sein Mütchen unter anderem an einem kleinen Mädchen kühlte. An Amalia. Sie fragte sich, wann sich die Wandlung Fredericos vom Muttersöhnchen zum Vaterkind vollzogen hatte. War Amalias Ankunft vor acht Jahren Auslöser dafür gewesen?
Sie stellte eine große Vase auf den Tisch in der Halle. Theresa legte Wert darauf, dass dort immer ein kindsgroßer Blumenstrauß stand.
Ein kostspieliges Vergnügen, dachte Madame. Alle paar Tage erschien ein Gärtner, der diese zauberhaften Arrangements lieferte.
Lautes Geklapper in der Küche riss sie aus ihren Gedanken.
Gleich darauf Majas Gezeter. »Wie ungeschickt! Sollen wir das Brot vom Fußboden essen?«
Alicia hatte das Backblech mit der Foccacia fallen lassen.
»Es ist nichts passiert«, hörte sie Alicia. »Es ist ganz geblieben.«
»Wisch es gut ab und pass ein bisschen besser auf.«
Madame stieg die Treppe hinauf und betrat, ohne anzuklopfen, Amalias Zimmer. Das Schild »Aperto!« an der Tür sagte ihr, dass sie eintreten durfte. Amalias Umriss am Fenster. Sie presste ihr Tablet an sich. Madame bückte sich und hob ein achtlos fallen gelassenes T-Shirt auf.
Amalia deutete nach draußen. Madame Durand trat ebenfalls ans Fenster. Amalia gebärdete: »Sie kommen.«
»Wer kommt?«
»Konstantin und die Blonde.«
»Sie heißt Annabel«, sagte Madame.
Unten flackerte die automatische Beleuchtung auf. Annabels blonde Locken tanzten im Licht.
Madame wandte sich vom Fenster ab. Sie knipste das Deckenlicht an und staunte. Amalia trug einen knöchellangen blauweiß gestreiften Rock aus feinstem Batist, dazu ein bauchfreies enges T-Shirt. Geschenke von Theresa, wie sie sich erinnerte.
Amalias kleine Brüste zeichneten sich unter dem hautengen Shirt ab. Es war nicht zu übersehen, stellte Madame Durand mit einer Mischung aus Bedauern und Entzücken fest, ihr Schützling wurde zur Frau. Und, wie sie vermutete, zu einer sehr aparten Frau. Die jetzt noch kindlichen Züge würden bald verschwinden, hohen Wangenknochen und einem trotzigen Kinn weichen. Die fein geschwungenen Lippen und die großen verträumten Augen waren ein Erbteil ihrer Mutter. Madame sah hinüber zu der Fotografie, die immer auf Amalias Nachttisch stand. Johann und Bella, Amalias Mutter, sie trug den Namen zu recht, war schön. Sie fragte sich, wo diese Frau heute wohl war und wie man das eigene Kind verlassen konnte.
Maximilian stellte den Maserati neben Annabels Wagen ab. Er sah sich um, der Mini fehlte. Auf dem Parkplatz standen nur die Familienkutsche, Madame Durands Alfa Romeo Giulia und Fredericos Motorrad.
Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass er gerade noch rechtzeitig käme.
Theresa war heute schon früh aufgebrochen. Wohin, wusste er nicht. Zum Abendessen wollte sie zurück sein.
Er wusste, dass er Theresa verletzt, dass sie unter seinen Eskapaden gelitten hatte und vielleicht noch litt. Aber niemals hatte sie sich dazu herabgelassen, mit ihm darüber zu sprechen. Sie schwieg. Und sie war bei ihm geblieben! Sie wandte sich niemals gegen ihn, weder in Gesellschaft, noch wenn sie alleine waren. Sie wies ihn nicht einmal in gewissen Nächten ab. Theresa schien entschlossen zu sein, eine vorbildliche Ehe zu führen, wie die mit ihrem ersten Mann, Thomas, Konstantins Vater.
Oh, sie konnte wütend werden, aber es ging niemals um ihre Beziehung. Die blieb unbesprochen, wurde mit keinem Wort in Frage gestellt. Sogar die Anwesenheit Amalias hatte sie ohne Widerspruch hingenommen.
Er wusste nicht, wieviel sie von seiner »Affäre« mit Bella mitbekommen hatte, aber sie konnte ihr nicht entgangen sein.
Seit damals hatte sie sich verändert. Wo früher Wärme gewesen war, herrschte jetzt Kühle, nein, eher Beherrschtheit. Sie besaß immer noch ihren Humor, aber die Leichtigkeit war ihr abhanden gekommen. In den Augen fehlte das Lachen. Es war Melancholie gewichen, bis … Wann war ihr Lachen zurückgekommen? Vor drei oder vier Jahren?
Er stieg aus und ging den beleuchteten Weg zum Haus. Bevor er um die Ecke bog, konnte er die Stimmen bereits hören. Seine Familie schien versammelt zu sein. Er trat in den Lichtschein unter der Kastanie.
»Wo ist Theresa?«
»Sie hat angerufen, es wird etwas später. Auf der Strecke hinter Siena, in Höhe Murlo, gab es einen Verkehrsunfall. Aber jetzt müsste sie gleich da sein.« Konstantins Antwort beruhigte Maximilian. Je älter er wurde, desto abhängiger wurde er von Theresas Anwesenheit.
Frederico flirtete mit Annabel. Madame reichte Maximilian eine Karaffe. Amalia, er musste zweimal hinsehen, als sie sich neben Konstantin setzte, sah ihrer Mutter zum Verzweifeln ähnlich. Statt eines der üblichen verschlissenen, unförmigen T-Shirts, trug sie ein hautenges Shirt zu einem halblangen Rock. Sie sah heute Abend nicht wie ein Junge aus, sondern wie ein junges Mädchen auf dem Weg zur Frau.
Er hatte ihre Mutter betrunken gemacht und verführt, er hatte sie gewollt, wie alles, was seinem Bruder gehörte. Geblieben war ihm Bellas Tochter, von der er nicht wusste, ob sie Johanns oder seine Tochter war. Er war nicht sicher, ob er es wissen wollte.
Annabel hörte Konstantin.
»Na, mein Milou, was hast du heute angestellt?«
»Ich habe im Stall geholfen. Marisa war da, sie hat nach Desdemona gesehen.« Annabel reckte den Hals, um einen Blick auf Amalias Tablet zu erhaschen.
»Zeigst du mir morgen dein Fohlen? Wie heißt es noch?«
»Es heißt Lauser und ist ein Hengst!!! Das habe ich dir doch geschrieben, Tintin!!!« Drei Ausrufezeichen bedeutete Ungeduld.
Konstantin legte einen Arm um Amalias Schultern. »Ja, ich erinnere mich.«
Er stand auf, als er Theresas schnellen Schritt erkannte.
Auch Maximilian erhob sich, um Theresa zu begrüßen. Sie küsste ihn flüchtig, ließ sich Konstantins Umarmung gefallen und ging zum Haus. »Ich bin gleich bei euch.«
Annabel legte die Hand auf Konstantins Arm, als er sich wieder setzte. Sie sah Theresa nach. Die Frau war groß, schlank, und, obwohl sie den ganzen Tag unterwegs gewesen sein musste, wirkte sie gepflegt.
Ihr Blick traf sich mit dem Marias. Annabel fürchtete, sie könnte womöglich ihre Gedanken lesen.
Maria nickte ihr zu. »Wie war Ihr Tag?«
»Wir waren in Grosseto. Ich habe ein paar Sachen eingekauft. Keine sehr elegante Stadt.«
»Wo kaufen Sie denn ein?«
»In Mailand oder Rom. Weihnachten fliegen wir nach London oder New York.«
Sie plappert, dachte Maria.
»Konstantin hat mir seine alte Schule gezeigt. Ich war nicht auf einer staatlichen Schule.«
»Ach ja? Wo sind Sie zur Schule gegangen?«
»Ich war in einem Internat in der Schweiz.«
»Der Wahnsinn, hätte ich auch gerne gemacht«, sagte Frederico.
»Was hättest du auch gerne gemacht?«
Theresa hatte offenbar den letzten Satz ihres Sohnes gehört. Sie sah frisch und kühl aus. Ihr Kleid ließ Schultern und Rücken frei. Die leicht gebräunte Haut schimmerte im Kerzenlicht.
»Ich wäre gerne in einem schicken Internat zur Schule gegangen.«
Sie beugte sich über Frederico und küsste sein Haar. »Ich glaube, mein Schatz, du hättest furchtbar geweint, wenn wir dich weggeschickt hätten.«
Maria lachte leise. Frederico errötete tatsächlich. Theresa nahm zwischen Konstantin und Amalia Platz.
»Du siehst bezaubernd aus, meine Liebe.« Maxim prostete ihr zu.
»Danke.« Sie hob ihr Glas.
»Ja, Mama, du bist wie immer die Schönste«, bestätigte Konstantin.
Annabels Gesichtsausdruck ließ sich schwer deuten, bemerkte Maria schmunzelnd.
Maximilian schenkte sich ein weiteres Glas Wein ein.
Annabel griff nach Konstantins Arm und säuselte: »Du hast recht, Liebling, deine Mutter sieht noch sehr gut aus.«
Theresa hob eine Braue und riss ein Stück Foccacia entzwei. Sie hatte anscheinend das noch in Annabels Antwort gehört und verstanden.
»Konstantin«, sagte sie, »in Gegenwart anderer Frauen, solltest du auf solche Komplimente verzichten.«
»Aber, Mama, Annabel weiß, dass ich sie liebe, egal, wie sie …«
Oh mein Gott, Maria bemühte sich, ihre Heiterkeit zu unterdrücken.
»Wo habt ihr euch kennengelernt«, versuchte sie das Gespräch in andere Bahnen zu lenken.
»In Mailand. Annabel hat dort Kunstgeschichte studiert.«
»Was hast du in Siena gemacht?« Maxim hatte, wie so oft, nicht zugehört. Aber in diesem Moment war sie ihm für die Unterbrechung dankbar.
»Ich habe mit Professor Donato gesprochen.«
»Bist du krank?«
»Nein«, sie lächelte, »aber wenn du dich erinnerst, hatte Raffael einen Unfall.«
Sie sah hinüber zu Frederico. Er biss sich auf die Lippe.
»Raffael liegt in einer Privatklinik?«
»Ja.« Theresa steckte sich eine Olive in den Mund.
»Er muss gut versichert sein«, sagte Maxim.
»Nein, mein Lieber, ist er nicht. Ich habe dafür gesorgt, dass er bei Donato behandelt wird.«
»Aha? Gibt es dafür einen Grund?«
»Allerdings.«
»Und?«
»Ich möchte das später mit dir besprechen, falls du nicht noch ausgehst.« Sie wandte sich ihrem jüngeren Sohn zu. »Ich wünsche, dass du dabei bist, Frederico.«
Oha! Wenn ihre Tochter diesen Ton anschlug, wurde es ernst. Maria legte ihre Serviette neben den Teller.