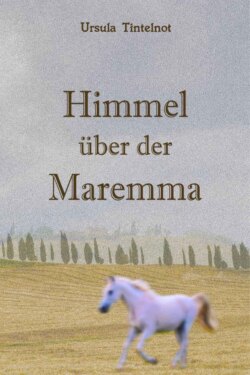Читать книгу Himmel über der Maremma - Ursula Tintelnot - Страница 8
Vorwürfe
Оглавление»Du weißt, wie ein Hengst reagiert, wenn er eine rossige Stute wittert. Für diesen Unfall bist du allein verantwortlich.«
Ja, er hätte dem Hengst nicht alleine die Stalltür öffnen dürfen. Aber es war nun mal passiert, und Raffael lebte ja noch. Den Stallmeister deswegen gleich in eine Privatklinik einweisen zu lassen …
»Hast du mich verstanden, Frederico?«
»Ja, Mama. Aber Raffael lebt ja noch.«
Theresas Augen wurden schmal. Sie richtete sich auf. »Zynismus steht dir nicht, mein Junge.«
Maxim stand vor dem kalten Kamin in der Bibliothek, beobachtete seine Frau und hörte ihre Vorwürfe.
Eine Löwin, die ein Junges zurechtweist, das zu weit gegangen ist, dachte er. Sie sollte nicht in diesem Ton mit Frederico sprechen.
Ich kenne dich nicht mehr, fuhr es Theresa durch den Kopf.
Sie machte sich wirklich Sorgen um ihren Sohn.
Er war kein kleiner Junge mehr, aber er benahm sich so. Mit neunzehn sollte er überlegter handeln.
Man konnte ihn nicht zwingen, das Gut zu übernehmen. Auch darüber würden sie sprechen müssen. Sie seufzte. Er war der Erbe, und sie war sicher, dass Maxim sich nichts mehr wünschte, als dass Frederico dieses Erbe annahm.
Nicht heute, entschied sie.
Vielleicht sollte sie das Gespräch darüber Maxim überlassen? Sie fand keinen Zugang mehr zu ihrem Sohn.
Sie wandte sich an ihren Mann. »Der Grund für meine Entscheidung, Raffael von Professor Donato behandeln zu lassen, ist, dass unser Sohn an diesem Unfall schuld ist.«
»Ja, das ist richtig, ich halte es trotzdem für etwas übertrieben«, sagte Maxim und sah auf seine Armbanduhr.
Theresa erhob sich, strich ihr Kleid mit einer Bewegung glatt, die selbstverständlich und aufreizend zugleich war. Sie ging zur Tür.
»Ich sehe, du willst noch ausgehen, Maxim. Wir sehen uns morgen.«
Einen Moment lang überlegte Maximilian, nicht mehr nach Grosseto zu fahren. Manchmal verstand er sich selbst nicht. Er verließ eine Frau, die er bewunderte, ja, liebte, um sich bei einer Schlampe zu beweisen. Sidonie war zwar eine attraktive Schlampe, aber eben auch nicht mehr. Seine Frau war eine elegante, intelligente … Theresa forderte ihn heraus. Sie war exquisit und anstrengend. Bei Sidonie konnte er sich gehen lassen.
Frederico sah erleichtert hinter seiner Mutter her. Für einen Moment hasste er sie. Sie wurde zu einer Fremden, wenn sie mit ihm in diesem Ton sprach, kühl und emotionslos. Lieber war ihm, wenn sie richtig böse wurde, damit konnte er besser umgehen.
Theresa sie musste sich beherrschen, die Tür nicht zuzuknallen. Wann hatte sie den Kontakt zu ihrem Kind verloren? Nein, dieses Gespräch war nicht sehr erfolgreich verlaufen. Maxim hatte nicht nur einmal auf die Uhr geschaut, und Frederico … hatte er tatsächlich gesagt »Er lebt ja noch«?
Sie war kurz davor gewesen, ihn zu schlagen.
Für einen Moment lehnte sie sich gegen die Wand und schloss die Augen.
Als sie Frederico hörte, erstarrte sie.
»Ich versteh Mama nicht. Sie übertreibt ihre Verantwortung. Muss man einen Pferdeburschen derart verwöhnen? Oder steckt da noch was anderes dahinter?« Ihr Sohn war scharfsichtiger, als ihr lieb sein konnte.
»Raffael ist nicht einfach ein Pferdebursche, er hat eine ausgezeichnete Ausbildung. Von Schafzucht bis Pferdehaltung hat er alles gelernt. Er könnte morgen den Betrieb hier übernehmen.«
Theresa hörte Fredericos Antwort: »Na, dann hast du ja einen Nachfolger.«
»Ich wünschte, du könntest das sein.«
»Nein, Papa, vergiss es.«
Ihr Sohn hatte Höhenflüge im wahrsten Sinn. Er wollte Pilot werden.
Theresa drehte ein Glas zwischen ihren Fingern und blickte auf den Schimmer von Silber am Horizont.
Davor schwebten Nebelinseln über den schlafenden Hügeln.
Diese warme Nacht ist, dachte Theresa, nicht gemacht, um alleine zu sein.
Sie beobachtete den torkelnden Flug der Lucciole. Die Leuchtkäferchen blinkten wie vom Himmel gefallene Sterne.
Bald nach ihrem Gespräch hatte sie zuerst Maxims Wagen, etwas später auch Fredericos Maschine gehört. Wie immer sorgte sie sich um Frederico und hoffte, dass er vernünftig genug wäre, nicht in betrunkenem Zustand zu fahren.
Ihr Sohn hatte Raffael einen Pferdeburschen genannt.
Sie kannte Raffaels Biographie. Mit sechzehn hatte er den kleinen Hof seiner Eltern verlassen und sechs Jahre lang erst in Australien und später in Neuseeland alles gelernt, was es über Tierwirtschaft, Aufzucht von Pferden, Rindern und Schafen zu lernen gab, einschließlich Milchwirtschaft und Bienenzucht.
Sie lächelte. Er war ihr haushoch überlegen.
Als er zurückkam, hatte er seine Jugendliebe geheiratet, eine Familie gegründet und vier Jahre nach der Geburt seiner Zwillingsmädchen feststellen müssen, dass seine Ehe gescheitert war.
Die Trennung von seinen Kindern hatte er nie verwunden. Sooft wie möglich besuchte er sie. In den Ferien durfte er Giuliana und Gala zu sich holen.
»Was machst du hier, Mama?«
Theresa schrak auf, als sie Konstantin hörte. Sie musste eingeschlafen sein. »Ich genieße die Ruhe und versuche nachzudenken.«
Konstantin zog einen Stuhl heran und setzte sich zu ihr. »Ich störe dich nicht lange. Annabel erwartet mich. Du solltest auch zu Bett gehen, es ist spät.«
»Manchmal schlafe ich hier draußen. Es ist schön unter den Sternen.«
Wenn er an seine Mutter dachte, sah er sie mit wehenden Haaren, ohne Sattel auf Luna über die Hügel der Maremma jagen. Er war, dank ihr, ein guter Reiter, aber die Begeisterung, die sie beflügelte, fehlte ihm.
»Du wirst deinem Vater immer ähnlicher«, sagte sie.
»Du warst mit ihm glücklicher als mit Maximilian.« Das war keine Frage, sondern eine Feststellung.
Theresa antwortete nicht direkt. Unter dichten Wimpern blickte sie ihn an. »Dein Vater und ich waren nur kurz verheiratet. Die erste Liebe noch nicht vorbei. Ehen entwickeln sich. Es gibt keine Garantien für das Glück und die Liebe.«
»Ich werde Annabel immer lieben«, sagte Konstantin.
Er war ein Kind. Theresa lächelte. »Natürlich wirst du das, mein Schatz.«
»Wir werden heiraten, Mama.«
Oh du meine Güte, sie musste an sich halten, das nicht laut auszusprechen.
»Natürlich«, sagte sie noch einmal, »wenn man sich liebt, will man das der Welt zeigen. Aber das muss ja sicher nicht sofort sein?«
Konstantin griff nach ihrem Glas, trank einen Schluck und sagte: »Annabel möchte noch in diesem Jahr heiraten.«
»Und du, was möchtest du?«
»September oder Oktober«, sagte ihr Sohn, »sind schöne üppige Monate. Trauben, Nüsse, Obst, Oliven, alles ist reif, die Abende sind noch warm.«
»Und, wie du weißt, ist es die Zeit der Ernte, die Zeit der Arbeit.«
Er lachte. »Mama, du schaffst das. Unsere Gäste können bei der Olivenernte helfen.«
Sie lachte. »Lieber nicht.«
»Konstantin?« Er sprang auf.
»Annabel, hier sind wir.«
»Du wolltest doch nur ganz kurz …« Sie schwieg, als sie erkannte, dass Konstantin nicht alleine war. Die junge Frau stand zwischen den geöffneten Fenstertüren. Reizend in ihrem kurzen, weißen Hemd.
Theresa konnte ihren Sohn verstehen. Sie war ein hübscher Anblick, auch wenn sie, wie jetzt, schmollte.
»Es tut mir leid, willst du dich noch zu uns setzen, Liebling?«
»Nein, ich bin müde.«
Ihre Stimme klingt kindlich und eine Spur zu schrill. Theresa rief sich zur Ordnung.
»Gute Nacht, Mama.«
»Gute Nacht, Konstantin … Annabel.«
Sie erhob sich, um ebenfalls ins Haus zu gehen. Erst als sie die Türen des Wintergartens schloss, fiel ihr auf, dass Konstantin ihr die Antwort auf ihre Frage nach seinen Wünschen, schuldig geblieben war.
»Guten Morgen, Maja. Guten Morgen, Alicia.«
»Guten Morgen, Signora.«
Verblüfft sah Theresa Alicia hinterher, die schluchzend aus der Küche rannte. Sie wandte sich an die Köchin. »Was ist passiert?«
»Heute Nacht ist Kittys Mama gestorben.«
»Ach, die arme Kleine. Wissen Sie schon, wann die Trauerfeier stattfindet?«
Maja schüttelte den Kopf. »Nein, Signora.«
Die Trauerfeier fand drei Tage später in der Kirche von Basso statt. In brütender Hitze überquerten Maximilian und Theresa, von ihren Söhnen, Amalia und Madame Durand begleitet, den Kirchplatz. Maria ging am Arm ihres ältesten Enkels.
Die Blicke der in tiefes Schwarz gehüllten Dorfbewohner folgten ihnen. Es war ungeschriebenes Gesetz, dass die erste Bank dem Gutsbesitzer vorbehalten war, was Maxim wie eine Selbstverständlichkeit hinnahm, Theresa mehr als peinlich war.
Wir leben nicht mehr im achtzehnten Jahrhundert.
Sie hätte zu gerne gewusst, ob die Bank leer blieb, wenn sie nicht zur Kirche gingen.
Raffael lachte, als sie ihn danach fragte. »Nein, Theresa. Wir nutzen sie, aber mit schlechtem Gewissen.«
»Idiot!«
Raffael hatte sich vor zwei Tagen selbst entlassen. »Ich kann nicht auf deine Kosten in einer Privatklinik herumliegen, ich bin kein Gigolo.«
Sein Zorn auf sie war noch nicht ganz verraucht.
Nachdem ihre Familie Platz genommen hatte, begann der Gottesdienst. Theresa spürte Raffaels Blick im Nacken. Er saß in der zweiten Bank, direkt hinter ihr. Dank Annabel, die sich im letzten Moment mit einem »Ich habe rasende Kopfschmerzen, Liebling« entschuldigt hatte, waren sie zu spät gekommen.
Marisa saß neben Raffael. Ihr jüngster Sohn, Gasparo, ein kleiner Teufel, begabt mit der Stimme eines Engels, sang das Ave Maria so ergreifend mit seiner knabenhaften silbernen Stimme, dass kein Auge trocken blieb.
Im achtzehnten Jahrhundert hätte man dich um dieser Stimme willen kastriert, dachte Theresa.
»Ich tät mich sehr freuen, wenn Sie noch mit zu Silvio kommen täten«, bat Kitty. Sie sah verheult aus, aber gefasst.
»Natürlich, Kitty, wir kommen sehr gerne.«
Der Gang ins Ristorante nach dem Trauergottesdienst.
Das kleine Gasthaus hieß zwar nach seinem Besitzer Silvio, aber die wahre Herrin war Aurelia, seine Frau. Eine rassige, wilde Schöne, die ihren Mann fest im Griff hatte. Es hieß, dass sie ihren Gästen nicht nur Speise und Trank anbot, sondern gelegentlich auch sich selbst. Jetzt knallte sie Raffael ein Glas mit solcher Wucht vor die Nase, dass der Wein herausspritzte. Sie zischte ihm etwas zu und wandte sich wütend ab. Raffael wischte sich ungerührt den Wein vom Hemd. Theresa fragte sich, was er mit Aurelia zu schaffen hatte.
»Ich muss noch zu den Schafen raus«, flüsterte Maxim, »und zur Molkerei.« Theresa nickte. »Ich weiß. Wir werden nicht länger als eine Stunde bleiben.«
Maximilian würde mindestens zwei Tage weg sein. Sie sah hinüber zu Raffael. Amalia saß bei ihm und hielt ihm ihr Tablet entgegen. Raffael las und lachte. Dann sagte er etwas zu dem Mädchen.
Theresa erschauerte.
Unschicklich, dachte sie, beim Leichenschmaus ein derart ungezügeltes körperliches Verlangen zu spüren.
Heute Nacht würde sie bei ihm liegen.
Konstantin war gegangen, um, wie er sagte, nach Annabel zu sehen. Theresa erhob sich. »Kommst du?«, fragte sie Maxim über die Schulter.
Er erhob sich ebenfalls. Sie drückten Kitty und ihrem Großvater die Hand.
»Kitty, nehmen Sie sich Zeit. Kommen Sie erst wieder, wenn es Ihnen besser geht.«
»Ja, Signora, danke, Signore.«
Maxim machte keinen Versuch, ihren Arm zu nehmen, als sie den schmalen Weg aufwärts stiegen.
Vor ein paar Jahren hättest du es noch getan, dachte Theresa.
Sie ging etwas langsamer und hakte sich bei ihrem Mann ein. »Musst du wirklich heute noch fahren, mein Lieber?«
Schotter und Kies knirschten bei jedem ihrer Schritte.
»Meine Schuhe sind ruiniert, wir hätten nicht diesen Weg nehmen sollen.«
Der Weg führte schattig und steil zwischen Wiesen mit Olivenbäumen vom Dorf bis zu ihrem Haus.
Er schnaufte. »Wir hätten fahren sollen bei dieser Hitze.«
»Ein bisschen Sport kann dir nicht schaden.«
»Theresa, ich bin ein alter Mann.«
»Ich weiß.« Sie lachte hell auf. »Das sagst du immer, wenn dir etwas unbequem ist.«
Zwei Stunden später war Maximilian auf dem Weg zur Molkerei. Am Abend verabschiedeten sich Konstantin, Annabel und Frederico.
»Wir fahren nach Florenz«, sagte Frederico. »Annabel soll dort das Nachtleben kennenlernen.«
Überraschend schnell hatte sich die junge Frau von ihrer Migräne erholt.
»Es freut mich, dass es Ihnen wieder gut geht, Annabel.«
Vor ein paar Stunden musste Konstantin dich noch auf dein Zimmer bringen, dachte Theresa amüsiert und ärgerlich zugleich.
Diese raffinierte kleine Person hatte ihren Sohn voll im Griff, erkannte sie, nicht ohne eine Spur von Bewunderung.
Theresa entledigte sich der Trauerkleidung, duschte und wählte ein rückenfreies weißes Sommerkleid, das nur im Nacken gehalten wurde.
Als sie das Haus verließ, hörte sie die ersten Töne eines der »Lieder ohne Worte« von Felix Mendelssohn. Maria variierte das Thema. Die Töne schwebten in die Nacht hinaus und begleiteten Theresa ein Stück weit.
Madame Durands Blicke begleiteten sie ebenfalls. Sie stand im Zimmer ihres Zöglings am Fenster.
»Theresa besucht Raffael.«
»Vielleicht geht sie zum Stall.«
»Nicht in einem weißen Kleid«, gebärdete Amalia.
So jung und so schlau, dachte Madame.
»Kann man zwei Männer lieben?«
»Ich glaube schon.«
»Ich könnte das nicht!«
»Wir werden sehen, mein Kind.«
Madame strich Amalia über die kurzen Locken. Sie ging zur Tür. Dort wandte sie sich noch einmal um.
»Amalia, Annabel hat nun genug gelitten, ab morgen wirst du dich zu den Mahlzeiten wieder umziehen.«
Amalias Mund verzog sich zu einem spitzbübischen Lächeln.
Amalia nahm Annabel inzwischen hin, wie man eine Topfpflanze akzeptierte. Sie übersah sie einfach. Aber nachdem Annabel unvorsichtigerweise von ihrer ausgeprägten Allergie gegen Pferdehaare gesprochen hatte, war ihre Stunde gekommen. Amalia kam grundsätzlich gerade aus dem Stall, wenn sie sich zu Tisch begaben, und war nicht dazu zu bewegen, sich umzuziehen oder die Hände zu waschen. Annabel sah gleich viel weniger hübsch aus mit roter Nase und geschwollenen Lidern.
»Es ist Zeit fürs Bett. Schlaf gut, Amalia.«
Sie schloss die Tür hinter sich. Madame lächelte, das Mädchen entwickelte sich zu einer raffinierten jungen Frau. Und sie wusste genau, was sie wollte.
Amalia kroch ins Bett und nahm ein Buch vom Nachttisch, aber sie las nicht. Sie dachte an Konstantin.
»Hast du mir was mitgebracht?« Amalia hatte auf ihr Tablet gezeigt.
Konstantin hatte gelacht. »Nein, daran habe ich nicht gedacht.«
Ihr hübscher Mund hatte sich verzogen.
»Hast du denn einen Wunsch?«
»Oh, ja.«, schrieb sie. Augenaufschlag.
»Sag schon, vielleicht kann ich ihn dir erfüllen.«
Sie hatte den Augenaufschlag vor dem Spiegel geübt und sich das Gespräch in allen Einzelheiten vorgestellt. Sie musste nur ein paar Minuten mit ihm allein sein.
Der Moment war gekommen, als er zum Frühstück erschien. Annabel stand nicht vor Mittag auf. Konstantin war, wie Amalia, ein Frühaufsteher.
»Also«, er nahm einen Schluck Kaffee, »was ist es?«
»Ich wünsche mir …« schrieb sie.
»Ja?«
»Ich wünsche mir einen Tag mit dir.«
»Aber ich bin doch hier.« Er sah sie erstaunt und fragend an.
Mein kleiner Milou wird langsam erwachsen, dachte er.
Sie war in die Höhe geschossen im letzten halben Jahr. Trotzdem war sie noch so entzückend kindlich, wie er sie in Erinnerung hatte.
»Das ist nicht wie früher.« Amalia schob ihm das Tablet hin und sah ihn an. »Du bist nicht alleine hier, immer ist Annabel bei dir.«
Er sah sich um. »Und wo ist sie jetzt? Ich kann sie nicht sehen.«
Seine Cousine ging nicht auf seinen Spott ein. Sie starrte ihn immer noch fragend an. Dann schrieb sie: »Schenkst du mir einen Tag?«
Er dachte nach. »Ich schenke dir einen Ausritt, nur wir beide, versprochen.«
Amalia lächelte und überlegte, wie sie den Ausritt verlängern könnte.
Amalia und Konstantin hatten den kleinen Hengst und Luna, seine Mutter, auf der Weide besucht und danach Norma und Sultan gesattelt.
»Nehmt Norma und Sultan«, hatte Theresa gebeten. »Die beiden verwildern auf der Weide. Es ist gut, wenn sie geritten werden.«
»Du hast Sultan noch nicht verkauft?«
»Nein, Konstantin, der Kunde ist nicht erschienen, will aber in ein paar Tagen kommen. Bis dahin muss Sultan noch an die Kandare genommen werden.«
Der dunkelbraune Wallach war ein noch junges, sehr temperamentvolles Tier. Theresa hatte sich vorgenommen, ihn in den nächsten Tagen im Stall zu lassen und ihn jeden Tag zu reiten.
Sie sah Amalia und Konstantin davonreiten. Die Kleine hatte es tatsächlich geschafft, ihn von Annabel loszueisen. Sie fragte sich, wie sie das angestellt hatte.
Vielleicht sollte ich dich fragen, du scheinst geschickter als ich zu sein, dachte sie.
Aber dann schalt sie sich. Ihr Sohn war verliebt. Er wollte dieses Mädchen heiraten. Wenn sie Konstantin nicht verlieren wollte, sollte sie sich an den Gedanken gewöhnen und versuchen, Annabel besser kennenzulernen.
Sie stach mit der Mistgabel heftig in einen Haufen Stroh und verteilte ihn energisch in Sultans Box.
Amalia durfte Sultan reiten. Konstantin ritt die zierlichere Stute. Theresa fragte sich, ob sie das Richtige getan hatte, als sie es ihr erlaubt hatte. Aber Amalia war eine ausgezeichnete Reiterin, mit einem ausgeprägten Gefühl für Pferde. Sie hatte in den letzten Jahren praktisch jeden Tag auf einem Pferd gesessen, während Konstantin, seit er studierte, nur noch in den Ferien zum Reiten kam.
Bald würde er mit einem Team von Ärzten nach Afrika reisen, um eine Reportage zu schreiben. Was Annabel davon hielt, wusste Theresa nicht. Sie konnte sich die verwöhnte junge Frau nicht in einem Camp vorstellen.
Mit Allergien gegen Tierhaare und Migräneanfällen, dachte Theresa, wirst du nicht weit kommen.
Herrgott, sie klang schon wieder boshaft und ablehnend.
Da Raffael noch ausfiel, er hatte strikte Anweisung, sich zu schonen, wollte sie ihren Sohn fragen, ob er für einen täglichen Ausritt zur Verfügung stand. Mit dem Unterarm wischte sie sich Schweiß und Staub von der Stirn.
Ihr Gesicht glühte, was nicht nur an der Arbeit lag. Ihre Gedanken waren bei der letzten Nacht. Raffael hatte sie ohne Umstände an sich gezogen, den Verschluss ihres Kleides geöffnet und sie geküsst, als ob er sie verschlingen wollte.
Sie träumte nicht von anderen Ländern wie ihre Söhne. Ihre Welt hatte sich verengt auf dieses eine Zimmer, dieses eine Bett, diesen einen Mann. Die Mattigkeit danach in seiner sanften Umklammerung.
Theresa stellte die Mistgabel gegen die Wand und rief nach Berto.
»Signora?«
Sie schickte ihn auf die Weide. »Sieh nach, ob genug Wasser im Tank ist.«
Zu ärgerlich, dass die Pumpe nicht funktionierte.
»Bis die Pumpe repariert ist, müsst ihr die Tröge von Hand füllen.«
»Natürlich, Signora.«
»Und füll den Wassereimer für Sultan. Ich will ihn, bis der Käufer kommt, im Stall haben.«
»Si, Signora.«
Sie hörte ihn nach Luca rufen. Die Pferdeburschen bewohnten die Kammern am Ende des lang gezogenen Stalles. Sie sah auf die Uhr. In einer Stunde kämen ihre Reitschüler. Auf der Reitbahn vorm Stall warteten drei Pferde.
Ihr Handy gab einen Harfenton von sich. »Maxim?«
»Wartet heute nicht auf mich, ich komme erst morgen Abend zurück.«
»Gut.«
»Alles in Ordnung bei euch?«
»Ja. Amalia und Konstantin machen einen Ausritt, und Frederico nimmt die Gelegenheit wahr, seine zukünftige Schwägerin zu beeindrucken.«
»Höre ich da Zynismus?«
»Aber nein. Bis morgen, mein Lieber.«
Beinahe hätte sie ausgesprochen, was sie dachte. Frederico hatte viel von seinem Vater. Er musste es bei jeder Frau probieren.
Theresa steckte das Handy ein. Sie brauchte eine Dusche und wollte sich noch umziehen, bevor die Reitschüler auftauchten.