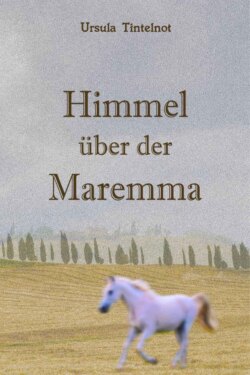Читать книгу Himmel über der Maremma - Ursula Tintelnot - Страница 6
Liebe und Eifersucht
Оглавление»Ist Marisa schon da?«
Sie bekam keine Antwort, als sie den Stall betrat. Marisa war Tierärztin und Theresas Freundin.
Wenn es Probleme mit den Pferden, Hunden oder Schafen gab, wurde sie gerufen. Sie war ein Naturereignis. Eine Frau, die sich einen Dreck um die Meinung anderer scherte. »Tu, was du tun musst, frag nicht erst.«
Sie hatte fünf Söhne von fünf Männern. Mit keinem war sie verheiratet gewesen. Ihr rotes Haar leuchtete wie Feuer in der Sonne und Sommersprossen zierten ihr Gesicht wie Gänseblümchen eine Sommerwiese.
Mit kräftigen Händen griff sie zu. Bis zum Ellbogen mit Blut und Schleim bedeckt, half sie den Fohlen auf die Welt, die nicht allein kommen wollten.
Die Nachgeburt der letzten Nacht musste untersucht werden. Eine der Stuten war am Bein verletzt. Die Wunde war entzündet.
Im Stall war niemand. Nur die Hunde begrüßten sie. Theresa ging durch die lange Gasse zwischen den Boxen. Fast alle Tiere standen auf der Weide. Desdemona wieherte leise.
»Na, meine Hübsche, gleich kommt Marisa, sie wird dir helfen.«
Sie streichelte sanft die Nüstern der verletzten Stute. Desdemona schnaubte. Es roch nach frischem Heu. Die geöffneten Stalltüren ließen die noch erträgliche Morgenluft ein. Aber auch heute würde sich die Hitze gnadenlos über das Land legen.
Theresa trug ein ärmelloses T-Shirt und Reithosen. Sie wollte später einige der Pferde bewegen, und sie erwartete zwei Reitschülerinnen. Auf dem Weg zur Sattelkammer hörte sie Schritte und gleich darauf Gelächter. In der offenen Tür konnte sie zwei Silhouetten erkennen.
»Da bist du.«
»Da bin ich.« Marisa umarmte sie.
Raffael küsste Theresa.
Marisa grinste. Sie sagte: »Deine Nachgeburt ist auf den ersten Blick in Ordnung.«
Sie hatte sie auf Vollständigkeit überprüft. Jetzt ging sie zu der verletzten Stute.
Seit Raffael da ist, dachte Marisa, geht es Theresa besser.
Sie hatte ihre Vitalität, ihren Witz wiedergefunden.
Romantische Liebe war in Marisas Augen eine Erfindung der Neuzeit. Die Menschheit war Jahrtausende ohne sie ausgekommen. Gesunder Sex war wunderbar und unverbindlich, Enttäuschungen nicht programmiert.
Aber Theresa hatte andere Vorstellungen und Wünsche. Sie hatte sich auf ihren ersten Ehemann, Konstantins Vater, verlassen können. Das hatte sie auch von Maximilian erwartet. Ein Irrtum, wie sie bald hatte erkennen müssen.
Marisa hatte versucht, ihre Freundin zu trösten. Theresa war anders als sie. Sie wünschte sich Liebe von einem Mann, sie selbst tat das nicht. Ihr genügte die Liebe zu ihren Söhnen und den Tieren.
Amalia stand vor dem geöffneten Kleiderschrank. Sie wühlte in ihren T-Shirts.
Auf dem Fußboden türmten sich Röcke und Hosen.
»Was ist denn hier los?« Madame Durand stand in der Tür.
Amalia fuhr herum. »Ich habe nichts anzuziehen.« Sie nutzte die Gebärdensprache.
Madame Durand war die Einzige im Haus, die das Gebärden beherrschte.
»Aha? Und was ist das?« Sie deutete auf den Boden.
Amalia sah sie unschlüssig an. »Ich weiß nicht, was ich anziehen soll.«
»Wollen wir mal zusammen nachsehen?«
Amalia nickte eifrig. Sie war nicht eitel, ganz im Gegenteil. Abgeschnittene Jeans und verwaschene Shirts genügten ihr normalerweise.
Die reichen kleinen Mädchen in Amalias Klasse kamen in Rosa und Weiß gehüllt, trugen Schmuck und fühlten sich verhöhnt.
Die Privatschule war zu Beginn ein Problem gewesen. Zum ersten Mal war Amalia mit Kindern aus ihrem eigenen Milieu konfrontiert worden. Auf dem Gut kam sie nur mit den Kindern der Dorfbewohner und der Angestellten in Berührung. Manchmal auch mit Theresas Reitschülern. Sie hatte nie erfahren, wie es sich anfühlte, ausgeschlossen oder gar gemobbt zu werden. Mit Ausnahme ihres Cousins war Amalia nie auf Ablehnung gestoßen.
Amalia hatte, wie immer, den Versuch gemacht, mit ihren Problemen selbst fertig zu werden, bis Madame sie darauf ansprach. Sie hatte gespürt, dass etwas nicht stimmte.
Voller Abscheu dachte Madame an ihren Zusammenstoß mit der Direktorin, einer schweren, offenbar konfliktscheuen Frau, die ihr zu verstehen gegeben hatte, dass sie nicht die Absicht hätte, mit den reichen Eltern ihrer verwöhnten Bälger zu sprechen.
Madame schilderte Theresa das Gespräch mit ihr.
»Finden Sie heraus, wann der nächste Elternabend stattfindet.«
»Gewiss.«
Sie will hingehen, dachte Madame Durand erstaunt.
Theresa hatte nie viel Interesse an dem Mündel ihres Mannes gezeigt. Und doch schien sie auf ihre Art das Mädchen zu mögen. Sie erteilte Amalia regelmäßig Reitunterricht und hatte ihr Lunas Fohlen geschenkt. Der kleine Hengst war Amalias ganze Liebe. Und, dachte Madame, Konstantin.
Denn Amalias Wunsch, heute hübsch auszusehen, lag zweifellos an Konstantins Kommen.
»Du freust dich auf Konstantin?«
Amalia nickte strahlend und hob den Daumen. »Ich will ihm mein Fohlen zeigen. Wir müssen es doch taufen.«
Madame Durand lächelte. »Weißt du schon, wie es heißen soll?«
Amalia schüttelte den Kopf und zog sich ein blaues Trägerkleidchen über, das ihr sehr gut stand. Sie drehte sich vor dem Spiegel. Als sie sah, dass Amalia das Kleid wieder auszog und nach einem ärmellosen verwaschenen T-Shirt griff, floh Madame und zog die Tür zu.
Oh, du mein Gott, dachte sie. Eine verliebte Dreizehnjährige, wenn das mal gut geht.
Madame Durands Sorgen waren nur allzu berechtigt.
Konstantin entstieg am Nachmittag einem todschicken Sportcoupé und mit ihm Annabel.
Sie trug zu einem schneeweißen Seidenkleid Stilettos und wirkte beneidenswert kühl, bei sechsunddreißig Grad. Als käme sie geradewegs aus der Dusche. Und sie war bildhübsch. Frederico und Maximilian saßen unter der riesigen Kastanie vor dem Haus. Die Krone des Baumes schützte vor Regen und Sonne. Annabel hängte sich bei Konstantin ein, als sie auf das Haus zuschritt.
Mit den Schuhen, dachte Madame, würde sie ohne Unterstützung nicht weit kommen. Auffahrt und Hof waren gepflastert wie eine alte Dorfstraße.
Konstantin stellte seine Freundin vor: »Maximilian, das ist Annabel, Frederico, mein Bruder, und … Madame Durand.« Er stutzte, als er sie alleine kommen sah. »Wo ist denn Amalia?«
»Guten Tag, Konstantin, Annabel. Ich weiß es nicht, sie war eben noch hier.«
»Und Mama?«
Maximilian sagte: »Sie hat eine neue Schülerin. Ich denke, sie ist noch in der Reithalle.«
»Vielleicht ist Amalia bei ihr, ich geh mal nach den beiden sehen.«
»Wer ist denn Amalia, Liebling?«
»Komm mit, Annabel, dann wirst du sie kennenlernen.«
Amalia hatte den Tag in der Nähe des Hauses verbracht. Sie wollte keine Minute mit Konstantin versäumen.
Im Stall, dachte Madame, wirst du sie nicht finden.
Amalia war in den Flügel des Hauses geflüchtet, in dem Maria lebte. Sie glaubte zu wissen, was in dem Mädchen vorging.
Sie hörte Annabels ungläubige Stimme. »In den Stall?«
»Ja.«
»Nein, Liebling, ich möchte mich lieber frisch machen.« Sie kicherte.
Wie frisch will sie wohl noch werden, fragte sich Madame und tadelte sich gleich darauf.
Annabel war nervös und unsicher, man musste nachsichtig mit ihr sein. Mit den Männern hatte sie leichtes Spiel. Von Ossten betrachtete sie, wie er alle Frauen ansah. Nun ja. Frederico konnte den Blick nicht von ihr lassen. Die schwerste Prüfung aber würde noch kommen, Theresa hatte sie noch nicht kennengelernt.
Es war das erste Mal, dass Konstantin eine Freundin mit nach Hause brachte, seit er studierte. Seine Schülerlieben hatte Theresa lächelnd akzeptiert. Die hier war etwas anderes. Madame fragte sich, wie Theresa mit einer ernsthaften Kandidatin für das Amt einer Schwiegertochter umgehen mochte.
Konstantin sagte: »Ich zeige dir das Bad.«
»Ein reizendes Mädchen.« Maximilian goss sich einen Cognac nach.
»Ja.« Frederico nickte. »Verdammt hübsch, und eine Figur, da möchte man glatt …« Er wedelte unbestimmt mit der Hand.
Maximilian schmunzelte.
»Ich sehe in der Küche nach dem Rechten.« Madame erhob sich.
Fast neunzehn Uhr. Theresa hatte darum gebeten, trotz der anhaltenden Hitze, nicht zu spät zu essen.
Klaviertöne aus dem oberen Stockwerk des Seitenflügels mündeten in einem furiosen Crescendo. Madame erlaubte sich ein Lächeln. Ihre Kleine war wütend, wütend und unglücklich.
Amalia schlug den Deckel zu und drehte sich mit dem Hocker zu Maria.
»Ich hasse kichernde Blondinen auf hohen Stöckeln, Nonna.«
Damit hatte sie eine umfassende Beschreibung der neuesten Flamme ihres ältesten Enkels abgeliefert.
»Ach, ja? Und sie kichert?«
Maria betete um Fassung. In ihrer Wut wirkte das Mädchen vor ihr wie eine eifersüchtige Ehefrau, die ihren Ehemann mit der attraktiven Nachbarin in flagranti erwischt hatte. Amalia war eifersüchtig, das war keine Frage.
»Vielleicht ist sie ganz nett«, wagte Maria einzuwenden. »Wir sollten sie erst einmal kennenlernen.«
»Sie hat Locken, und sie ist geschminkt.«
Maria betrachtete Amalias Lockenpracht und konnte sich eines Lächelns nicht erwehren. »Du hast auch Locken, mein Kind.«
»Ach, Nonna.«
Amalia setzte sich zu Ludwig und kraulte ihn zwischen den Ohren. Sie schien nachdenken. Plötzlich sprang sie auf. »Wir essen heute früher.«
Maria sah dem Kind hinterher, dessen Gefühle nicht mehr so ganz kindlich waren. Amalia hatte, als sie ging, so … entschlossen ausgesehen.
Amalia beeilte sich, huschte über die dunklen Flure des großen Hauses. Sie kannte jeden Winkel. Alle Läden waren geschlossen, auch die Lamellen, die an kühleren Tagen Lichtstreifen auf Böden und Decken schickten. In der Bibliothek tastete sie nach dem Lichtschalter. Ihr Ziel war der Schreibtisch. Auf dessen gewaltiger Marmorplatte standen zwei Bildschirme und ein Drucker. Papiere und farbige Ordner lagen in ordentlichen Stapeln an der Kante. Sie wusste, dass Maximilian eine große, sehr scharfe Papierschere in der mittleren Schublade aufbewahrte. Sie zog die schwere Lade auf, fand die Schere und lief in ihr Badezimmer. Von Madame war nichts zu sehen. Amalia schloss ab.
Theresa lehnte am Zaun der Koppel.
Sie hatte am Nachmittag Reitstunden gegeben. Stunden mit Schülern, die noch nie auf einem Pferd gesessen hatten, waren manchmal entnervend. Auch in der Halle brütete die Hitze. Jetzt wartete sie auf Marisa. Desdemonas Bein wollte nicht heilen.
Theresa dachte an Konstantin und sah erneut auf die Uhr. Er müsste längst angekommen sein. Sein erster Gang war immer der in den Stall und zu ihr. Ob er sich verspätet hatte?
Endlich hörte sie Marisas Stimme. »Du siehst angespannt aus« Ihre Freundin sah sie prüfend an.
»Bin ich auch. Schau dir Desdemonas Bein an, das macht mir Sorgen.« Sie sah wieder auf die Uhr.
»Erwartest du jemanden?«
»Konstantin wollte für ein paar Tage kommen. Aber er scheint noch nicht da zu sein.«
»Oben, vor dem Haus steht ein sauteures Coupé«, sagte Marisa.
»Er wollte mit seiner Freundin kommen, das wird ihres sein.«
Die Frauen gingen in den Stall. Die Tierärztin sprach beruhigend mit der Stute, während sie ihr den Verband abnahm und sich die Wunde besah.
»Nicht beunruhigend. Das wird schon«, sagte sie und zog eine Spritze auf. »Da sie nicht lahmt, kannst du sie bewegen.« Sie säuberte die Wunde und entnahm ihrem Alukoffer einen frischen Verband. »Fertig.« Sie strich Desdemona sanft über die Nüstern. »Braves Mädchen.«
»Willst du mit zum Abendessen kommen?«
Marisa lachte. »Nein, Süße, deine Familie ist mir heute zu anstrengend. Meine beiden Jüngsten wollen Pasta machen, die anderen sind mit ihren Vätern unterwegs. Mir steht ein ruhiger Abend bevor. Es sei denn, einer meiner tierischen Patienten braucht Hilfe.«
Wie unkompliziert Marisas Leben war. Ihre fünf Söhne und ihre fünf Männer verstanden sich prächtig. Wenn sie Hilfe brauchte, war einer ihrer Liebhaber immer zur Stelle und sorgte nicht nur für seinen, sondern für alle ihre Söhne.
Zusammen gingen sie zum Herrenhaus, wo Marisa ihr klappriges Auto neben einem Sportwagen geparkt hatte.
Theresa umarmte ihre Freundin. »Dann kommst du ein andermal. Konstantin bleibt ein paar Tage.«
»Mal sehen.« Marisa legte sich selten fest, ihr Beruf machte ihr allzu oft einen Strich durch die Rechnung.
Theresa ging an dem bereits gedeckten Tisch unter der Kastanie vorbei.
»Guten Abend, Alicia.«
»Guten Abend, Signora.«
Alicia half Maja in der Küche und hielt zusammen mit Kitty, dem zweiten Mädchen, das Haus sauber. Wenn Gäste da waren, halfen zusätzlich Frauen aus Basso. Alicia legte letzte Hand an den mit weißem Leinen gedeckten Tisch. In hohen Glaszylindern flackerten Kerzen.
Als sie das Haus betrat, hörte sie Maja in der Küche Kitty zur Eile antreiben. »Schlaf nicht ein, Mädchen. Die Signora will sicher heute noch essen.«
Theresa lächelte. Maja war nicht sehr geduldig, aber ihre Gerichte waren exzellent.
Sie lief die Treppe hinauf. Aus Fredericos Zimmer hörte sie laute Rapmusik, die sie keine Minute ertrug. Schnell schritt sie den langen Gang vorbei am Zimmer ihres Mannes, aus dem kein Laut drang. Sie vermutete ihn in der Bibliothek. Konstantins Räume lagen weiter hinten. Auch von dort war nichts zu hören.
Eine halbe Stunde später hatte sie sich in die elegante Frau verwandelt, die Frauen aufregte und Männer erregte.
Als sie die Treppe erreichte, hörte sie Konstantins Stimme. Sie verharrte, als sie ihren Namen hörte. Die helle, etwas kindliche Stimme einer Frau. Sie sah ihren Sohn mit einer hübschen Blondine unten in der Halle stehen. Für einen Moment musste sie die Augen schließen. Konstantins Ähnlichkeit mit seinem Vater war fast lächerlich. Selbst seine Bewegungen waren identisch.
»Sie wird dich mögen, du musst dir keine Sorgen machen.«
Theresa betrachtete die junge Frau. Zwanzig Jahre alt, höchstens, dachte sie.
Sie selbst war achtzehn gewesen, als sie sich in Konstantins Vater verliebt hatte. Sie ließ das Geländer der Galerie los. Konstantin sah auf.
»Mama!« Er strahlte, lief, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinauf und nahm sie in die Arme. »Endlich!«
Sie küsste ihn und schob ihn von sich weg. »Es tut mir leid, aber es war viel zu tun. Früher ging es nicht. Aber«, sie nahm ihn am Arm, »jetzt stellst du mir deine Freundin vor.«
Annabel sah ein Paar, Theresa und Konstantin, auf sich zukommen und fühlte sich unverhofft ausgeschlossen.
Sie war von Beruf Tochter, und zwar die Tochter eines reichen, verwöhnenden Vaters und einer Mutter, die selten anwesend war. Sie besaß ein Selbstbewusstsein, das an Arroganz grenzte, und war es nicht gewohnt, sich ausgeschlossen zu fühlen. Theresa reichte ihr die Hand.
»Ich freue mich, Sie kennenzulernen.«
Dies ist ohne Zweifel eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe, dachte Annabel.
Sie war groß, beinahe so groß wie Konstantin. Und wenn sie nicht gewusst hätte, dass Theresa seine Mutter war … sie hätte ebenso gut seine Geliebte sein können. Wilde Eifersucht überkam sie, und der überwältigende Wunsch, ihr ebenbürtig zu sein. Diese Frau musste über vierzig sein, sah aber gut zehn Jahre jünger aus.
Annabel hing sich an Konstantins Arm.
Theresa lächelte. Das Mädchen in seinem perfekt geschnittenen Kleid sah reizend aus. Auf Stöckelschuhen wirkte Annabel größer, als sie wirklich war.
Sie wird um ihn kämpfen, dachte Theresa.
Sie sah, wie sich Annabel, nach einem Blick auf sie, aufrichtete. Ihr Griff nach Konstantins Arm machte deutlich, zu wem er in Zukunft gehören sollte. Eine Kampfansage? Nun ja. Sie hatte schon viele Klagen von Schwiegermüttern über Schwiegertöchter gehört und umgekehrt.
Frederico kam die Treppe herunter. »Ich habe Hunger«, sagte er und betrachtete die Freundin seines Bruders anerkennend von oben bis unten. »Sehr schick, Rosa steht dir.«
»Danke.« Annabel kicherte und schmiegte sich an Konstantin.
»Frederico, sieh bitte nach deinem Vater, ich nehme an, dass er in der Bibliothek ist. Wir können dann essen.«
Madame erschien als Letzte. »Ich kann Amalia nicht finden«, sagte sie atemlos.
»Sie wird schon kommen, ich habe sie vor einer halben Stunde noch gesehen.« Maria ließ sich auf ihrem Stuhl nieder.
»Wir werden nicht auf sie warten. Alicia? Sie können auftragen.«
»Si, Signora.«
Alicia servierte eine kühle Gurkensuppe mit Crostini als Vorspeise.
»Ich habe Amalia auch noch nicht gesehen«, sagte Konstantin.
In diesem Moment tauchte Amalia aus der Dunkelheit auf.
Maria hob ihre Serviette an den Mund. Sie täuschte einen Hustenanfall vor. Dieses Kind. Sie hatte es geahnt. Amalia trug ein vom Waschen beinahe farblos gewordenes T-Shirt, das um ihre dünnen langen Schenkel schlabberte. Schuhe trug sie keine. Frederico brach in lautes Gelächter aus. Maximilian hob die Brauen. Er sah hilflos zu seiner Frau hinüber, als ob er auf ihre Reaktion wartete.
Annabel griff nach Konstantins Hand und flüsterte: »Oh Gott, was ist das?«
Er entzog ihr seine Hand, erhob sich, nahm Amalia in die Arme und wirbelte sie herum. »Hallo, kleiner Milou, ich habe dich vermisst.«
Amalie schlang ihre Arme um ihn.
Ich dich auch, Tintin, dachte Amalia.
Tintin und Milou, (Tim und Struppi), war der erste Comic, den Konstantin ihr im französischen Original geschenkt hatte. Seit dieser Zeit hatte sie ihn Tintin genannt, wenn sie ihm schrieb.
»Das ist Amalia, Annabel.«
Amalia übersah die ausgestreckte Hand, nickte nur. Sie setzte sich auf den freien Stuhl neben Theresa.
»Du bist zu spät, Amalia.« Theresa strich dem Mädchen über die kurzen, nach allen Richtungen abstehenden, unregelmäßig geschnittenen Locken. »Wenn wir das noch etwas nachschneiden, wird es sehr gut aussehen.« Sie lächelte.
»Alicia, bringen Sie Amalia ihre Suppe.«
Madame Durand hatte es die Sprache verschlagen. Amalias herrliche Locken waren verschwunden. Sie sah aus wie ein ungekämmter Lausbub.
Alicia verschwand grinsend in der Küche, um dort die Neuigkeit zu verkünden. »Amalia hat sich die Haare abgeschnitten, sie sieht aus wie ein zerrupftes Huhn.« Kitty fragte: »Ganz und gar?«
»Höchstens zehn Zentimeter lang.«
Frederico hörte endlich auf zu lachen.
»Warum spricht sie nicht?«, fragte Annabel in die Stille hinein.
»Weil sie nicht möchte«, hörte Theresa ihren Mann sagen.
Sie blickte ihn erstaunt an. Seine Stimme klang kühl und seine Auskunft so schroff, dass Annabel sich nicht traute, das Thema weiter zu verfolgen.
Frederico verkniff sich eine spöttische Bemerkung und klappte den Mund wieder zu.
Maxim hatte sich nur ein einziges Mal zu Amalias Sprachlosigkeit geäußert.
Als sie ins Haus kam, hatte er entschieden, nein, eher befohlen, sie in die Obhut der besten Ärzte, Therapeuten und Lehrer zu geben.
Ein Internat kam für ihn nicht in Frage. Er ließ sich regelmäßig über ihre Fortschritte informieren. Sein Verhältnis zu ihr konnte Theresa nicht einschätzen. Amalia zog es häufig in die Bibliothek, Maximilians bevorzugten Aufenthaltsort.
Manchmal hörte sie Maxim mit ihr sprechen. Die Kleine las leidenschaftlich gerne alles, was ihr in die Finger kam.
Auch Maxim las viel und gerne. Er beschäftigte sich allerdings vorwiegend mit Landwirtschaft, Schafzucht und seinem Lieblingsthema, der Herstellung von Käse. Ob das eine Zwölfjährige fesselte, bezweifelte Theresa, bis sie eines Tages Maxims Stimme hörte:
Durch die halb geöffnete Tür konnte sie Amalia und Maxim sehen. Beide beugten sich über ein dickes Buch. Sie hörte Bruchstücke dessen, was Maxim erklärte: »Stell dir vor, mehr als acht Millionen Liter Schafsmilch … der Pecorino fresco, den du so gerne isst … alles von den Schafen aus der Maremma.« Amalia schrieb etwas auf ihrem Tablet. Sie hielt es ihm hin. Er nickte, erhob sich und zog ein anderes Buch aus einem der Regale.
Theresa fragte sich, als sie leise ihren Horchposten verließ, ob er in Amalia seine Nachfolgerin sah. Wieder fragte sie sich, ob sie sein Kind war. Mit ihr hatte er die Geduld, die er bei seinem eigenen Sohn manchmal vermissen ließ. Frederico war ihm sehr ähnlich, aber er besaß nicht Maxims Ehrgeiz, nur sein ruheloses Temperament, ohne die Fähigkeit, sich auf wichtige Dinge zu konzentrieren. Frederico hatte außer Mädchen und Motorrädern wenig im Sinn. Schafe langweilten ihn. Noch träumte ihr jüngster Sohn.
Theresa kam erst wieder zu sich, als Amalia ihren Arm berührte und Konstantin ihr eine riesige Schüssel Salat anbot.
»Wo bist du denn?«
»Entschuldige.« Sie lächelte Konstantin zu. »Ich war in Gedanken.«
Maxims fragender Blick.
Nach dem Salat gab es Käse, Schinken auf Melonen, Oliven und Brot, zum Nachtisch Eistorte mit Erdbeeren.
Als er am späten Abend ihr Zimmer betrat, wies sie Maxim nicht ab. Das hatte sie nie getan. Theresa stand am Fenster und schaute auf die Hügel in der Ferne. Blasse Hügel, die heller werdend, hintereinander zu schweben schienen. Sie wandte sich nicht um, spürte seine Hände an ihrer Taille. Er besaß noch immer diese Ausstrahlung, die sie zu Beginn ihrer Beziehung so angezogen hatte.
Am Morgen erwachte sie allein. Maxim war ein notorischer Frühaufsteher, sie nicht. Wenn die Arbeit es zuließ, schlief sie lange und überließ sich träge dem Beginn des Tages.
Als sie feststellen musste, dass sie nicht die einzige Frau im Leben ihres Mannes war, hatte sie gelitten, sich verraten und gedemütigt gefühlt.
Aber Theresa war auch pragmatisch. Lange Gespräche mit Marisa, einer Frau, die sie bewunderte, hatten ihr Weltbild langsam verändert.
»Wenn du dich nicht arrangieren kannst, musst du dich trennen. Aber denk nicht mal im Traum daran, dass ich über Jahre dein seelischer Mülleimer sein werde. Du musst eine Entscheidung treffen.«
Das war hart gewesen, aber ehrlich und hilfreich. Theresa hatte sich entschieden.
Sie führte ein angenehmes Leben, mit Freiheiten, von denen andere Frauen nur träumen konnten. Sie liebte die Arbeit mit den Pferden, die Maremma und ritt für ihr Leben gern. Es machte ihr Vergnügen, ein großes Haus zu führen. Wenn Maximilian die Gutsbesitzer und seine Geschäftsfreunde einlud, brillierte sie.
Niemand würde auf die Idee kommen, sie zu bemitleiden.
Maxim wurde hofiert und genoss es. Geld brachte offenbar Ansehen. An solchen Abenden hatte er nur Augen für sie. Sie lächelte und spielte das Spiel mit. Theresa hatte sich arrangiert.
Nach dem Duschen ging sie hinunter in die Halle. Die Haustür war weit geöffnet und ließ ungehemmt Sonne und Hitze ins Haus. Als sie die Tür schloss, bemerkte sie, dass Annabels Sportwagen verschwunden war. In der Küche stand wie jeden Morgen ihr Frühstück bereit. Der unwiderstehliche Duft frisch gemahlener Kaffeebohnen erfüllte den kühlen Raum.
»Guten Morgen, Signora.«
»Guten Morgen, Maja.« Theresa ließ sich am Küchentisch nieder. »Wo ist Kitty?«
»Sie müsste bald wieder da sein. Sie ist im Dorf, um nach ihrer Mutter zu schauen.«
Durch die geöffneten Lamellen der nur angelehnten Läden konnte sie in den großen Gemüsegarten sehen. Der Garten war, wie die Küche, Majas Reich. Von einer hohen Mauer umgeben, war er von außen nicht einsehbar. Obstbäume warfen Schatten auf Beete und sauber geharkte Wege. Hier konnten die Mädchen oder Maja jederzeit Salat und frisches Gemüse ernten. Maja konnte nicht nur kochen, sie besaß auch das, was man einen grünen Daumen nannte.
»Geht es ihrer Mutter schlechter?«
»Die Nacht war nicht gut. Kitty hat bei ihr gewacht.«
Theresa trank noch einen Schluck Kaffee und erhob sich.
»Sagen Sie ihr, sie soll so lange wie nötig bei ihrer Mutter bleiben. Alicia muss alleine zurechtkommen.«
»Es sind zwei Personen mehr im Haus, Signora«, gab Maja zu bedenken.
»Natürlich, daran habe ich nicht gedacht. Vielleicht kann eine der Frauen aus dem Dorf aushelfen?«
Maja nickte. »Das wird sicher gehen.«
Die Köchin ging zum Telefon und erledigte zwei Anrufe.
Die Signora ist eine angenehme Arbeitgeberin, und, dachte sie schmunzelnd, sie hat keine Ahnung von Haushaltsführung, aber ein Händchen dafür, die richtigen Menschen einzustellen.
Ohne Madame Durand und sie wäre der Haushalt längst zusammengebrochen. Madame hatte seit Langem unbemerkt die Pflichten einer Hausdame übernommen. Amalia brauchte, seit sie zur Schule ging, keine Erzieherin oder Nanny mehr.
Theresa fragte: »Hat Konstantin gesagt, wann er zurück ist?«
»Nein, Signora.«
Die Glocke der kleinen Kirche in Basso läutete. Schon Mittag. Sollte sie Konstantin anrufen? Aber nein. Er würde zu ihr kommen, wenn er neben Annabel Zeit dazu fand. Sie verzog unbewusst die Lippen zu einem spöttischen Lächeln und schaute hinüber zu den gelben Hügeln, die in der Hitze zu verglühen schienen. Die Luft flimmerte, als ob die Landschaft einen letzten Atemzug machte. Oben auf dem Kamm standen Zypressen in Reih und Glied, eine Armee von schlanken Wächtern. Sie konnte Basso von hier aus nicht sehen. Warum es so hieß, wusste sie nicht. Vielleicht weil es so klein war? Oder so weit unten im Tal? Es bestand nur aus wenigen Häusern, ein paar Restaurants und, unvermeidlich, einer Kirche ohne Pastor. Wenn Beerdigungen oder Hochzeiten abzuhalten waren, musste man warten, bis ein Pastor aus einem der benachbarten Orte Zeit hatte.
Theresa dachte an Kitty. Ihre Mutter lag im Sterben. Armes Mädchen. Selbstverständlich würde sie der Beerdigung beiwohnen müssen. Sie seufzte. Das war der Teil ihres Aufgabenbereichs, den sie am wenigsten mochte. Diese Auftritte als Gutsherrin lagen ihr nicht.
Maxim hatte keine Schwierigkeiten damit.
»Das sind unsere Leute, die erwarten das«, pflegte er zu sagen. Mein Mann hat zuweilen etwas Überhebliches, dachte sie. In ihren Augen waren diese Menschen nicht »ihre Leute«, sie waren Menschen, von denen unter anderem der Erhalt des Gutes abhing. Aber Maximilian gefiel sich in der Rolle des Gutsherrn. Die Bauern mochten ihn, er wickelte sie ein mit seiner jovialen Art, und da er die Schafe genauso schnell scheren konnte wie sie, erkannten sie ihn als einen der ihren an.
Maria stand hinter halb geschlossenen Läden. Sie sah ihre Tochter in der glühenden Sonne stehen. Die dunklen Locken hatte sie aus der Stirn gekämmt und mit einem Tuch im Nacken gehalten. Von ihr hatte sie ihre Schönheit nicht (ihr Vater war ein schöner Mann gewesen), aber mit Sicherheit die königliche Haltung.
Ein weißes T-Shirt und helle, eng anliegende Reithosen betonten ihre schlanke Gestalt. Plötzlich wandte Theresa sich ihrem Fenster zu. Maria stieß den Laden auf und winkte ihrer Tochter.
»Guten Morgen, Mama. Komm mit, ich will zum Stall hinüber. Ich erwarte zwei Käufer. Sie wollen sich Abigail und Sultan ansehen.«
Maria bewunderte die Energie, mit der ihre Tochter sich den Pferden widmete. Sie hatte sich in den letzten Jahren einen ausgezeichneten Ruf als Züchterin erworben. Es war harte körperliche Arbeit, die ihre Tochter leistete. Sie wusste, wie viel Disziplin dazu gehörte, ganz und gar in seinem Beruf aufzugehen.
Als Pianistin war sie viel gereist, hatte wochenlang aus dem Koffer gelebt und jeden Tag viele Stunden am Flügel verbracht. Für die Konzerte brauchte man die Kondition eines Spitzensportlers.
»Warte, wir sind gleich bei dir.« Minuten später trat Maria mit ihrem Hund aus dem Haus.
Theresa lachte. »Sehr dramatisch«, sagte sie. »Einen Größeren gab es nicht?«
Der pinkfarbene Hut, den Maria zu einem langen weißen Leinenkleid trug, war riesig. Ein Gigant aus Tüll und Seide.
Sie fasste mit beiden Händen den vorderen Rand und bog ihn keck nach oben. »Du solltest dich auch besser vor der Sonne schützen.«
»Das wäre zu Reithosen der Hit, Mama«, spottete sie.
Ludwig wedelte mit dem Schwanz und verzog die Lefzen, was man als Lächeln deuten konnte. Theresa kraulte ihn zwischen den Ohren. Sie passte sich dem Gang ihrer Mutter an. Die beiden Frauen hatten in den letzten Jahren wieder zueinander gefunden. Maria dachte an die tausend Abschiede von ihrer Tochter, an ihre lange Abwesenheit, die ihre Auftritte nun mal notwendig machten. Und hätte man sie gefragt …
Wenn sie sich fragte, ob sie sich für ihr Kind oder ihre Karriere entscheiden sollte, so hätte sie auch heute noch die Karriere gewählt. Sie war keine gute Mutter gewesen. Theresa war mit Fremden aufgewachsen.
Jetzt griff sie nach Theresas Arm. »Ich war wohl keine gute Mutter?«
Die Antwort kam spontan und ehrlich. »Nein, das warst du nicht. Aber ich hätte dich nicht anders gewollt.«
Vor der Reithalle stand ein offener Pferdetransporter.
»Ah«, sagte Theresa, »Ariel bekommt seine schöne Braut zugeführt.«
Ariel war ein dunkler Hengst, ihr ganzer Stolz. Er hatte viele Rennen gewonnen.
Maxims bevorzugtes Reitpferd. Kein Wunder, dachte Theresa, dass ihr Ehemann einen Deckhengst ritt. Sie musste sich zusammenreißen, um ihre plötzliche Heiterkeit zu unterdrücken. Pferd und Reiter hatten dieselben Vorlieben, nur waren Ariels Ritte auf den Damen von mehr Erfolg gekrönt. Alle Stuten, die er gedeckt hatte, waren trächtig geworden. Ihr Mann war nur einmal Vater geworden.
Theresas Blick fiel auf einen Jungen, der auf dem Gatter der Weide balancierte, auf der die Stuten mit ihren Fohlen standen. Kurze, von der Sonne vergoldete Locken, ein breiter lachender Mund, etwas abstehende Ohren. Abgeschnittene Jeans und ein Top. Sie lächelte. Das war kein Junge, sondern ein Mädchen. Amalia.
Amalia setzte vorsichtig Fuß vor Fuß. Ihre Arme hatte sie ausgebreitet, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.
»Sie wird fallen«, sagte Maria.
»Wird sie nicht.«
Raffael stand plötzlich neben ihnen. Er schnippte mit den Fingern. Einer der Stallburschen brachte einen Hocker.
»Signora.« Er machte eine Geste.
»Danke, mein Lieber, aber ich bin keine Greisin.«
Der Bursche grinste und verschwand. Maria entnahm einer ihrer Kleidertaschen ein Taschentuch und breitete es auf dem nicht ganz sauberen Sitz aus, bevor sie sich dankbar niederließ.
Amalia sprang vom Zaun und näherte sich langsam Luna und ihrem Sohn.
»Nur keine hektischen Bewegungen«, hatte Theresa ihr eingeschärft.
Sie schnalzte leise mit der Zunge. Luna kam ihr ein paar Schritte entgegen. Neben ihr trabte Lauser. Der kleine Hengst war gewachsen und so ausgelassen, dass er alle paar Schritte in die Höhe hopsen musste.
Amalias Lächeln wurde breiter. Sie hielt Luna ein Stückchen Zucker hin und spürte warmen Samt in ihrer Handfläche, als die Stute den Zucker vorsichtig von ihrer flachen Hand nahm.
Als sie zurückblickte, schob sich ein brauner Pferdehintern rückwärts aus dem Transporter. Marias Sonnenhut leuchtete in der Sonne, Raffael und Theresa standen Seite an Seite neben der Rampe. Raffael nahm die Stute am Strick und brachte sie in ein Gehege neben der Reitbahn.
Amalia rannte zum Zaun, pflückte im Laufen ihre Kappe vom Boden, setzte sie ohne anzuhalten auf und kam gleichzeitig mit Raffael beim Gehege an. Sie wollte unbedingt dabei sein, wenn Ariel die Stute deckte. Sie hatte das nicht oft gesehen, und es war aufregend. Normalerweise wurde eine künstliche Befruchtung vorgenommen.
Amalia kannte die sanfte Pferdedame, die schon ein paar Fohlen von Ariel hatte. Sie gehörte zu einem Gut, das nur wenige Kilometer entfernt lag.
Plötzlich entstand Aufregung drüben im Stall. Schrilles Wiehern, Stampfen und Schreie, laute Flüche, wieder Geschrei, Hundegebell.
Raffael schloss das Gatter und lief hinüber zum Stall. Amalia blieb dicht hinter ihm. Marias Hut war verschwunden. Sie konnte weder ihre Nonna noch Theresa entdecken.
Bevor sie die Stalltür erreichten, drehte sich Raffael um. Er hob Amalia auf die Umzäunung des Reitplatzes.
»Rühr dich nicht vom Fleck«, sagte er streng.
Sie sah ihn in den Stall eilen, hörte ihn fluchen, wie nur er fluchen konnte. »Welcher verfluchte Pinsel hat den Hengst rausgelassen. Ich brate seine Eier und stopfe sie ihm in den Hals.«
Sehen konnte sie nichts, aber sie hörte das erregte Wiehern, den Lärm stampfender Hufe, splitterndes Holz und laute Befehle. Gleich darauf erschien der riesige Hengst im Zustand äußerster Erregung. Ariel wirkte doppelt so groß wie sonst. Er musste seine Braut gewittert haben und war völlig außer sich. Frederico hing an einer Seite, Raffael an der anderen, um den Hengst zu halten. Er sieht aus wie ein Schlachtross. Amalia dachte an das Gemälde in der Bibliothek ihres Onkels. In diesem Moment stieg Ariel, Frederico ließ den Strick los, Raffael klammerte sich ans Halfter. Vergebens. Er sackte in die Knie und fiel vornüber.
»Raffael!« Theresas Schrei.
Amalia hielt den Atem an, aber sie rührte sich nicht.
Das Chaos war perfekt, als Ariel das Gehege erreichte und zu einem wunderschönen Sprung ansetzte. Er schien zu fliegen.
Frederico hetzte mit zwei Stallburschen hinter ihm her. Als sie das Gehege erreichten, war Ariel bereits dabei, seine Braut beglücken. Sie stand ganz still. Zufrieden und sanft wie ein Lämmchen ließ Ariel sich zurück in den Stall führen.
Nichts davon sah Theresa. Raffaels Augen waren geschlossen und eine Platzwunde am Kopf zeigte, wo Ariels Huf ihn getroffen hatte.
»Ich schneid ihm die Eier ab«, murmelte er, ohne die Augen zu öffnen.
»Ganz, wie du willst, mein Liebster.« Sie strich ihm über die Stirn.
»Komm, Kind«, sie hörte die Stimme ihrer Mutter, »du musst ihn loslassen, die Ambulanz ist da.«
Theresa erhob sich wortlos.
Über Amalias Wangen liefen dicke Tränen, malten kleine helle Bäche in ihr schmutziges Gesichtchen. Sie klammerte sich an das Holz der Umzäunung.
Hinter dem Tränenschleier sah sie Maria auf sich zukommen. »Raffael wird es überleben.«
Diesen Mann brachte man nicht so schnell um, dachte Maria.
Zwei Sanitäter bemühten sich, Raffael auf eine Trage zu heben.
»Wir gehen jetzt zu Maja. Sie hat bestimmt ein Eis für uns. Schau, da ist auch Ludwig, er wird uns begleiten.«
Amalia schwieg und nickte. Mit dem Handrücken wischte sie sich den Rotz von der Oberlippe, bevor sie vom Zaun sprang. Dann schob sich ihre klebrige Hand in die Marias. Maria ließ es geschehen, ohne mit der Wimper zu zucken.
Niemals in ihrem Leben hatte sie die Hand ihrer Tochter so vertrauensvoll in ihrer gefühlt. Sie konnte sich nicht erinnern, dass Theresa je geweint hätte. Aber eben, neben Raffael, hatte sie Tränen in den Augen ihrer Tochter gesehen.