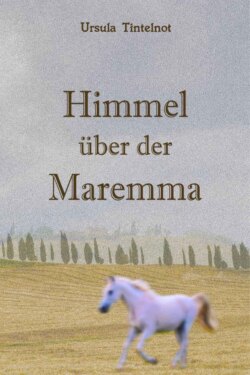Читать книгу Himmel über der Maremma - Ursula Tintelnot - Страница 9
Verzaubert
ОглавлениеAmalia trieb Sultan an. Ein Blick über die Schulter sagte ihr, dass Konstantin hinter ihr zurückblieb. Sie hatte nicht umsonst darum gebeten, den Wallach reiten zu dürfen. Er war so viel schneller als Norma.
Konstantin ahnte, wohin seine Cousine wollte.
Der Fluss schlängelte sich silbern und flach durch die Landschaft. Die Ufer unbefestigt, wand er sich durch ein Tal, umgeben von Felsen und Laubbäumen, die ein Schatten spendendes Dach darüber bildeten. Sein Wasser war sauber, voller Fische und herrlich kühl. Aber sie würden lange unterwegs sein.
Jetzt zügelte sie Sultan und wartete auf Konstantin. Amalia strahlte über das ganze Gesicht. Ihre Augen blitzten. Als er fast bei ihr war, hörte er ein leises Schnalzen. Sultan gehorchte sofort und stob wieder davon.
»Na warte«, brummte Konstantin.
Sie hatte ihn hereingelegt, die kleine Hexe. Nun wusste er, warum sie unbedingt Sultan reiten wollte. Er musste lachen. Wie eine Sirene lockte sie ihn hinter sich her.
Jetzt ließ sie Sultan langsamer laufen, bis Konstantin aufschloss.
»Wir werden nicht vor dem Abend zurück sein, wenn du zum Fluss willst.«
Sie nickte eifrig. Er hatte sie durchschaut.
»Wir werden verhungern und verdursten«, rief er.
Amalia schüttelte den Kopf und deutete mit einer vagen Bewegung zu ihrer Satteltasche.
Er ergab sich. Konstantin zügelte Norma und zückte sein Handy. Sultan verfiel in einen langsamen Trab, während Konstantin Annabels Nummer wählte. Kein Netz, verdammt! Er würde es später versuchen.
Dann hatte Konstantin diesen verzauberten Nachmittag genossen und vergessen, bei Annabel anzurufen. Er hatte mit Amalia gelacht und in ihrer Geheimsprache mit Händen und Füßen geredet. Sie hatten sich ausgezogen, um im Fluss zu schwimmen. Er war wieder der große Bruder, der sie wie vor Jahren, als sie klein, hilflos und stumm in dem großen fremden Haus in der Maremma gestanden hatte. Der Bruder, der ihr die Furcht vor den Pferden genommen und das Schwimmen im See beigebracht hatte.
»Du bist schwerer geworden.«
Er stöhnte, als er sie Huckepack ans Ufer trug. Sie rollten lachend ins Gras. Unter dem Baum, an dem die Pferde angebunden waren, aßen sie die Köstlichkeiten, die Maja für sie eingepackt hatte. Die Wasserflaschen kühlten im Fluss.
»Wie war euer Tag?« Maria blickte zu Konstantin und Annabel hinüber.
Konstantin legte seine Hand über die Annabels. Amalia, die zwischen Theresa und Konstantin saß, machte ein sehr zufriedenes Gesicht. Sie hob strahlend beide Fäuste mit dem Daumen nach oben.
»Es war ein wunderschöner Ausflug. Allerdings«, fügte Konstantin hinzu, »hat er länger als geplant gedauert. Milou hat mich reingelegt.« Er lächelte.
Amalia nickte, und ihre Lippen verzogen sich zu einem breiten Lachen.
Annabel entzog Konstantin ihre Hand und presste die Lippen zusammen. »Ich finde das nicht zum Lachen. Du hättest dich melden können.«
Ach du je, dachte Maria, das Mädchen ist verstimmt.
»Nicht böse sein, Liebling, es gab kein Netz.«
Dass er sie nach nur einem Versuch einfach vergessen hatte, verschwieg er.
Frederico mischte sich ein. »Meinetwegen hättet ihr noch länger wegbleiben können.« Er wirkte leicht angetrunken. Theresa sah ihn beunruhigt an.
»Mit einer hübschen Frau Champagner zu trinken, ist mir noch immer lieber, als einen Nachmittag mit einem stummen Kind zu verbringen.«
»Reiß dich zusammen, Frederico.« Konstantin war wütend. »Lass Amalia endlich in Ruhe. Dein Verhalten ist kindisch und unangebracht.«
Maria betrachtete Konstantins Ausbruch interessiert. Er hatte Amalia immer beigestanden, aber nie seinen Bruder so vehement vorgeführt. Auch Theresa wirkte verblüfft.
Frederico spöttelte: »Eifersüchtig? Annabel und ich haben uns wirklich gut unterhalten.«
Madame Durand folgte der Auseinandersetzung und dachte sich ihren Teil. Verstand Frederico seinen Bruder absichtlich falsch? Auch Annabel schien ihn nicht zu verstehen.
»Aber, Liebling, Frederico hat es nicht böse gemeint.« Jetzt nahm sie seine Hand. »Wir haben vielleicht ein bisschen zu viel getrunken, weißt du? Aber du musst nicht sauer auf uns sein.«
»Es ist gut, Annabel.«
Konstantin sah aus, als würde er sich selbst nicht so recht verstehen. Er hätte seinem Bruder vor allen anderen nicht so über den Mund fahren dürfen. Er hatte emotionaler reagiert als nötig, und Madame Durand fragte sich, warum.
Sie reichte Theresa eine Platte mit Melonenspalten und Parmaschinken.
»Danke.«
Konstantin nahm seiner Mutter die Platte ab und reichte sie an Annabel weiter.
»Erzähl uns doch mal etwas von deiner Arbeit in Afrika.« Theresa lenkte das Gespräch in sicherere Gefilde. »Wie lange wirst du fort sein?«
Er zuckte mit den Schultern. »Das ist noch nicht klar. Es gibt in Gambia eine Buschklinik, dort arbeitet eine Ärztin, deren Arbeit ich begleiten werde. Ich kenne sie durch ihren Bruder, einen Kommilitonen von mir.«
»Werden Sie mit Konstantin gehen?«, wandte sich Maria an Annabel.
Eine Frage, die auch Theresa brennend interessierte, die sie aber nicht zu stellen gewagt hatte.
»Ich werde meinen Mann nicht alleine fahren lassen, so kurz nach der Hochzeit.«
»Ihr wollt heiraten …?« Maria war selten sprachlos.
Alicia räumte die Teller ab. »Kann ich dann den Salat bringen, Signora?«
»Bitte, Alicia.«
»Sie wollen heiraten!« Mit dieser Neuigkeit stürzte Alicia in die Küche.
»Wer will heiraten?«
»Konstantin und Annabel.«
Maja mischte Panzanella in einer riesigen Schüssel. Karamellisierte Kirschtomaten, rote Zwiebeln, Friseesalat, Pinienkerne und Ciabatta. Sie blieb ungerührt. »Alt genug ist er ja. Stell die Teller ab, Alicia, und bring den Salat hinaus.«
Theresa amüsierte sich über Marias Sprachlosigkeit. Sie lächelte. »Wir wollten mit dieser Ankündigung eigentlich warten, bis Maximilian zurück ist, nicht wahr, Annabel?«
Annabel errötete. »Entschuldigung, aber es ist mir so herausgerutscht.«
»Dann werde ich ja vielleicht auch noch Urgroßmutter«, sagte Maria aus ihrer Erstarrung erwachend.
Frederico grinste. »Seht zu, dass es kein schwarzes Baby wird.«
Niemand reagierte.
Theresas Blick fiel auf Amalia. Die Kleine starrte auf ihren Teller. Dicke Tränen liefen über ihre Wangen. Abrupt erhob sie sich. Ihr Tablet lag auf dem Tisch. Theresa las, was Amalia zuletzt geschrieben hatte. »Ich wünschte, sie wäre tot.« Theresa löschte den Text.
Alicia stellte eine Schüssel mit herrlich duftendem Salat auf den Tisch.
»Was hat die denn jetzt, ich hab doch gar nichts gesagt.« Offenbar war sich Frederico keiner Schuld bewusst. Ehrlich verblüfft sah er seiner Cousine nach.
Madame hatte sich halb erhoben, setzte sich aber wieder.
»Entschuldigt mich.« Theresa legte die Serviette neben ihren Teller. »Lasst euch nicht stören, ich bin gleich wieder da.«
Sie nahm Amalias Tablet an sich und folgte ihr. Wie vermutet, fand sie Amalia auf der Weide bei ihrem Fohlen und Luna. Sie hatte ihren Kopf an Lunas Seite gelegt, ein Schluchzen schüttelte ihre schmalen Schultern. Theresa öffnete das Gatter und schloss es hinter sich. Als sie Theresa hörte, wieherte Luna leise und hob den Kopf. Dass Amalia Konstantin liebte, konnte niemandem entgangen sein. Schon als Vierjährige hatte sie ihm von Anfang an ihr ganzes Vertrauen geschenkt. Theresa hatte nie wirklich darüber nachgedacht, aber für sie war diese Liebe nichts weiter als schwesterliche Zuneigung gewesen. Hatte sie sich geirrt? Und wie sollte sie ein enttäuschtes kleines Mädchen trösten?
Vielleicht, dachte sie, hätte ich doch Madame gehen lassen sollen.
Theresa traute ihren eigenen mütterlichen Fähigkeiten nicht sonderlich.
»Amalia?« Langsam ging sie auf das Mädchen zu. »Ich habe dir dein Tablet mitgebracht.«
Amalia fuhr sich mit beiden Händen übers Gesicht. Dann drehte sie sich zu Theresa um und streckte die Hand nach dem Gerät aus. Sie sah auf den leeren Bildschirm.
»Ich habe es nicht so gemeint, es tut mir leid«, schrieb sie.
»Du bist traurig, Amalia. Aber ich weiß, dass Konstantin dich sehr lieb hat, daran kann auch Annabel nichts ändern.«
Amalia nickte. Sie wirkte jetzt ruhiger.
Kein Grashalm rührte sich. Hitze quälte das Land. Erdiger Geruch. Die Fohlen lagen im Gras, und ihre Mütter standen reglos bei ihnen. Nur ein leises Schnauben unterbrach gelegentlich die Stille.
Amalia strich behutsam über die Nase ihres jungen Hengstes. Das von der Sonne ausgedörrte Gras verströmte einen eigenartigen Brandgeruch.
»Er ist gewachsen«, sagte Theresa. »Komm jetzt, es ist spät.«
Madame erwartete Amalia in der Halle. Sie nickte Theresa zu.
Theresa beobachtete, wie Amalia beinahe schutzsuchend nach Madame Durands Hand griff, während sie zusammen die Stufen hinaufstiegen. Sie war sicher, dass Madame das Mädchen besser trösten konnte als sie selbst.
Oben wandte sich Madame Durand noch einmal um.
»Konstantin ist mit Annabel und Frederico zu Stephano gefahren.«
»Danke, gute Nacht.«
Stephano war ein wenige Kilometer entferntes Restaurant, in dem man sich traf, wenn man nicht nach Siena oder dem noch weiter entfernten Grosseto fahren wollte. Man konnte dort hervorragend essen oder nur den guten Hauswein trinken.
Theresa schloss die Haustür hinter sich und ging den Weg zurück, den sie gerade gekommen war.
Raffael saß vor seinem Haus auf den Stufen. In der Hand hielt er ein Glas. Manchmal glaubte er zu träumen, wenn sie so wie jetzt auf ihn zuschritt. Er fürchtete, ihr Bild könnte sich auflösen. Aber da war sie, berührte ihn, setzte sich neben ihn auf die Steinstufen.
»Konstantin will mich zur Schwiegermutter machen.«
»Ein schwerer Schlag, Liebste.« Er lachte. »Zumal ich mir denken kann, wie es weitergeht.«
»Was meinst du?«
»Aus Schwiegermüttern werden schnell Großmütter.« Er sprang auf, bevor sie ihn schlagen konnte.
»Ich hole dir ein Glas Wein.«
»Wirst du eine Nonna lieben können?«
Belustigt blickte er auf sie hinab. »Wenn diese Nonna so klug und sexy und so unglaublich schön ist wie du, könnte ich mich dazu durchringen.« Er nahm sie in die Arme und küsste sie zärtlich. Seine Hände glitten über ihre Schultern.
»Nein, Raffael, ich will reden.«
»Gut, reden wir.«
»Konstantin will nach Afrika gehen.« Sie seufzte. »Ich habe Angst um ihn. Gambia ist keineswegs ein sicheres Land. Ich fürchte, der neue Präsident ist nicht viel besser als der alte. Nach zweiundzwanzig Jahren Diktatur, Entführungen und Folter wird es in den nächsten Monaten bestimmt nicht viel besser werden.«
»Ist er fest entschlossen?«
»Ja. Und Annabel wird mit ihm gehen.« Theresa trank ihren Wein aus und reichte Raffael das Glas. »Hast du noch einen?«
»So schlimm?« Raffael lächelte, sie trank normalerweise sehr wenig.
»Es ist mir ernst. Am liebsten würde ich mich für ein Jahr ins Koma trinken. Erst die Hochzeit, dann Afrika, ich werde vor Angst sterben.«
»Nein, das wirst du nicht. Außerdem hast du keine Wahl, du musst ihn gehen lassen.«
Seine Gedanken wanderten Jahre zurück. Seine Mutter hatte geweint, als er mit sechzehn Jahren den kleinen elterlichen Hof zwischen Lucca und Pisa verließ. Australien und Neuseeland schienen ihr so weit entfernt wie der Mond. »Ich werde dich nie wiedersehen«, hatte sie geschluchzt.
Wäre ich geblieben, wenn ich gewusst hätte, dass ihre Worte wahr werden würden, fragte er sich.
Raffael horchte auf die Laute der Nacht. Ununterbrochen das Zirpen der Zikaden, weit entferntes Hundegebell. Einer der beiden weißen Maremma-Hunde im Stall antwortete. Es raschelte im Gebüsch. Ein Hauch streifte ihn, ein weißer Schatten, die Eule auf der Jagd. Ein Vogel zirpte im Schlaf. All diese Geräusche ließen die eigentliche Stille der Nacht noch deutlicher werden.
Vor seinen Augen sah er die Apfelwiese hinter dem Haus, die Olivenbäume und die Ziegen, die seinen Eltern gehört hatten. Das ganze Anwesen stank nach diesen Tieren. Seine Mutter machte Käse aus der Ziegenmilch und fuhr damit am Wochenende zum Markt. Ja, sie hatten ein Auskommen, aber Raffael wollte mehr. Sechs Jahre hatte er im Ausland verbracht. Als er zurückkam, tat er es, um seine Mutter zu beerdigen und dem Vater beizustehen.
Das Haus und ein paar Nebengebäude hatte er nach dem Tod seines Vaters verkauft. Nur ein kleines Steinhaus hatte er behalten. Sein Rückzugsort.
»Woran denkst du?« Theresa sah ihn fragend an.
»An nichts. Komm ins Bett!«
Er stand auf, half ihr von den Stufen hoch und zog sie mit sich.
In seinen Armen vergaß sie ihre Ängste, fand Ruhe, für eine Weile.